Die Corona-Pandemie hat die Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach Ansicht des Weltwirtschaftsforums (WEF) um Jahrzehnte zurückgeworfen. Es dürfte noch 135,6 Jahre dauern, bis Frauen bei der Gleichbehandlung zu ihren männlichen Mitbürgern aufschließen, wie das Forum am Mittwoch in einem aktuellen Bericht mitteilte. Im Dezember 2019 und damit vor Ausbruch der Corona-Pandemie war das WEF noch davon ausgegangen, dass sich der Gender Gap in 99,5 Jahren schließen könnte.
Die globale Corona-Krise habe Frauen ungleich höher belastet als Männer, denn sie hätten häufiger ihren Job verloren und außerdem bei geschlossenen Schulen und Einrichtungen mehr Betreuungsarbeit auf sich genommen. Diese Folgen würden langfristig spürbar sein, warnte das Weltwirtschaftsforum.
Zu Hause seien die Menschen vielerorts in „traditionelle Verhaltensmuster zurückgefallen“, beklagte WEF-Geschäftsführerin Saadia Zahidi in einer virtuellen Pressekonferenz. Arbeitende Frauen seien durch Doppelschichten belastet worden. Nun werde „eine weitere Generation von Frauen auf Geschlechtergleichheit warten“ müssen.
Worum es geht
Der Gender Gap umschreibt die Unterschiede der Geschlechter mit Blick auf politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung. Auch der Zugang zu Bildung sowie die Lebenserwartung spielen eine Rolle. Das in Genf ansässige WEF erstellt seinen Global Gender Gap anhand der vier Kriterien Bildung, Gesundheit, Wirtschaft und politische Teilhabe.
Positiv sieht das WEF, dass Frauen zunehmend in den Bereichen Bildung und Gesundheit aufschließen. Mit einer vollständigen Gleichberechtigung am Arbeitsplatz rechnet das Forum hingegen erst in knapp 268 Jahren – auch wegen der Pandemie. Die Experten verwiesen dabei auf eine UN-Studie, wonach Frauen überproportional oft in Berufen vertreten sind, die von Lockdown-Maßnahmen betroffen waren.
Luxemburg fällt um vier Plätze auf Rang 55
Dabei gibt es laut WEF insgesamt große Unterschiede zwischen den Ländern und Regionen. Während es in Westeuropa gelingen dürfte, die Geschlechterungerechtigkeit in gut 52 Jahren zu überwinden, könnte es in Nordafrika und dem Mittleren Osten noch über 142 Jahre dauern. Am fortschrittlichsten stehen die nordischen Länder Island, Finnland und Norwegen da. Luxemburg rangiert bloß auf Platz 55 unter 156 Staaten und fällt im Vergleich zum letzten WEF-Bericht um vier Plätze zurück. Am unteren Ende der Skala rangieren der Irak, Jemen und Afghanistan.
Sorge bereitet dem WEF auch die Entwicklung im politischen Bereich – dort wachse die Lücke: Noch immer würden nur rund ein Viertel der Parlamentssitze weltweit von Frauen besetzt. Auf Ministeriumsposten sitzen weltweit 22,6 Prozent Frauen.
Wie in anderen Regionen bestehen auch in Westeuropa erhebliche Ungleichheiten in der politischen Machtausübung. Noch immer sind Frauen in der Politik mit 43,8 Prozent im europäischen Durchschnitt unterrepräsentiert. Außerdem verdeckt dieser Durchschnitt dem Bericht zufolge die große Kluft zwischen Ländern, in denen Lücken relativ gering sind, wie z.B. in Island (76,0%), Finnland (66,9%) und Norwegen (64%), und Ländern, die noch nicht zwei Drittel ihrer Lücken geschlossen haben (Luxemburg, Malta, Griechenland und Zypern).
Bemerkenswert an der Europäischen Union sei, bemerkt der Bericht, dass Länder, in denen Frauen und Männer gleich stark im Parlament und unter den Ministern vertreten sind, mit Ländern koexistieren, die einen Frauenanteil von nur 15 Prozent unter den Parlamentarier haben. Luxemburgs Anteil liegt hier bei 37 Prozent – das aber nicht wegen des letzten Wahlergebnisses, sondern wegen diverser Wechsel seitdem. (Red. mit AFP)

 De Maart
De Maart






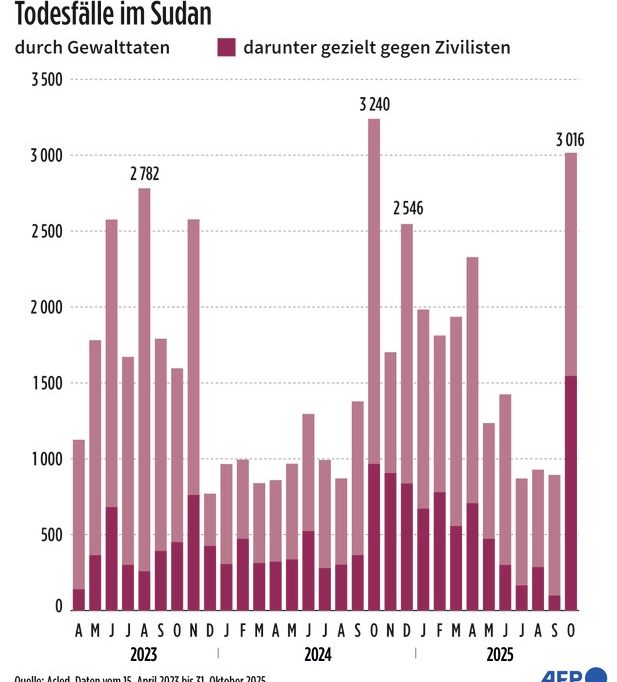
Wenigstens hat unsere Armee weibliche Unterwäsche für die Soldatinnen, die Schweiz hat sie jetzt 2021 bekommen.
Aber das Wahlrecht bekamen sie ja auch 50-70 Jahre später als alle anderen, dann sind die das ja gewohnt.
Meine Tante kann erst seit 30 Jahren wählen in ihrem Kanton.