Kaum war die neue Begräbnisstätte eingeweiht, musste sie die 116 Escher Opfer der Cholera-Epidemie von 1866 aufnehmen. Diese raffte jeden 15. Escher dahin. Über die Jahrzehnte wurde der Friedhof mehrmals erweitert, um mit der Bevölkerungsentwicklung von Esch/Alzette Schritt zu halten. Trotzdem kann man allenthalben den demografischen Druck spüren, der auf dem Bering lastete. Manche Gräber liegen so eng aneinander, dass man kaum dazwischen stehen kann. Daher sei Besuchern geraten, sich entlang der Hauptalleen zu bewegen, um von hier aus die verschiedenen Grabmonumente zu entdecken.
Der Friedhof wird durch eine Längs- und eine Querallee in vier unterschiedlich große Felder geteilt. Die – von der Pfarrkirche Sankt Joseph aus betrachtet – links neben der Längsachse gelegenen Felder werden für die weitere Orientierung mit a) und b) bezeichnet. Die Felder rechts neben der Längsallee werden als c) und d) geführt.
Die Geschichte des Sankt-Joseph-Friedhofs illustriert exemplarisch die Entstehung derartiger Einrichtungen im urbanen Milieu. Als die Begräbnisstätte konzipiert wurde, erstreckte sie sich am äußeren Ortsrand von Esch/Alzette. Heute liegt sie, von Wohnhäusern eingezwängt, mitten in der Stadt. Die Stadtentwicklung hat den Friedhof eingeholt. Diese Feststellung hat kürzlich die Gemeindeverwaltung zu dem originellen – aber nicht von allen Eschern getragenen – Entschluss bewogen, den Friedhof in das städtische Wegenetz einzubinden. So bleiben die Friedhofstore Tag und Nacht geöffnet und die Alleen sind als Fußgänger- und Fahrradwege ausgeschildert. Zudem vergibt die Stadt für das Areal von Sankt Joseph keine neuen Grabkonzessionen. Während bestehende Konzessionen von den Familien weiter genutzt werden dürfen, zieht die Verwaltung solche, die verfallen sind, ein. Baufällige Grabmonumente werden entfernt, während solche, denen ein Wert beigemessen wird, restauriert werden. So entsteht nach und nach ein parkartiger Ort der Erinnerung an die alten Escher Familien. Das Vorgehen der städtischen Behörden wirft allerdings die Frage auf, welche Kriterien diesem konservatorischen Tun zugrunde liegen.
Für eine steigende Anzahl von Begräbnissen wird nicht mehr auf religiöse Zeremonien zurückgegriffen. Daher wurde zu Beginn der 1990er Jahre eine an der rechten Querachse des Friedhofs gelegene Halle eingerichtet, die es den Menschen erlaubt, ihre Toten jenseits aller Konfessionen würdig zu verabschieden. Den schlichten Bau betritt man durch einen überdachten Säulenvorhof. Der eigentliche Abschiedsraum erhält Licht über einen auffälligen, die Decke durchbrechenden Dachreiter sowie zwei kreisrunde Seitenfenster.
Der Besucher kann den Friedhof nach verschiedenen Gesichtspunkten erforschen. Er kann z.B. die für die Gräber verwendeten Symbole betrachten. So steht etwa das immergrüne Efeu für ewiges Leben. Eine gebrochene Säule gilt als Symbol für einen allzu frühen Tod. Der Anker steht für Hoffnung. Verschränkte Hände sollen die Verbundenheit eines Ehepaares über den Tod hinaus bedeuten. Der Kelch kennzeichnet ein Priestergrab. Weitere Kriterien könnten die verwendeten Materialien – Sandstein, Granit, Marmor – sein sowie der künstlerische Wert oder die gesellschaftliche Relevanz eines Grabmonumentes.
Allgemein gewinnt man bei der Betrachtung des Friedhofs den Eindruck, dass im Verlauf der Jahrzehnte von vertikalen, hoch aufragenden Grabmälern zu horizontalen, also flachen Grabplatten übergegangen wurde. Gleichzeitig verlor er an Vielfalt, da die erneuerten Gräber zur Uniformität tendierten.

Foto: © Christof Weber, 2015.
Die ältesten Grabmonumente sind aus Sandstein gefertigt. Sie stammen meist aus der Werkstatt Haal aus Grevenmacher und wurden demnach nach Esch „importiert“. Ähnliche Grabsteine finden sich auch auf dem Liebfrauenfriedhof in der Hauptstadt. Als urtypisch für diese Produktion mag das turmartige neogotische Grabmal der Eheleute Van Dyck-Schmitz gelten (a). Doch auch der frankofone, 1914 in Athus geborene luxemburgische Schriftsteller, Dichter und Dramaturg Edouard Herrmann, der unter dem Pseudonym Edmond Dune veröffentlichte, ruht in einem alten, zwischen zwei Thuja-Sträuchern versteckten Sandsteingrab (a).
Die alten Granitmonumente lieferten dagegen zwei Escher Ateliers, nämlich die von Johann Weisgerber-Gillen und Johann Baptist Kersch, geboren 1860 respektive 1843. Die Produktion der beiden Werkstätten reichte bis in die Zwischenkriegszeit, da ihre Betreiber sich eines für die damalige Zeit langen Lebens erfreuen durften. Die Monumente bestehen gewöhnlich aus einer variablen Anzahl von aufeinandergestapelten Granitblöcken, die von einem hohen Kreuz gekrönt werden. Die Grabsteine von Kersch, der auch als Bauunternehmer arbeitete, sind solide und weitestgehend schnörkellos. Weisgerber-Gillen verstand sich jedoch als Bildhauer. So weisen die Sockelelemente seiner Monumente häufig ein verspieltes Detail auf. Er scheute auch nicht davor zurück – wohl meist nach Vorlagen –, Marmor zu bearbeiten. So zu sehen an seinem eigenen Familiengrab (b). Hier stützt sich ein großer Marmorengel auf einen Anker. Bemerkenswert auch das Grab der Unternehmerfamilie Buchholtz. Hier hält eine marmorne junge Trauerende einen Rosenstrauß, der wohl für die Vergänglichkeit allen Lebens steht. In dieser Grabstätte wurde auch die Komponistin Hélène Buchholtz (1877-1914) beigesetzt (b). (Fortsetzung folgt.)
Die Serie
Von April bis Juli 2020 lädt das Tageblatt seine Leser zu einem Spaziergang durch die Geschichte einer außergewöhnlichen Stadt ein: Esch/Alzette, Hauptstadt des luxemburgischen Erzbeckens. Als Vorschau auf die Veröffentlichung des „Guide historique et architectural Esch-sur-Alzette“ im Juli 2020 stellt das Tageblatt jeden Tag eines der rund 150 für das Buch ausgewählten Gebäude vor. Georges Büchler, Jean Goedert, Antoinette Lorang, Antoinette Reuter und Denis Scuto sind die Autoren. Die Fotos stammen von Christof Weber. Der Stadtführer wird vom Luxembourg Centre for Contemporary History (C2DH) und der Gemeinde Esch herausgegeben und vom Verlag capybarabooks veröffentlicht. Die Texte und Fotos stellen nicht nur die verschiedenen Architekturstile vor, sondern gehen auch auf den historischen Kontext der Wohn- und Geschäftshäuser, Verwaltungs-, Industrie-, Sakral- und Kulturbauten ein. Die Herangehensweise ist chronologisch: Gezeigt werden Gebäude aus dem 18. Jahrhundert bis heute, vom Turm des Berwart-Schlosses zur Cité des Sciences, von Al Esch zu den Nonnewisen, vom Friedhof Sankt Joseph zum Café Pitcher. Der Führer beschreibt die Entwicklung der Stadt Esch und ihres Kulturerbes nicht nur aus der Perspektive der Kunst-, Architektur- und Urbanismusgeschichte, sondern auch aus jener der Sozial- und Industriegeschichte.


 De Maart
De Maart


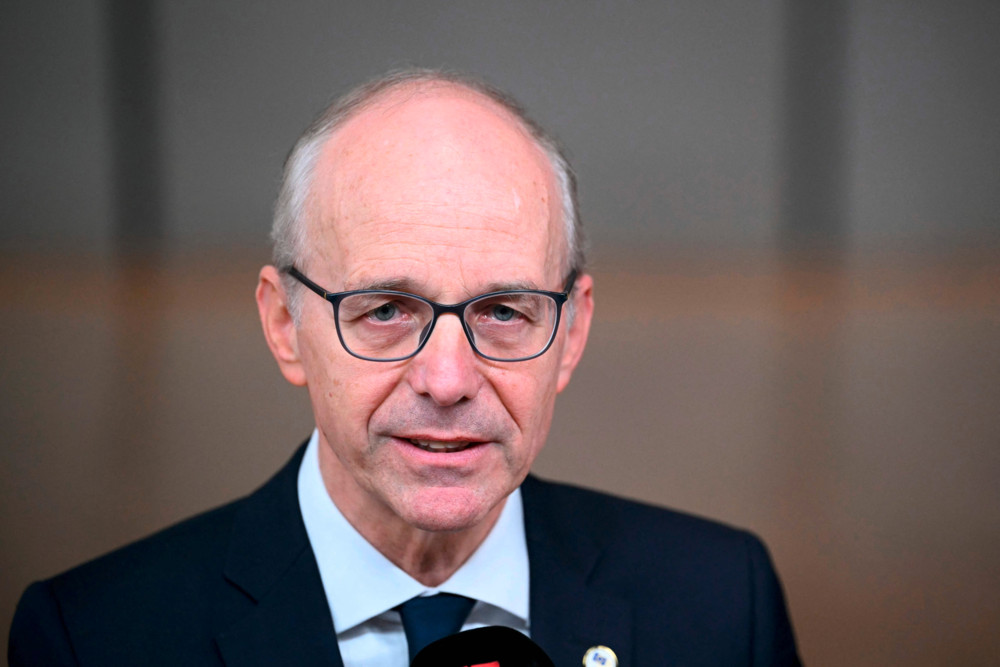

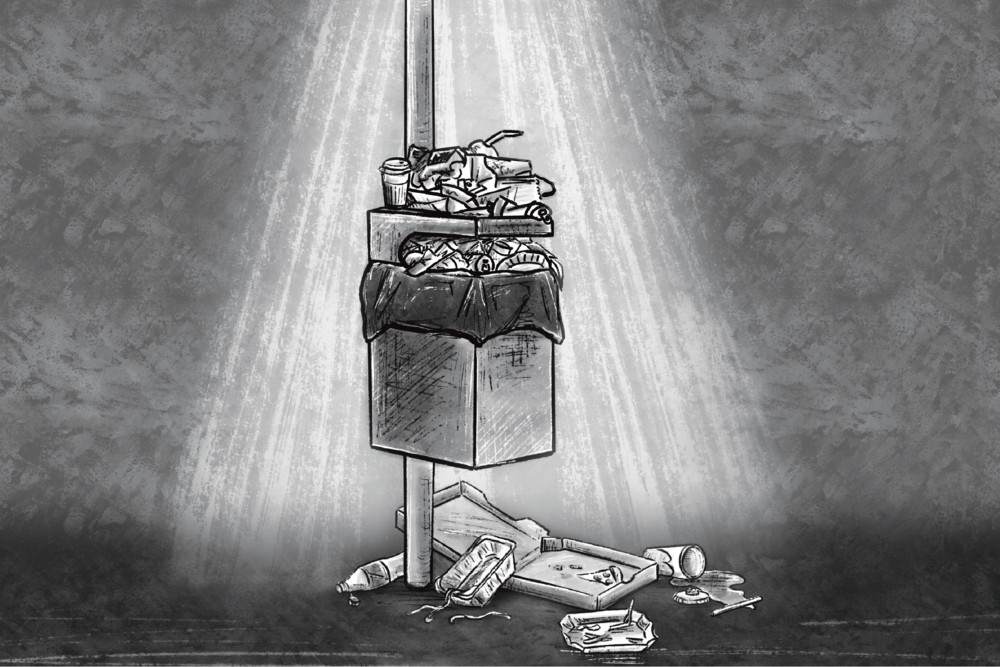


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können