Seit 2024 wird der internationale Tag des immateriellen Kulturerbes jährlich am 17. Oktober gefeiert. Zu diesem Anlass wurden am Freitag im Kulturministerium fünf Elemente zum Inventar des „Immateriellt Kulturiewen zu Lëtzebuerg“ (IKI) hinzugefügt: „Kënnbakesteeën“, „Fäsche maachen“, „Louschläissen“, „d’Kultur vun de Bongerten“ und „Liichte goen“.
Die „Kënnbakesteeën“ gehen laut Kulturminister Eric Thill (DP) auf religiöse Opferrituale zurück: „Um den Tag von Sankt Antonius am 17. Januar oder an Valentinstag am 14. Februar werden Kinnbacken während der Kirmesmesse gesegnet und versteigert. Was früher unter der Leitung der Kirche stand, wird heute von Vereinen für den guten Zweck organisiert.“ „Fäsche maachen“ wiederum bezeichnet das Bündeln von dünnen Ästen, was das Ofenheizen erleichtern sollte.

Das „Louschläissen“ setzt sich aus den beiden Begriffen „Lou“ von Lohe und „schläissen“ zusammen. Letzteres bedeutet so viel wie schälen, während die Lohe allgemein das Gehölz oder in diesem Fall die Rinde der Eiche bezeichnet. „‚Louschäissen‘ bedeutet nichts anderes, als die Rinde von jungen Eichen zu entfernen“, erklärt Yves Krippel im Gespräch mit dem Tageblatt. Er ist stellvertretender Direktor beim „Naturpark Öewersauer“. Der Naturpark hat im Jahr 2023 gemeinsam mit dem „Syndicat d’initiative Kiischpelt“, dem „Lycée technique agricole“ und der Naturverwaltung den Antrag gestellt, „Louschläissen“ in das immaterielle Kulturerbe aufzunehmen. „Es war uns wichtig, dass dieses Wissen nicht verloren geht“, sagt Krippel, „zumal die Zahl derjenigen, die das Handwerk noch beherrschen, ständig zurückgeht.“
Jahrhundertealtes Handwerk
Sowohl das Wissen als auch die Werkzeuge seien von einer Generation zur nächsten weitergeben worden, erklärt Krippel. Besonders die Wälder im Norden Luxemburgs waren von der Lohewirtschaft geprägt. „Im Winter wurde alles entfernt, was keine Eichen waren. Im Frühling, wenn der Saft nach oben in die Bäume drang, wurde mit dem Schälen begonnen.“ Dafür wurden die Zweige mit einer „Kromm“ entfernt und die Rinde auf Kopfhöhe angeschnitten. Die Rinde wurde längs angerissen und die junge Eiche wurde so gefällt, dass sie am Baumstamm hängen blieb. Am anderen Ende abgestützt, konnte sie auf die Art über dem Boden geschält werden. Dafür wurde die Rinde mit dem „Louschlëssel“, auch Lohlöffel genannt, abgetragen. Nach dem eigentlichen „Louschläissen“ wurde das verbleibende Holz abgebrannt. „Die Asche wurde auf der Fläche als Dünger verteilt und danach wurde meistens Hafer oder Wildkorn gepflanzt, bis die Eichen nach 15 bis 20 Jahren wieder die richtige Größe für die Lohegewinnung erreicht hatten“, erklärt Krippel weiter.

Die Eichenrinde ist reich an Tanninen, das heißt pflanzlichen Gerbstoffen. Früher wurde die Rinde nach dem Abschälen getrocknet und gemahlen und anschließend von Gerbern in der Lederverarbeitung verwendet. Wiltz war ein wichtiger Standort für die Lederproduktion. Die Gerberlohe wurde in ganz Mitteleuropa erwirtschaftet. Spuren davon lassen sich noch heute in der Namensgebung von Ortschaften und Wäldern finden, wie zum Beispiel die „Louheck“ im Ösling. Krippel erzählt, dass die Lohegewinnung dort ihren Höhepunkt in der Mitte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erreichte. „Bis andere Gerbstoffe von Übersee importiert oder synthetische Stoffe hergestellt wurden. Ab dann wurde die Lohe nicht mehr gebraucht.“ Heutzutage wird das „Louschläissen“ nur noch von einem Dutzend Menschen ausgeübt und die Lohe landet vor allem in Kosmetikprodukten oder Zuckerbonbons.
„Immateriellt Kulturiewen zu Lëtzebuerg“
Das nationale Inventar wurde am 26. Juni 2008 geschaffen und seitdem wurden 21 kulturelle immaterielle Besonderheiten auf der Liste vermerkt. Den Anfang machten damals u.a. die „Schueberfouer mam Hämmelsmarsch“ und die „Emaischen“. Zum immateriellen Kulturerbe zählen beispielsweise Praktiken und Kenntnisse von Gemeinschaften oder Einzelpersonen, deren Erhaltung von nationalem öffentlichen Interesse ist. Die genauen Kriterien wurden in der Unesco-Konvention von 2003 festgelegt. „Luxemburg war eines der ersten Länder, die diese Konvention ratifiziert haben“, sagte Kulturminister Eric Thill am Freitag in seiner Begrüßungsrede. „Eines der wichtigsten Kriterien für die Definition eines immateriellen Kulturerben ist, dass die Anerkennung von den Menschen vor Ort ausgeht und nicht vom Staat oder von Experten.“


 De Maart
De Maart



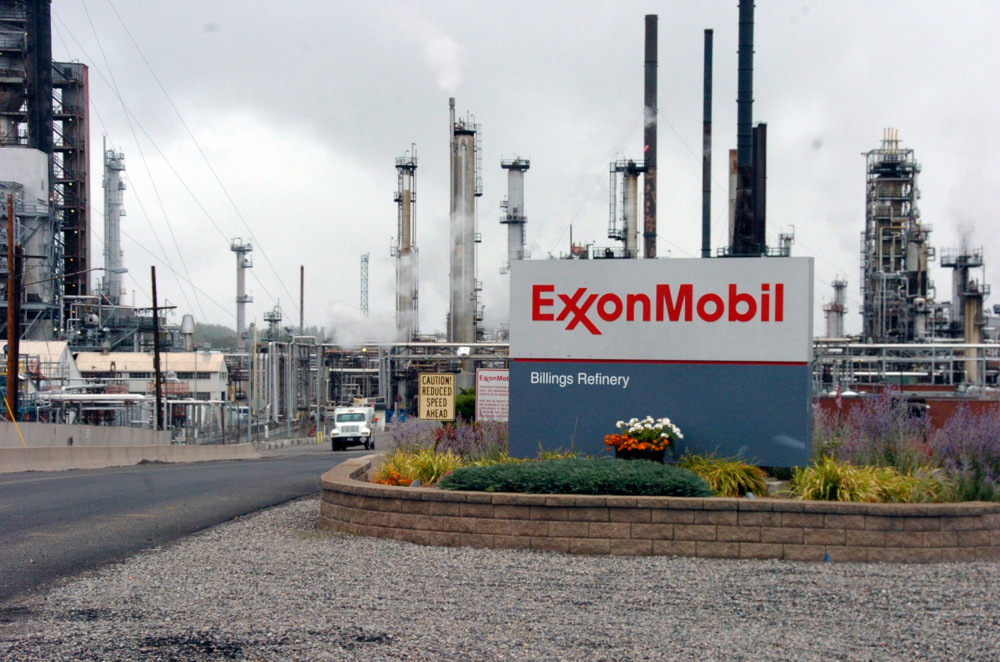




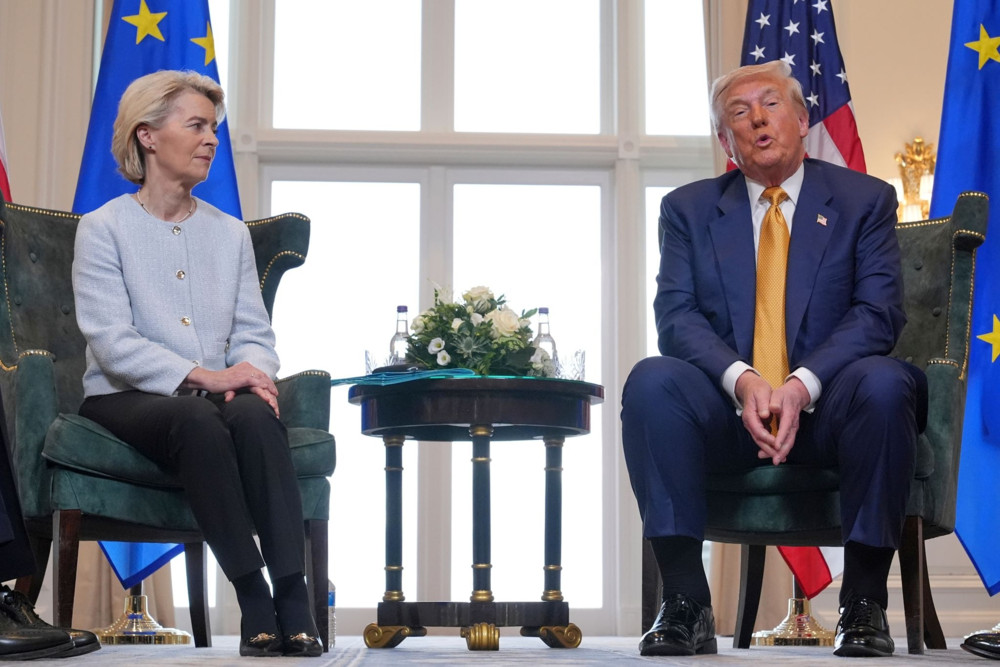
Onkel Josy hatte sich geschämt damals und geweint als die Idéal in Wiltz 61 dicht gemacht hat.