Léon Marx
Große Worte hatte Premierminister Jean-Claude Juncker am 31. Juni 1997 gesprochen, als Hochofen B in Belval ausgeblasen wurde. Es könne „nicht sein, dass in der Landschaft des Minette die Spuren dessen verschwinden, was unser Land groß gemacht hat.“ Und dafür könne der Hochofen „selbstverständlich auch nicht abgerissen werden.“
Die Worte des Premierministers sind längst verhallt. Und von Hochofen B rieselt seit mittlerweile 13 Jahren still und leise der Rost. Nicht besser ergeht es Hochofen A, dessen Innenausmauerung die Arbed noch komplett erneuert hatte, bevor die Entscheidung fiel, in Luxemburg ganz auf Elektrostahl umzusteigen.
Die Geschichte von Esch-Belval ist bislang vor allem die der Halbherzigkeiten und der leeren Versprechen. Bereits im Jahr vier nach dem Ausblasen zeigten sich deutliche Schäden. Dass einem ein kalter Hochofen schnell unter den Fingern wegrostet, diese schmerzvolle (und teure) Erfahrung hatte man kurz zuvor erst im benachbarten Völklingen gemacht. Und das, obwohl dort von Anfang an ein klares Konzept bestand und die Konsolidierung kurz nach dem Ende der industriellen Nutzung begann.
In Luxemburg fehlte es, und fehlt es offenbar noch immer, genau daran. Bereits 1998 bemerkte der Historiker Michel Pauly in einem Forum-Artikel, einen Hochofen zu erhalten, habe „nur Sinn, wenn man die gesamte Funktionsweise einer Stahlhütte erklären kann“.
Positiver Ansatz unter Erna Hennicot
Die damalige Kulturministerin, Erna Hennicot-Schoepges, schien das ähnlich zu sehen. Jedenfalls wurde damals eine Arbeitsgruppe geschaffen, die unter Leitung von Guy Linster ein Konzept erarbeiten sollte, um die beiden Hochöfen zu erhalten und in ihren historischen, industriellen und sozialen Kontext zu stellen.
Gewissermaßen zum Beweis dafür, dass sie es ernst meint, lässt die Regierung am 18. Juni 2000 die beiden Hochöfen auf die Liste der erhaltenswerten Kulturgüter setzen, und zwar zusammen mit den „installations annexes“, wie es nachdrücklich im Text heißt.Mehr dazu in der Mittwoch-Ausgabe des Tageblatt
Eine solche Einschreibung bedeutet im Regelfall, dass der Besitzer das Gebäude in seiner bestehenden Form erhalten muss. Doch bei sich selbst legt der Staat, wie so oft, andere Maßstäbe an.
Oder wie anders lässt sich erklären, dass der „Fonds Belval“ danach zwei Varianten ausarbeitet: eine, die die größtmögliche Erhaltung der existierenden Strukturen vorsieht, und eine, bei der lediglich die Silhouette der beiden Hochöfen erhalten bleibt.
Die Regierung kann sich nicht entscheiden und optiert am Ende für eine „Zwischenvariante“. Wie die aussehen soll, bleibt bis heute in vielen Punkten unklar. Auch ein im September 2009 deponierter Gesetzentwurf bringt keine Antwort. Das findet nicht nur der Staatsrat, der den Text regelrecht auseinandernimmt und die Autoren in seinem Gutachten mit kritischen Fragen überhäuft.
Das finden auch die „Amicale des hauts-founeaux“ und die lokale Sektion des „Mouvement écologique“, mit deren Ideen sich auch der Historiker Denis Scuto verbunden fühlt. „Architektonische oder industrielle Zeugen zerstört man nicht nur, indem man sie abreißt, sondern auch dadurch, dass man sie vor sich hin vegetieren lässt“, hatte er im Jahr 2001 in einem Land-Beitrag notiert. Und damit an die Bedenken von Michel Pauly drei Jahre zuvor angeknüpft.
Geholfen haben die Kritiken indes nicht. Im Gegenteil. Nach den letzten Anmerkungen von „Amicale des hauts-fourneaux“ und „Mouvement écologique“ aufgrund des staatsrätlichen Gutachtens zum Gesetzesprojekt 6065 über die Konsolidierung der beiden Hochöfen und die Schaffung des Zentrums für Industriekultur amputiert die Regierung jetzt ihr eigenes, gerade mal acht Monate altes Gesetz auf völlig unverantwortliche Art und Weise.
Abschied vom Gesamtkonzept
Das Zentrum für Industriekultur (Kostenpunkt 14 Millionen Euro) soll zunächst nicht gebaut werden. Einzig die 25 Millionen, die für die Instandsetzung der beiden Hochöfen im Gesetz vorgesehen waren, sollen nun tatsächlich fließen. Weil sich die beiden Hochöfen trotz der seit 2003 laufenden Arbeiten in einem derart schlechten Zustand befinden, dass aktuell nicht mehr von einer Wiederaufwertung, sondern von einer „sécurisation et stabilisation“ gesprochen werden muss (Exposé des motifs).
„Hors service depuis des années maintenant et sujets aux intempéries, les hauts-fourneaux de Belval se sont dégradés avec le temps, créant une source de dangers. Avant de pouvoir procéder à leur mise en valeur, il a donc été indispensable d’analyser l’état des lieux et de définir des mesures d’urgence afin d’écarter tous les risques de sécurité“, heißt es da weiter.
Im Klartext und frei nach Premierminister Jean-Claude Juncker: Die Hochöfen werden selbstverständlich nicht abgerissen. Sie werden nach 13 Jahren des Streitens und Studierens in ultimo davor bewahrt, aus Altersschwäche zusammenzubrechen.
Und dass „das Erhalten eines Hochofens nur dann wirklich einen Sinn hat, wenn man die gesamte Funktionsweise einer Stahlhütte erklären kann“, von dieser Idee hat man sich ganz verabschiedet. Mit dem Ergebnis, dass für spätere Generationen auf Belval nicht mehr als eine postmoderne Skulptur bleiben wird.

 De Maart
De Maart






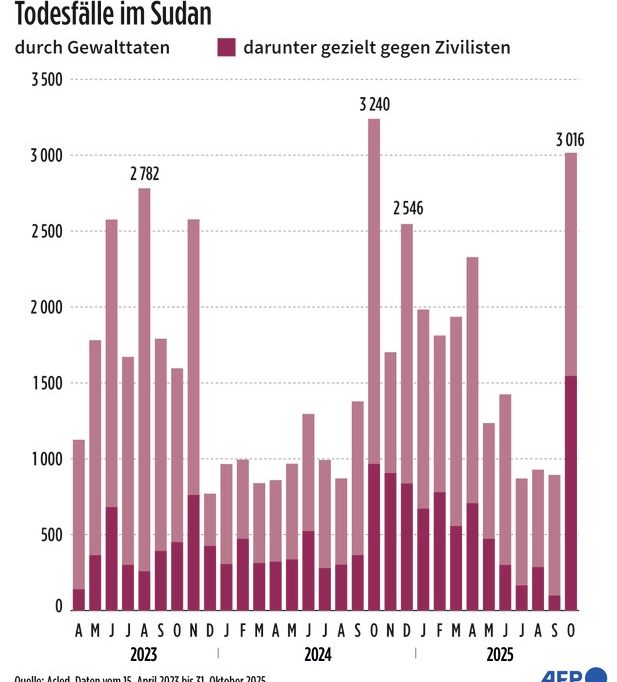
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können