Heike Bucher
ESCH – „Die Kinder, die zu uns kommen, sind alle traumatisiert, wobei der Grad des Traumas unterschiedlich sein kann“, sagt Guy Aeckerlé. Seit März 2004 leitet er das Foyer Sainte-Elisabeth in der rue des Franciscains, ein Heim für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Träger des Hauses ist die „Elisabeth“, ein Verbund sozialer Einrichtungen, der aus den Werken der Kongregation der Schwestern der heiligen Elisabeth entstanden ist, doch Kruzifixe sucht man vergebens. „Hier muss auch keiner die Messe besuchen“, meint Aeckerlé, „wer den Kontakt zur Kirche sucht, kann ihn haben, egal, zu welcher Konfession.“
Zurzeit wohnen 41 Jungen und Mädchen dort, verteilt auf fünf Gruppen. Eine Säuglingsgruppe, drei altersabhängige Kindergruppen und eine für junge Erwachsene sind in vier verschiedenen Gebäuden untergebracht. Das jüngste Kind ist ein paar Monate alt, das älteste 23.
„Wenn die Kinder zu uns kommen, sind sie vielen Lernprozessen ausgesetzt. Sie müssen ihr Trauma verarbeiten und lernen, in einer Gruppe zu leben. Das Modell, in dem wir hier leben, steht ja ihrem gewohnten Familienmodell diametral gegenüber. Hinzu kommt, dass die meisten Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen uns Erwachsenen misstrauen. Es ist ein langer Prozess, Vertrauen herzustellen“, erklärt Aeckerlé. Für die traumatischen Erfahrungen, die Aeckerlé meint, gibt es auch andere Worte: Misshandlung, soziale oder emotionale Verwahrlosung, sexueller Missbrauch.
Langer Leidensweg
Schon lange sind es keine Waisenkinder mehr, die in Heimen untergebracht sind, sondern Kinder mit solchen Extremerlebnissen. Für viele Betroffene ist der Weg ins Kinderheim lang. Bevor nämlich Erzieher, Lehrer oder Nachbarn merken, dass ein Kind Probleme hat, muss sein Verhalten auffällig werden. „In Luxemburg ist das soziale Netz aber sehr eng gestrickt. Die Leute achten vielleicht mehr aufeinander als in größeren Ländern, deshalb geht es hier in der Regel schneller, bis ein richterlicher Beschluss vorliegt“, weiß Aeckerlé. Kollegen aus Deutschland hätten ihn schon um diese Zustände beneidet, weil diesbezügliche Entscheidungsfindungen im Nachbarland oft länger brauchen.
Hass und Wut
Ziel der Unterbringung von Kindern im Foyer ist zweierlei: Im Vordergrund steht der unmittelbare Schutz der Minderjährigen, indem sie aus ihrer gefährdenden Situation herausgeholt werden. Doch dann geht es darum, die Kinder zurückzuführen in einen lebenswerten Alltag ohne allzu viele Aggressionen. „Aber zuerst müssen wir den Hass und die Wut aushalten können, die viele Kinder anfangs empfinden, wenn sie hier sind“, sagt Aeckerlé. Deshalb werden sie nicht nur durch die beim Foyer beschäftigten Psychologen, sondern auch durch Therapeuten anderer Einrichtungen betreut.
Wie erfolgreich diese Maßnahmen allerdings sind, hat in erster Linie etwas mit der Einstellung der Eltern zum Heimaufenthalt ihrer Kinder zu tun. „Da gibt es sehr unterschiedliche Eltern“, meint Aeckerlé. Am einfachsten sei es mit denen, die sich kooperativ und einsichtig zeigen. Und die bereit seien, ihre Lebenssituationen zu verändern, um irgendwann wieder für das Kind sorgen zu können. Daneben stehen Eltern, die wenig bis überhaupt kein Interesse daran haben, ihren Kindern wieder ein Zuhause zu bieten, sondern sich durchaus zufrieden mit der Situation zeigen.
„Es gibt aber auch welche, die gegen uns arbeiten und auf rechtlichem Wege versuchen, ihr Kind zurückzubekommen“, erzählt Aeckerlé. Das werfe die Kinder meist in schwere Loyalitätskonflikte. Denn egal wie schlimm die häusliche Situation auch gewesen sein mag, die Liebe zu den Eltern ist meist ungebrochen.
Ob die jahrelange Heimunterbringung angemessen sei, mag Aeckerlé nicht entscheiden. Er selbst zöge die Betreuung in einer Pflegefamilie vor, allein wegen der familiären Erfahrungen, die ein Kind machen kann. „Aber da gehen die Meinungen auseinander“, meint er. In erster Linie gehe es doch darum, Menschen aufzufangen, die sonst niemand auffängt.

 De Maart
De Maart




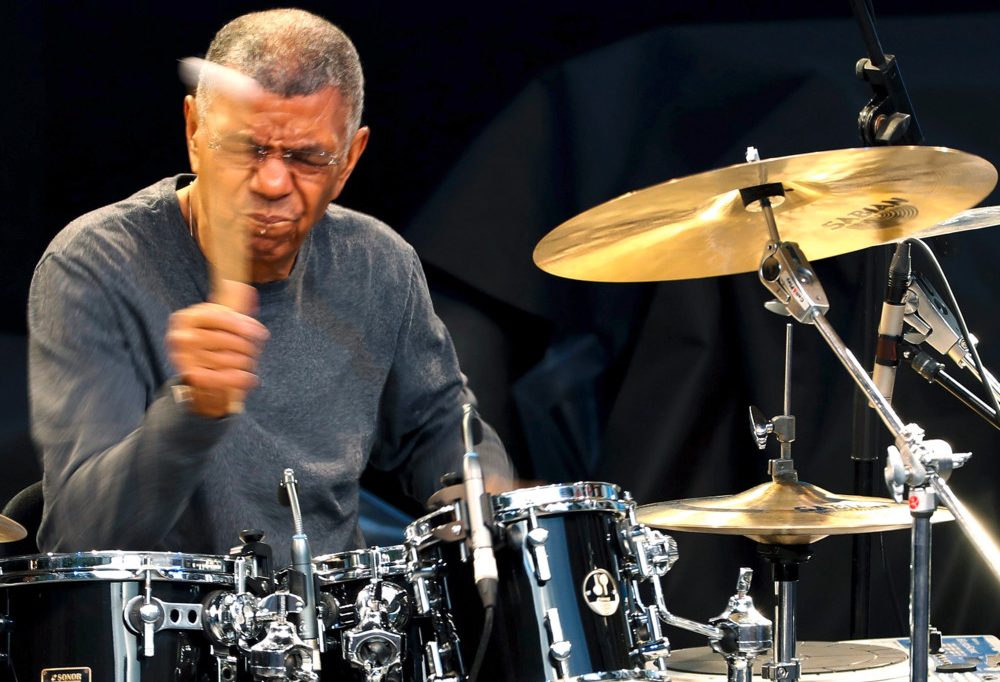


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können