Es handelt sich um sechs Ärzte, welche die dreijährige Stéphanie behandelten, die am 15. Juli 2005 in Düdelingen von einem Auto angefahren und mit einem Hirn-Trauma in die Notaufnahme des CHL eingeliefert wurde. Sie verstarb vier Tage später in der Brüsseler Uni-Klinik „Saint-Luc“ an dem sogenannten „Propofol-Syndrom“.
Am Dienstag gab ein beschuldigter Arzt an, das PRIS (Propofol-Infusions-Syndrom) gekannt zu haben. Damit entschuldigte er sich quasi und erklärte, beim heutigen Wissensstand wäre dieser tragische Tod nicht passiert. Am Mittwoch war es der Narkosearzt, der das Kind von Anfang an behandelte, der sich über die damaligen Informationsdefizite des Gesundheitsministeriums beklagte. Nach nach dieser Affäre seien die Behörden plötzlich wach geworden, um heute die Mailboxen der Ärzte täglich mit allen möglichen Hinweisen zuzumüllen.
Es war dann der Anwalt der fünf Krankenpflegerinnen, Me Urbany, der vom Narkosearzt Marc S. wissen wollte, ob er seine im Vorfeld getätigten Aussagen aufrechterhalten möchte, dass das weibliche Personal sogenannte „Bolus“, eine Beschleunigung des Infusionsflusses des Diprivan, ohne medizinischen Hinweis tätigte.
Gegenseitige Schuldzuweisungen?
Auf die Antwort, er habe in dieser Angelegenheit nicht Ankläger spielen wollen, handelte der Arzt sich die von Me Urbany mit sichtlicher Genugtuung begleitete Bemerkung der Richterin ein, seine Aussagen hätten sehr wohl die Entscheidung der Staatsanwaltschaft beeinflusst, die Krankenpflegerinnen vor Gericht zu zitieren.
Der Verteidiger konfrontierte dann den Narkosearzt mit einer weiteren seiner Aussagen vor dem Untersuchungsrichter, er habe sich schockiert gezeigt über die vielen Infusionsbeschleuniger, die während der ersten Nacht der kleinen Patientin verabreicht wurden, ohne aber seiner medizinischen Ablösung Anweisungen zu geben, diese Praxis einzustellen.
Es ging dann darum, dass am Sonntag, als der Narkosearzt seinen Dienst wieder angetreten hatte, die Dosis permanent höher war (zwischen 7 und 7,5) als vom Mediziner schriftlich festgehalten (6), der vor Gericht bestätigte, dass er von der Krankenpflegerin im Nachhinein informiert wurde, diese jedoch behauptet, dass sie ihn vorab um Erlaubnis gefragt hatte.
Unterschiedliche Auffassungen
Interessant war auch die Frage von Me Urbany, ob post mortem Änderungen an der medizinischen Akte der kleinen Patientin vorgenommen wurden, auf die der Narkosearzt – darauf hinweisend, er könne nur für sich sprechen – antwortete, er habe lediglich seine eigenen Notizen zur diskutierten IRM-Untersuchung vervollständigt.
Me Moyse, der den Kinderneurologen Christian N. vertritt, wollte von Marc S. wissen, warum er erst nach dem Tod des Kindes die Differenzen mit seinem Mandanten zur Sprache brachte und daraufhin auch noch die Patientenakte änderte. Der Narkosearzt wies darauf hin, dass unterschiedliche Auffassungen unter Ärzten nicht ungewöhnlich sind und er sicher nicht seinem Kollegen habe schaden wollen, was seinen Aussagen vor Gericht zu entnehmen sei.
Tragik
Es war dann die beschuldigte Kinderärztin Carola de B., die auf sehr einfühlsame Art und Weise auf die Tragik für jeden Arzt einging, wenn er bei einem Patienten, und hier besonders bei einem Kind, den Kampf gegen den Tod verliert. Sie blieb bei ihrer initialen Aussage, das Medikament Diprivan überhaupt nicht gekannt zu haben, da sie bei der Sedierung ihrer Patienten gewöhnlich nicht eingebunden ist.
Nach nur fünf Minuten und nachdem keine der anwesenden Parteien eine Frage an die Beschuldigte stellte, was die Frage aufwarf, warum diese Frau überhaupt in die öffentliche Verhandlung zitiert wurde, war es der Neurologe Christian N., der die ersten Diagnosen bei der kleinen Stéphanie ansprach, bei denen von einer lebensbedrohenden Situation ausgegangen wurde. Er habe das Mittel Diprivan lediglich durch seine allgemeine Bildung gekannt und habe keinerlei Kompetenzen bei seiner Anwendung.
Die Verhandlung wird in der kommenden Woche fortgesetzt.

 De Maart
De Maart



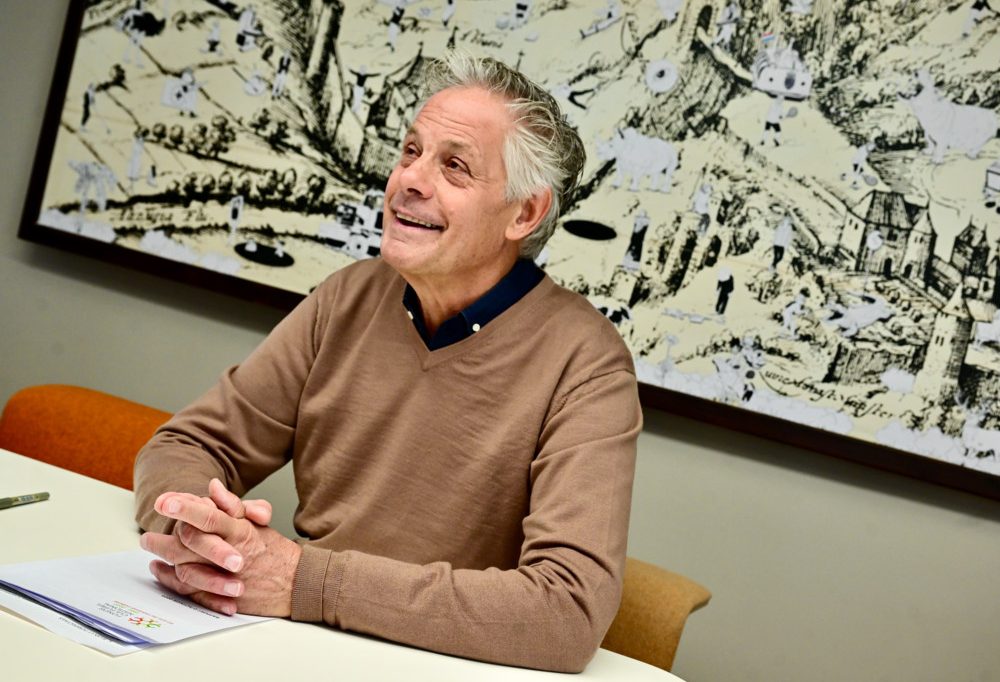





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können