Ab diesem Semester gibt es an der Universität Luxemburg ein Master-Studium für Architektur. Wir unterhielten uns mit Florian Hertweck, dem Direktor des Lehrgangs, über den Studiengang und über den Anspruch der Architektur heute.

Tageblatt: Herr Hertweck, was ist das Ziel des neuen Master-Studiengangs?
Florian Hertweck: Erst mal geht es natürlich darum, operative Architekten auszubilden. Genauso geht es aber auch darum, keine reinen Bauzeichner auszubilden, sondern kritisch denkende Menschen, die die großen gesellschaftlichen, sozioökologischen Fragen unserer Zeit verstehen und die Kompetenz entwickeln, darauf architektonische und städtebauliche Antworten zu entwickeln. Das ist der Anspruch des Masters.
Die Arbeit des Architekten ist also weit mehr als „nur“ bauen?
Architektur war immer viel mehr. Natürlich beherbergt eine Architektur erst mal Menschen, keine Frage, aber Architektur kann man nie losgelöst von sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Begebenheiten betrachten. Architektur ist nun mal, anders als Kunst, auch ein Gebrauchsgegenstand, sie hat immer diese Doppelfunktion. Einerseits ist sie natürlich Kunst, eine autonome Disziplin, mit einer eigenen Kultur, Geschichte und Theorie, andererseits muss Architektur auch funktionieren.
Können Sie konkreter werden?
Wenn ich z.B. eine Schule entwerfe, reicht es nicht, nur ein Gebäude zu designen. Es geht um pädagogische Fragen: Wie wird heute in der Schule gelernt? Wenn ich ein Universitätsgebäude entwickele, geht es darum: Wie forscht und arbeitet man heute, wie tauscht man sich aus? Wenn ich z.B. sage, eine Universität hat eine horizontale Struktur, wie übersetze ich das in Architektur?
Und die sozioökologischen Fragen?
Nun, das sind heute Fragen wie Migration, Alterung der Gesellschaft, Wohnungsnot, Gentrifzierung. Es interessiert uns nicht nur das Objekt – das Haus –, sondern auch das Verständnis von der Stadt. Es geht um einen größeren Maßstab.
 Auf diese Fragen gibt es je nach politischer Sichtweise verschiedene Antworten, was bedeutet, der Architekt ist de facto politisch engagiert?
Auf diese Fragen gibt es je nach politischer Sichtweise verschiedene Antworten, was bedeutet, der Architekt ist de facto politisch engagiert?
Genau. Ein Architekt muss heute auch ein politisch denkender und handelnder Mensch sein. Ich plädiere dafür, dass sich Architekten mehr in die großen sozioökologischen Debatten einbringen. Diese Fragen betreffen Architektur vermehrt. Wir können uns nicht auf das Design von Häusern zurückziehen. Wir müssen auf die Gesellschaft zugehen und auch wieder Debatten anstoßen, versuchen Antworten zu finden und die auch breit kommunizieren. Es bringt nichts, wenn wir solche Debatten nur in kleinen geschlossenen Kreisen ausdiskutieren. Auch das ist ein Anspruch dieses Master-Programms.
Wer Master sagt, denkt an Forschung. Was erforschen Sie?
Für uns ist beides eng miteinander verwoben. Man muss dazu sagen, dass die Architekturforschung ein relativ junges Feld ist. Momentan haben wir zwei Forschungsprojekte. Beim ersten Projekt geht es um die regionale und städtebauliche Entwicklung, von Luxemburg und der Großregion. Es gibt da brennende Fragen bezüglich der Mobilität, der Wohnungsnot, der Migration.
Das andere Projekt beschäftigt sich mit der Frage der Nutzung des Bodens. Wir können generell in Europa beobachten, aber verstärkt in Luxemburg, wie die Bodenpreise explodieren. Das ist kein neues Phänomen, das gab es schon bei den Römern, und ganz verstärkt seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Auch heute können wir wieder eine Explosion der Bodenspekulation beobachten. Das Thema interessiert uns aber nicht als Geografen, Soziologen oder Ökonomen; uns interessiert die Auswirkung auf die Architektur und wie sie darauf reagieren kann.
Und wie kann sie das?
Wir stehen noch sehr am Anfang der Forschung, aber es gibt generell zwei Antworten, eine räumliche und eine zeitliche. Die zeitliche Antwort wäre, dass der Boden im Besitz der öffentlichen Hand bleibt und verpachtet wird. Dadurch kann man verschiedene Nutzungen im Pachtvertrag festschreiben und vermehrt öffentliche und nicht nur rein privat-ökonomische Interessen berücksichtigen. Beim Wohnungsbau kann man die Finanzierung besser steuern.
Was verstehen Sie unter „räumlicher Antwort“?
Das ist die Kernkompetenz eines Architekten. Wie reduziere ich den „Footprint“, d.h. die Grundfläche des Gebäudes, um so viel wie möglich Boden der öffentlichen Nutzung zu überlassen. Das geht hin bis zu ganz radikalen Lösungen, wo der Boden zugänglich und frei ist, weil von öffentlichem Interesse.
Ein Haus bauen ist ja nicht billig, und Architekten stehen im Ruf, teuer zu sein. Können Architekten günstig und trotzdem schön bauen?
Ja, es gibt Beispiele heute in der Architektur, die ich nicht nachvollziehen kann. Das krasseste Beispiel ist die Fondation Louis Vuitton, wo riesige Budgets rausgeschleudert wurden und man weiß, dass der Architekt proportional zur Bausumme verdient.
 Geht es auch anders?
Geht es auch anders?
Ich glaube, das ist der Kernanspruch an Architekten unserer Zeit: Mit wenigen Mitteln etwas Tolles produzieren. Es ist schon schwierig, mit vielen Mitteln gut zu bauen, das kriegen schon nicht alle hin, aber mit wenigen Mitteln viel zu produzieren, etwas Sinnhaftes, das ist meiner Meinung nach die große Herausforderung. Das war übrigens das Thema meiner Antrittslesung hier an der Universität. Es ist meiner Meinung nach mehr als zeitgemäß, die Ressourcen zu reduzieren und etwas Hervorragendes zu entwickeln.
Wie sieht die Realität aus?
Ich denke, es gibt heute viele Architekten, die das hinkriegen, es muss nicht immer bedeuten, dass man unbedingt viel mehr Geld in die Hand nimmt, wenn man Architekten engagiert. Es gibt neue Formen von Wohnen, wie z.B. die Möglichkeit der Baugruppen, was viel rentabler und viel interessanter für die Eigennutzer ist.
Wie funktioniert das?
Eigennutzer schließen sich zusammen und schließen so den Entwickler aus. Als Bauherrengemeinschaft kaufen sie zusammen ein Grundstück und entwickeln darauf gemeinschaftlichen Wohnungsbau. Das ist extrem günstig, es gibt Beispiele aus Berlin, wo die Preise denen des sozialen Wohnungsbaus entsprechen, 1.500-1.700 Euro der Quadratmeter, inklusive Kauf des Grundstücks.
Ein Modell für Luxemburg?
Dieses Nachkriegsmodell „mein Haus, mein Garten, mein Auto, draußen in der suburbanen Suppe“ ist, besonders in Luxemburg, noch sehr präsent, weil Individualität sehr wichtig ist. Auch da sind wir als Architekten gefordert. Wir müssen Modelle entwickeln, die einerseits der Individualität Rechnung tragen und trotzdem das Wohnen in Gemeinschaften fördern.
Werden Ideen zu einem solchen Bauen im Master behandelt?
Natürlich, das Thema dieses ersten Semesters ist Architektur und Ökonomie, auch im Sinne von ökonomisch bauen. Es geht um die Frage, welche Auswirkungen die globalisierte Welt auf die Architektur und den Städtebau hat, gerade hier in Luxemburg. Wie können wir ökonomisch Städtebau betreiben, ohne in den trockenen Funktionalismus der 1960er Jahre zu verfallen? Wenn man ökonomisch bauen möchte, heißt das nicht, dass immer etwas Langweiliges dabei herauskommen muss.
 Was halten Sie vom neuen Belval?
Was halten Sie vom neuen Belval?
Es ist ja noch keine Stadt, leider.
Was fehlt?
Es ist meiner Meinung nach eine Frage von Strukturen. Diese sind viel zu groß. Ich will jetzt nicht alles schlechtreden, was ich aber sehr kritisieren würde, ist z.B. Folgendes: Eine der wichtigen Funktionen einer Stadt ist das Einkaufen, das Shoppen – obwohl ich kein Mensch bin, der gerne shoppen geht. Dann ist es schon fragwürdig, wenn die einzige Möglichkeit dazu eine Shopping Mall ist. In Luxemburg-Stadt ist das mittlerweile schrecklich geworden, da es dort fast nur noch internationale Ketten gibt. Luxemburg ist vielleicht dafür zu klein.
Im Ausland gibt es das noch …
Ja, in größeren Städten wie Paris, Berlin, München oder Brüssel gibt es noch lokale Läden mit lokalen Produktionen, also kleinteilige Strukturen. Hier muss ich, wenn ich nur ein Brot kaufen will, nicht in die Shopping Mall gehen. Alles ist zentralisiert, ich habe nicht das Gefühl, in einer Stadt zu sein. Es gibt hier nicht mal eine Bäckerei oder eine Fleischerei, keine kleinen Läden mit lokaler Produktion. Das gehört aber dazu, damit eine Stadt funktioniert. Es ist immer die Frage der Auswirkung von Einkaufszentren auf die Kernstadt. Das Problem ist, dass sich diese Malls normalerweise außerhalb der Wohngebiete befinden und meistens die Städte ausgedünnt haben.
Ist das immer so?
Es gibt auch Beispiele, wo sich die Shopping Mall ganz nah am Stadtrand befindet. Das kann einen positiven Effekt auf die Kernstadt haben, wenn das Gebiet für Fußgänger oder Fahrradfahrer erreichbar ist.
Wie z.B. das neue Einkaufszentrum in Differdingen.
Ja, aber es muss sich noch zeigen, wie es sich entwickelt. Was Belval betrifft, so gibt es noch keine Struktur, und es ist ja noch nicht alles fertig, es kommen neue Gebäude, neue Wohngebäude, es sollen ja auch Baugruppen hierhin kommen. Man muss abwarten. Ich will jetzt noch kein abschließendes Urteil fällen.
Sie sprachen von Städteplanung. Dazu gehört ja auch die Mobilität in den Städten. Ist das auch ein Thema für Sie?
Ganz klar, Mobilität hat uns immer interessiert. Keine Frage, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Architektur, zumindest vom Städtebau. Aber daran hängen andere Fragen, u.a. die des Wohnungsbaus. Aber es hängt auch mit ökonomischen Kriterien zusammen. Wenn ich z.B. das Modell des Einfamilienhauses draußen vor der Stadt weiter verfolge, dann ist es klar, dass ich mich nur mit einer individuellen Mobilität fortbewegen kann. In dem Fall ist es schwierig, öffentlichen Verkehr zu organisieren.
 Welche Antworten haben Architekten auf die Mobilitätsprobleme?
Welche Antworten haben Architekten auf die Mobilitätsprobleme?
Da gibt es viele stadtplanerische Modelle, z.B. dezentrale Konzentration, ein Modell, bei dem man versucht, die verschiedenen Zentren zu stärken und wobei man die öffentlichen Verkehrssysteme besser organisieren kann. Als Architekten müssen wir Wohnmodelle entwickeln, wo man mit anderen zusammen in einem größeren Gebäude wohnt, aber trotzdem das Gefühl von Privatheit hat. Ich muss nicht in der Pampa wohnen und mein Auto nehmen, um Brot kaufen zu gehen oder um zur Arbeit zu fahren. Es gibt viele Überlegungen dazu auch in Luxemburg, Stichwort Kreislaufwirtschaft, wobei man versucht, kürzere Wege zu schaffen.
Arbeiten zu Hause?
Als diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten in den neunziger Jahren aufkamen, vor allem Handy, aber auch Laptop, hat man gedacht, die Mobilität würde abnehmen. Da gab’s das schöne Bild: Ich sitze mit meinem Laptop irgendwo in den Schweizer Bergen an einem See und arbeite dort, und muss überhaupt nicht mehr in die Metropole. Das hat sich als Trugschluss erwiesen. Die Mobilität hat genauso in dem Maße zugenommen wie die Kommunikationsmöglichkeiten. Geschäfte werden immer noch mit Handschlag gemacht. Da ist der Einfluss der Architekten begrenzt.
Wo liegt das Problem?
Bei den Modellen, die ich angesprochen habe und die wir entwickeln wollen, brauchen wir auch die Auftraggeber, Investoren, die diese Modelle mittragen. Und auch die öffentliche Hand. Wir wollen diese Modelle ja auch mal testen. Und wir brauchen die Nutzer, die sich auf solche neue Modelle einlassen.
Wie ist denn Ihr Kontakt zur öffentlichen Hand?
Generell gibt es Kontakte zur Politik, aber wir sind ja erst am Anfang, wir müssen erst mal was vorzeigen können. Dann würde ich mir schon wünschen, dass die Politik auf unsere Produktion aufmerksam wird. Wir haben ja mal schon den Auftrag bekommen, den luxemburgischen Pavillon zur Biennale mit zu kuratieren, was ja eine tolle Sache und ein Vertrauensvorschuss von der Politik ist. Das kommt aber nicht vom Wohnungsbau-, sondern vom Kulturministerium.
Werden bei den sozioökologischen Fragen die Architekten überhaupt um ihre Meinung gefragt?
Die Architekten haben seit den 1970er Jahren an Macht verloren. Wenn man sich die Vorschläge zur Städteentwicklung aus der Zeit ansieht, sieht man, dass die Architekten immer den Lead hatten. Mittlerweile haben Landschaftsarchitekten und Spezialisten für ökologische Fragen mehr Einfluss. Wir müssen versuchen, wieder etwas davon zurückgewinnen, aber das können wir nur, wenn wir uns nicht auf das Design des Objektes reduzieren, und da sind wir beim Master-Programm angekommen. In Berlin, München, Paris oder Brüssel z.B. wird bei der Stadtentwicklung mehr auf Architekten gehört. Das ist hier in Luxemburg wahrscheinlich noch nicht so ausgeprägt, obwohl der OAI („Ordre des architectes et ingénierus-conseils“) und das Luca („Luxembourg Centre for Architecture“) sehr gute Arbeit leisten. Es liegt wohl daran, dass noch keine Forschung hier betrieben wurde. Da stehen wir jetzt in der Pflicht.
Was halten Sie vom Bild des Architekten in der Gesellschaft?
Gegenfrage: Gibt es das Bild des Architekten heute noch? Den klassischen Architektentyp, der sagt, wo es langgeht, gibt es nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Heute ist der Architekt eher Moderator zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Das ist aber kein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass in großen Stadtentwicklungsprojekten der Architekt den Lead übernehmen soll und dass er wieder vermehrt auf die Gesellschaft zugeht. Aber Demut tut uns ganz gut. Das sage ich ganz ernsthaft, und das ist auch Gegenstand eines meiner Bücher gewesen. Wir haben die Schnauze voll vom Typ des Stararchitekten, der bei bescheuerten Projekten viel Kohle rausschleudert und damit unseren Ruf versaut.
Sie haben eingangs Architektur auch als Kunst bezeichnet, das Künstlerische soll aber nicht zu teuer werden …
Der Schlüsselbegriff diesbezüglich ist „Angemessenheit“: Wir müssen heute angemessen sein. Ich finde, es ist heute unangemessen, bei Gebäuden aus rein ästhetischen Zwecken Geld zu vergeuden. Das finde ich vollkommen unzeitgemäß.
Viele Forschungsgebiete sind sehr spezialisiert, in der Physik z.B. gibt es Teilgebiete, von denen die meisten von uns noch nie etwas gehört haben. Ein Architekt im Gegensatz muss ein sehr breites Wissen besitzen: Er ist Städteplaner, Designer, Bauingenieur. Wie bekommt man alles unter einen Hut?
Es stimmt, wir sind eher Generalisten, und das ist in der Tat eine Herausforderung. Deshalb ist diese Moderatorenfunktion extrem wichtig. Und so ist der Studiengang sehr interdisziplinär angelegt. Das ist ja das Tolle hier an der Uni. Wir haben Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen, und unsere Architekten besuchen verschiedene Kurse. Wenn wir unsere Studenten z.B. zu den Tragwerksplanern schicken, geht es nicht darum, dass sie später statische Berechnungen machen können.
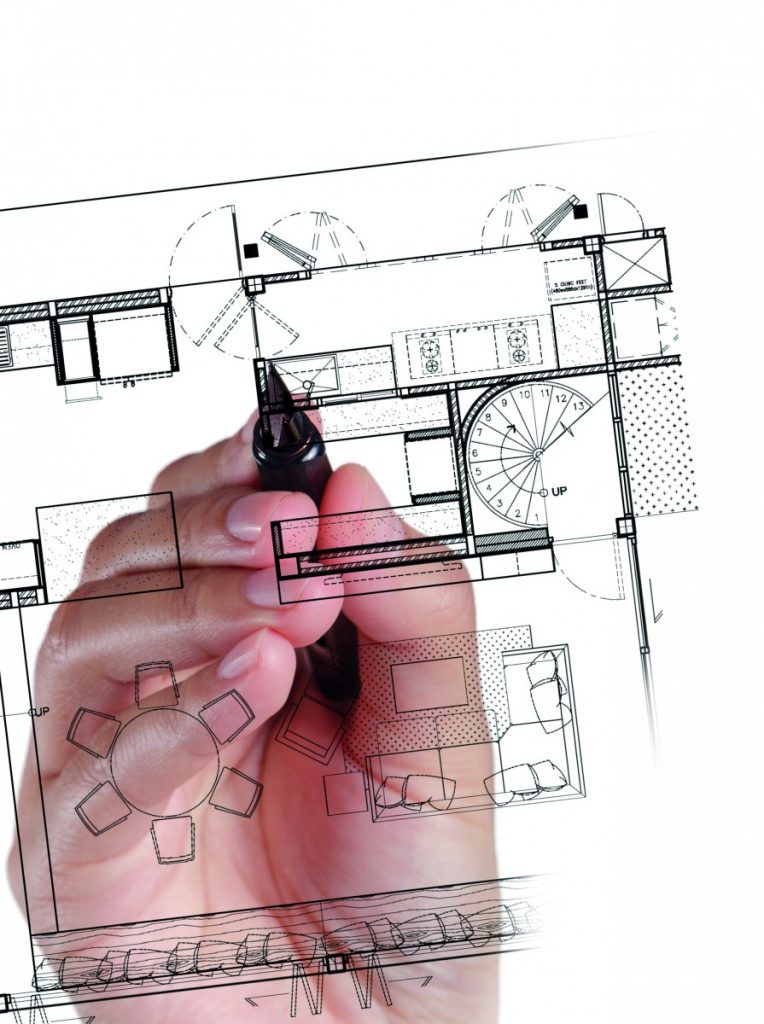 Sondern?
Sondern?
Sie müssen später mit den Statikern kommunizieren können, sie müssen seine Begriffe, seine Denkweise verstehen und sich intuitiv mit ihm austauschen können. Dadurch können wir den Studiengang öffnen für andere Bereiche. Aber am Ende bleiben wir Architekten.
Das Publikum hat manchmal den Eindruck, dass einige Architekten vor allem auf das Design achten. Aber es müssen immer Leute in den Gebäuden leben oder arbeiten. Wird dieser Zweck nicht manchmal aus den Augen verloren?
Generell habe ich eine Antipathie gegenüber zu viel Design. Kürzlich habe ich in einem Vortrag gesagt: Im Paradies gibt es keine Architektur, keine Kleidung, weil wir ja nackig draußen in der Natur leben. Die Hölle muss man sich im Gegenteil als Ort vorstellen, wo alles durchdesignt ist. Natürlich müssen wir am Ende ästhetische Objekte produzieren. Und natürlich schulen wir den ästhetischen Sinn unserer Studenten. Es geht ja nicht darum, hässliche Sachen zu bauen, aber Ästhetik ist nicht das oberste Ziel.
Also keinen Funktionalismus?
Das Thema meiner Antrittsvorlesung war „Für einen neuen Funktionalismus“. Ich habe gezeigt, dass das, was man heute unter Funktionalismus versteht, in eine Sackgasse geführt hat. Es lohnt sich aber, den Begriff neu zu besetzen, aber im Sinne eines sehr spielerischen Funktionalismus. Kürzlich wurde ich gefragt, was Architektur leisten muss, und ich antwortete: „Funktionieren“. Eine Teekanne bleibt immer noch eine Teekanne“, und so ist es auch mit Gebäuden. Architektur hört aber nicht bei der Funktionalität auf, diese kann auch die Zündung für ein Konzept sein.
Sie sind noch praktizierender Architekt?
Natürlich, ich fühle mich sogar in erster Linie als solcher. Ich war immer Verfechter davon, Theorie und Praxis zusammen zu denken. Für mich gibt es diese abstruse Trennung nicht, wo die einen nur nachdenken und die anderen nur bauen. Das ist für mich vollkommen obsolet. Die besten Architekten haben nicht nur virtuos gebaut, sondern waren auch intellektuelle, kritische Wesen. Ein Beispiel ist Rem Koolhaas, der einflussreichste Architekt der letzten drei bis vier Jahrzehnte, der ein unglaublich versierter Theoretiker war und die großen Fragen unserer Zeit abgearbeitet hat.
Eine Referenz also?
Die Architekturgeschichte ist ein toller Schatz, aus dem wir lernen können. Der Umgang mit Referenzen ist jedoch hoch komplex. Wir sollten einen kritischen Bezug dazu haben. Mies van der Rohe hat mal gesagt, wir sollten nicht jeden Montagmorgen die Architektur neu erfinden. Das stimmt. Aber aus der Geschichte lernen, bedeutet nicht, sich an einem Modell festbeißen. Wir sollten einen offenen, kritischen Umgang mit der Geschichte haben.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können