„Es gibt keine nachhaltige Entwicklung ohne eine Wirtschaft, die nachhaltig wächst“, zitiert Pierre Gramegna, der Präsident der Handelskammer, immer wieder die Regierungserklärung von Premierminister Jean-Claude Juncker.
„Die Unternehmen sind das Herzstück der nachhaltigen Entwicklung“, sagte auch Gramegnas Kollege Marc Wagener bei der Vorstellung der zehnten Ausgabe des Bulletin „Actualité et tendances“ der Handelskammer. „Die Wirtschaft backt den Kuchen, den es zu verteilen gilt“, erklärt er. Die Verteilung des Erwirtschafteten geschehe aber nicht automatisch gerecht. Hier sei es die Aufgabe der Sozialpolitik, einzugreifen. Und dazu benötige sie Mittel, um etwa Straßen zu bauen oder die gewünschte Familienpolitik zu betreiben. Diese Mittel erhalte sie über die Steuerzahlungen der Unternehmen und deren Mitarbeiter.
Nun entstehe jedoch ein weiteres Problem. Wenn die Ressourcen zu schnell verteilt würden, sogar wenn es sich um nachwachsende handele, sei dies auch nicht nachhaltig. Deshalb sei, so Wagener, die ökologische Dimension der dritte Pfeiler der nachhaltigen Entwicklung.
Nachhaltigkeit: Die drei Pfeiler
Bei allen drei Pfeilern erkennt die Handelskammer Tendenzen, die einer nachhaltigen Entwicklung im Wege stehen. Zum einen beklagt die Handelskammer das in ihren Augen zu schnelle Wachstum der Lohnkosten. Die Lohnkosten in Luxemburg, so Wagener, stiegen schneller als in anderen Ländern und das Land sei stark vom Export abhängig.
Eine Konsequenz des daraus resultierenden Verlustes an Wettbewerbsfähigkeit sei, dass Arbeiter durch Maschinen ersetzt würden, so Wagener. Doch die sinkende Konkurrenzfähigkeit, die die Handelskammer seit einiger Zeit in Luxemburg beobachte, sei nicht nur durch die Lohnkosten bedingt. „Es ist ein facettenreiches Problem“, so Wagener. Die Infrastruktur etwa sei auch ein Teil davon oder das „monolithische“ Wirtschaftsmodell Luxemburgs.
Ein Zahlenbeispiel: Die Mehrwertsteuer, die im Online-Handel anfiel, machte im Jahr 2010 knapp 4 Prozent der Einnahmen des Staates aus. Die „Taxe d’abonnement“ von Investmentfonds machte 6,2 Prozent aus. Die Gesellschaftssteuer, die der Bankensektor bezahlte, sorgte für rund ein Zehntel der Einnahmen. Genau wie Abgaben auf Treibstoff und Tabak, die von Ausländern gekauft wurden. Sie spülten 981,1 Millionen Euro in die Kasse des Staates. Geldquellen, so Wagener, die nicht nachhaltig seien, da nicht mit Sicherheit zu sagen sei, ob sie morgen noch sprudelten.
Einer von sieben unter der Armutsgrenze
In der Tat verzeichnet Luxemburg seit den 70er Jahren eine regelrechte Deindustrialisierung. Machte die Stahlbranche 1970 noch 28 Prozent der Wirtschaftskraft Luxemburgs aus, so waren es 2009 nur noch 2 Prozent. „Ein Land braucht eine Industrie“, sagt Wagener: „Die Forschung und Entwicklung, die wir an unseren Forschungsinstituten und unserer Uni machen, muss auch hierzulande umgesetzt werden“.
Dass der Staat sein Defizit immer weiter ausbaut, sieht Wagener ebenso kritisch. „Wenn wir mehr Geld ausgeben, als wir haben, ist das nicht nachhaltig“, sagt er. Das erworbene Reichtum müsse gespart werden, so Wagener. Auf der zweiten, der sozialen Stufe der nachhaltigen Entwicklung, sieht die Handelskammer vor allem ein Problem in einem „Demokratischen Defizit“.
In Luxemburg, erklärt Wagener, gebe es eine Diskrepanz zwischen jenen, die das Bruttoinlandsprodukt herstellen, und jenen, die wählen. Vor allem die über 150.000 Grenzgänger würden nicht in den Entscheidungsprozess mit einbezogen. Bei den letzten Wahlen in 2009 hätten die luxemburgischen Wähler, die nicht für den Staat arbeiten, nur 27,2 Prozent derer, die in Luxemburg leben und arbeiten – Grenzgänger eingeschlossen – ausgemacht, rechnet Wagener vor. Ergo sei die Wirtschaft unterrepräsentiert, folgert er.
Eine andere Tendenz des sozialen Pfeilers der nachhaltigen Entwicklung ist das zunehmende Armutsrisiko. Fast 15 Prozent der in Luxemburg lebenden Bürger gelten als arm, ihnen stehen weniger als 1.588 Euro im Monat zu Verfügung. Besonders Alleinerziehende sind betroffen. Dass das Armutsrisiko steige, obwohl das Problem und die Zielgruppe bekannt seien, ist für Wagener ein Indiz dafür, dass das System der sozialen Transfers Fehler hat. „Wir müssen zielgerichteter vorgehen“, sagt er.
Treibhausgase
Dritter Pfeiler der Nachhaltigkeit: Die Umwelt. Habe Luxemburg 1998 das Kyoto-Ziel noch erreicht, so Wagener, liege es jetzt weit darüber. Eine Entwicklung, die mit dem Aufkommen des Tanktourismus einhergehe. Luxemburg sei beim Ausstoß von Treibhausgasen fast überall im grünen Bereich, außer beim „Transport“.
„Luxemburg ist wie Frankfurt oder Brüssel: Klein, offen, mit dem Status einer Metropole“, so Wagener. Nur bei diesen könne die Belastung auf den Rest des Landes umgeschlagen werden.
Ambitionierte Ziele
Mittlerweile, so hält die Handelskammer fest, werde jedoch in die richtige Richtung gearbeitet: Die Regierung setze sich ambitionierte Ziele und gebe sich auch die Mittel, um diese zu erreichen.
Die Arbeiten im Bereich Öko-Technologie, in der Forschung und bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit etwa schätzt sie positiv ein. In Zukunft dürfe Luxemburg sich nicht mehr auf seine nationalen Vorteile wie das Bankgeheimnis verlassen, sondern müsse seine Stärken zu seinem Vorteil verwenden.

 De Maart
De Maart

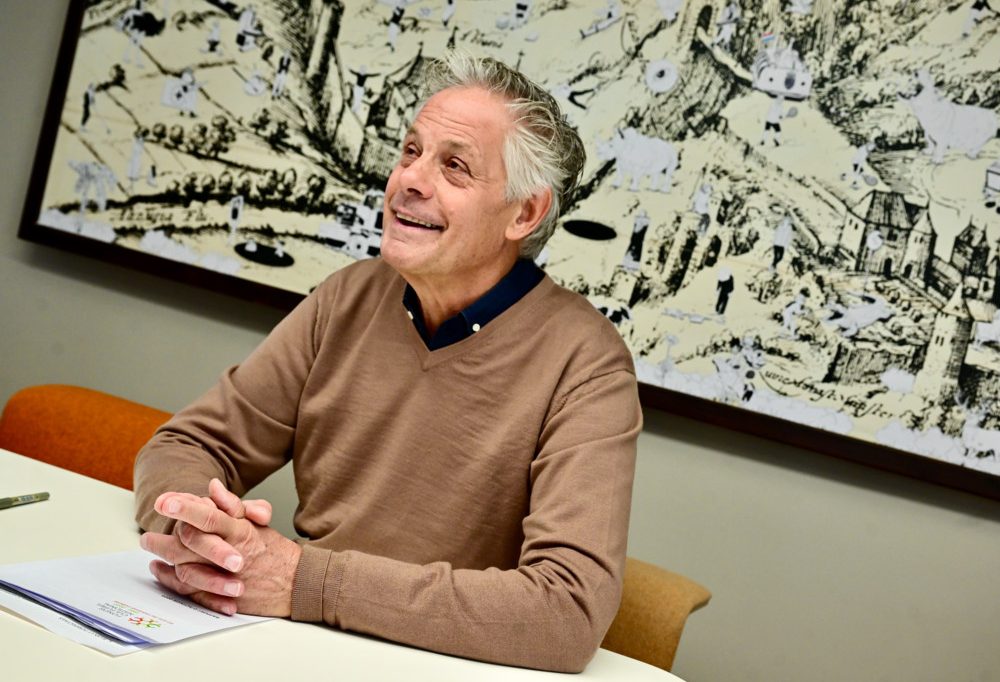





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können