Samantha Henry,
Montclair/USA
Sie und weitere unauffällige Paare von nebenan sollen russische Agenten sein, Mitglieder eines seit Jahren in den USA agierenden Spionagerings. Die Nachbarn sind entgeistert.
Geheimdienstexperten glauben einen langfristigen Plan Moskaus zu erkennen: Unter Decknamen im gutbürgerlichen Milieu angesiedelt sollten sich die „Illegalen“ demnach langsam und geduldig an Kontaktpersonen heranarbeiten und Informationen abschöpfen – nicht notwendigerweise waffentechnischer oder sicherheitspolitischer, sondern finanzieller, geschäftlicher oder technologischer Art.
Unauffällige Nachbarn mit gepflegtem Garten
„Das ist eine langfristige Investition eines Geheimdienstes, diese Personen dorthin zu führen, ihnen allgemeine Aufträge zuzuweisen und zu schauen, was sie heranschaffen können“, erklärt der Spionageabwehrexperte John Slattery.
„Sie sind zwar keine ausgebildeten Geheimdienstprofis, aber sie sind verfügbar und stehen auf Abruf für solche Aufträge bereit wie: Kannst du an dieser Besprechung teilnehmen? Kannst du auf jene Messe gehen? Kannst du diese Person ansprechen? Kannst du dich vielleicht an jener Universität einschreiben? Und dann können sie später diese Kontakte ausbauen.“ Zehn Verdächtigen wird Verabredung zur Agententätigkeit für eine fremde Macht vorgeworfen, einigen zudem Geldwäsche. Ein elfter, der auf Zypern gefasst wurde, soll ihnen über Jahre hinweg Geld übergeben haben.
Seit wann genau die Sache lief und was genau sie ihren Agentenführern lieferten, gab die Anklage nicht preis. Sie sollen nicht nur verschlüsselte Laptop-Netzwerke, sondern auch aus Agentenromanen und Hollywood-Filmen altbekannte Methoden benutzt haben wie unsichtbare Tinte oder „zufällige“ Begegnungen auf dem Bahnhof, bei denen klammheimlich zwei Taschen vertauscht werden.
Viele der Verdächtigen führten ein unauffälliges Leben im Vorort: Sie verabschiedeten ihre Kinder an der Bushaltestelle, waren stolz auf den gepflegten Rasen und die Blumenbeete, plauschten mit den Nachbarn und feierten am 4. Juli den amerikanischen Unabhängigkeitstag.
In Montclair im Bundesstaat New Jersey berichten Nachbarn der Frau, die sich Cynthia Murphy nannte, sie hätten bei ihr einen Akzent bemerkt. Danach gefragt, habe sie gesagt, sie stamme aus Belgien.
„Wir sind aus einer Generation, wo man sich vor der Roten Gefahr fürchtete, wo es 007 gab – all so was“, sagt Murphys schockierter Nachbar Alan Sokolow. „Ich kann mir das Mitte der 50er vorstellen. Aber heute, 2010, wirkt das eher komisch, mit der altmodischen Technik, die sie benutzt haben sollen.“ „Das kommt mir vor wie ein Alfred-Hitchcock-Film, mit dem ganzen Kram aus den 60ern“, sagt der Sohn der gleichfalls verdächtigen Journalistin Vicky Pelaez. „Das ist lächerlich.“
Eine junge Rothaarige namens Anna Chapman war in sozialen Netzwerken unterwegs und stellte über 90 Fotos von sich ein: Vor der Freiheitsstatue, im Ausland, in Schuluniform, in himmelblauer Spitzenkorsage mit Schmollmund und Schlafzimmerblick. Den Medien galt sie sogleich als Femme Fatale. Die 28-Jährige, die nahe der New Yorker Börse wohnte, präsentierte sich im Netz als Maklerin und Vermittlerin von Investitionen, die „innovative Hightech-Startups“ ins Geschäft bringen wolle. Ein Bekannter, ein Immobilienmakler, schildert sie als „nett, sehr professionell, freundlich“.
Verschroben, aber klug
Der Verdächtige Donald Heathfield arbeitete für eine Unternehmensberatung, lebte in der Universitätsstadt Cambridge und hatte Kontakt zu mehreren Organisationen, die sich mit Zukunftstechnologien befassen. „Er trieb sich mit den Futuristen herum“, sagt der emeritierte Professor William Halal.
Die beiden waren Geschäftspartner bei TechCast, einer Denkfabrik für Zukunftstechnologie, und gehörten einer Stiftung zur Wissenschaftsförderung an. Mikkail Semenko war in einem kleinen Reisebüro in Virginia angestellt, das im gleichen Gebäude liegt wie ein Rekrutierungsbüro des US-Militärs. Kollegen beschreiben ihn als umständlich und verschroben, aber klug. Er habe sich sehr für Sprachen, internationale Politik und fremde Kulturen interessiert, sagt einer. Er sei gern auf Empfänge gegangen, um Leute kennen zu lernen.

 De Maart
De Maart

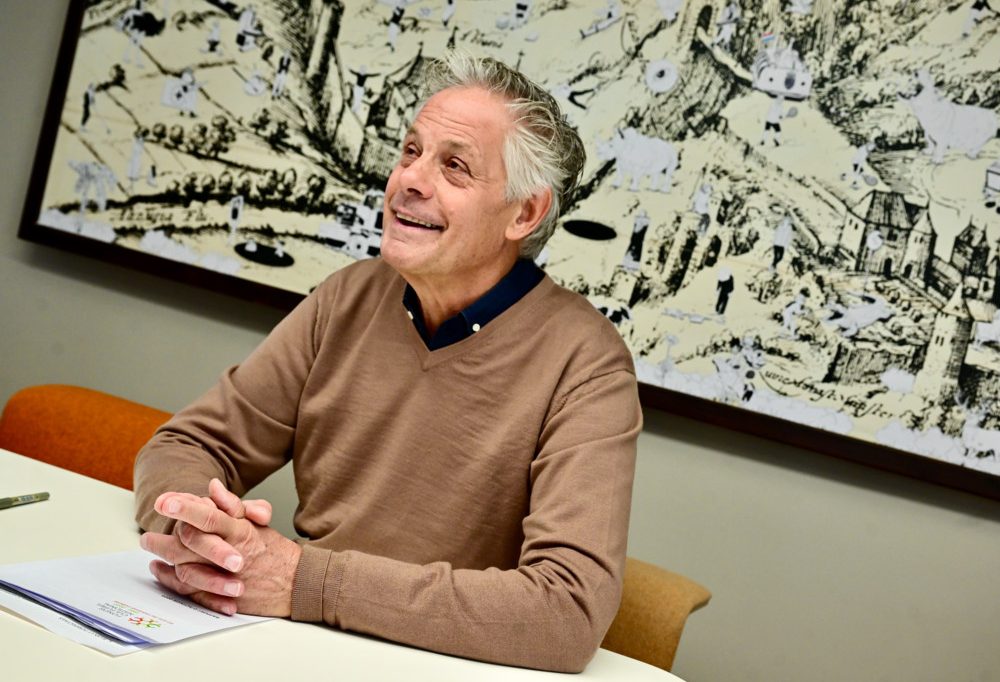





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können