Für verschiedene Reformen scheint aus teils erkennbaren, wenn auch nicht zwangsläufig akzeptablen, teils aus unerklärlichen Gründen einfach nie der richtige Zeitpunkt zu sein.
In jedem Fall kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass für die Verabschiedung verschiedener Gesetzesneuerungen schlichtweg der nötige politische Wille fehlt.
Mit dem Ergebnis, dass ein sogenannter Reformstau entsteht und verschiedene gesetzliche Regelungen einfach der gesellschaftlichen Entwicklung hinterherhinken.
Die Leidtragenden dieses fehlenden politischen Reformwillens sind – da ansonsten die Reformen ja bereits umgesetzt wären – in den meisten Fällen die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, Menschen, die sich nicht direkt zur Wehr zu setzen vermögen, kurz: Menschen ohne (ausreichende) Lobby.
Prominentes Beispiel für die Langsamkeit der Mühlen des Gesetzgebers ist die geplante Reform des mehr als 30 Jahre alten Scheidungsgesetzes sowie der damit einhergehende Gesetzesvorschlag bezüglich des elterlichen Sorgerechts.
Sieben und mehr Jahre
Erstmals im Mai 2003 im Parlament deponiert, dauert die Diskussion um das Gesetzesprojekt zur Neuregelung von Scheidungen jetzt bereits fast sieben (!) Jahre an. Knackpunkt war in diesem Zusammenhang lange Zeit die Altersabsicherung des Partners, der keine eigene Pensionslaufbahn hat oder der seine Pensionslaufbahn während der Ehe unterbrochen hat. Das Reizwort, das zumindest für einen Teil der verzögerten Umsetzung verantwortlich gemacht werden kann, lautet Rentensplitting.
Nun scheint aber zumindest klar, dass das Prinzip der Individualisierung der Rentenansprüche in der einen oder anderen Form fester Bestandteil der Reform werden soll – die neue Regierung jedenfalls (die beiden vorherigen Regierungen allerdings auch) hat in ihrem Programm die Modernisierung des Scheidungsrechts angekündigt. Bis es so weit ist, dürften allerdings (ob der angesprochenen Krise beziehungsweise des fehlenden Willens) noch einige Monate oder vielleicht sogar Jahre ins Land ziehen.
Eine Verbesserung der Situation der Frauen (denn diese sind nach wie vor im Fall einer Scheidung zumindest finanziell in den allermeisten Fällen die Leidtragenden) dürfte also kurzfristig nicht in Sicht sein.
Erinnern sollte man in diesem Kontext vielleicht daran, dass in Luxemburg seit Beginn der 90er Jahre jährlich um die 1.000 Ehen geschieden werden. Auf die oben erwähnten sieben Jahre hochgerechnet macht dies 7.000 Paare oder 14.000 Menschen aus. Für Luxemburger Verhältnisse mehr als nur eine „quantité négligeable“.
Noch deutlicher wird die Wichtigkeit einer Reform (beziehungsweise das Ausmaß einer fehlenden Reform), wenn man sich vor Augen führt, dass bei jeder Scheidung durchschnittlich ein Kind betroffen ist. Vor allem Kinder leiden – auch aufgrund unangepasster gesetzlicher Regelungen – unter der Trennung ihrer Eltern.
Zumindest teilweise Abhilfe soll an dieser Stelle die gesetzliche Einführung des gemeinsamen Sorgerechts schaffen. Dass dieses im Scheidungsgesetz nur festgehalten und in einem separaten Text geregelt werden soll, tut dabei prinzipiell nichts zur Sache. Hauptsache, die Reform kommt.
Der neuen Regierung jedenfalls stünde es gut zu Gesicht, wenn sie unter Beweis stellen würde, dass sie sich auch für die Probleme der Bürger interessiert, die nicht unmittelbar in Euro oder in Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgedrückt werden können.
Tom Wenandy
[email protected]

 De Maart
De Maart






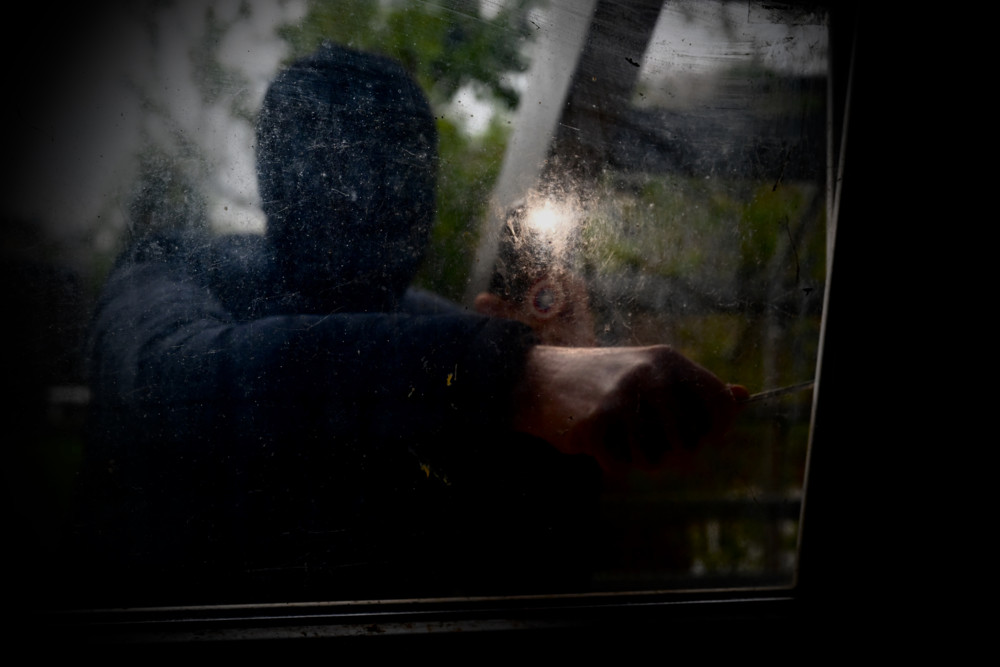
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können