Eigentlich ist das Ganze ja erstaunlich. Mit Blick auf Europa hört man derzeit vor allen Dingen die Debatte um die vermeintliche Schwäche des Euro, die allen Bürgern ach so viele Einschränkungen abverlange. Da ist es ja direkt erstaunlich, dass die USA, dass Russland und auch andere grosse Länder ihrerseits milliardenschwere Programme haben aufbringen müssen um aus der krise herauszukommen. Dabei sind das doch gar keine Länder der Eurozone. Vielleicht bhat es etwas damit zu tun, dass es auch noch eine andere Krise gegeben hat. Ist die bereits vergessen? Sind wirklich alle Einschränkungen die jetzt in Europa verlangt werden nur auf den Euro zurüclzuführen? Wohl kaum. Verfolgt man jedoch die Diskussionen kann man sich dieses Eindrucks nicht erwherenDa wurde letztes Jahr im April mit großem Getöse ein G20-Gipfel in London ausgerichtet, die großen Industrienationen diskutierten fieberhaft, um Auswege zu finden, die USA legten das größte nationale Hilfsprogrammihrer Geschichte auf, die Welt sprach von der größten Weltfinanzkrise seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ausgerechnet bei uns hier in Europa sollplötzlich nun der Euro, die jüngste Währung der Weltgeschichte, an all den Sparkursen schuld sein, die von den einzelnen Regierungen gefahren werden. Man könnte glatt meinen, die weltweite Finanzkrise sei spurlos an Europa vorbeigegangen und nur der Euro sei an allem schuld.
Da hat man nun doch den Eindruck, dass immer mehr Menschen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Sicher, der Angriff der Großfinanz-Spekulanten auf den Euro hat Schwächen offenbart, die da lauten bessere Kontrolle über nationale Haushaltsdefizite und Solidarität aller Mitglieder im Falle einer nationalen Schwächung. Hierüber wird man diskutieren müssen.
Doch nicht der Euro an sich ist das Problem, wie es am Montag EU-Kommissionspräsident Barroso festgestellt hat. Die augenblickliche Entwicklung und die in einigen Ländern fast schon hysterisch geführte Diskussionen haben lediglich gezeigt, dass die EU es bislang versäumt hat, ihre zwei grundlegenden Probleme zu lösen.
Auseinanderdriften
Das ursprüngliche Problem ist nach wie vor die Frage der Souveränität der EU-Mitgliedstaaten. Seit den zarten Beginnen vor 60 Jahren mit der Schuman-Deklaration sucht die EU Wege, die nationale Souveränität ihrer Mitglieder in Einklang mit der Entwicklung hin zu einem neuen Gesamtgefüge zu bringen, in dem die Menschen in Europa gemeinsam die Vielfalt des Kontinents erleben und gestalten können. Wirtschaftlich sicher, sozial, wenn auch äußerst zaghaft, und kulturell.
Auch politisch hätte es fast geklappt. Doch eigentlich in dem Augenblick, in dem auch eine bessere politische Zusammenarbeit immer näher rückte, Ende der 80er, Beginn der 90er Jahre, setzte mit dem Mauerfall jene Entwicklung ein, die das zweite aktuelle politische Problem der EU einläutete.
Es ging darum, die historische Chance zu nutzen und Europa wieder zu einem Ganzen zu machen, kurzum, die EU kam an einer Aufnahme der früheren Ostblockstaaten einfach nicht vorbei. Gegenteiliges Handeln wäre historisch unverzeihlich gewesen. Doch während die „alten“ EU-Mitglieder – mit der Ausnahme von England, das die EU immer eher als eine Art Freihandelszone denn als politischen Raum betrachtete – sich eigentlich angeschickt hatten, ihr breites fächerförmiges Spektrum zentral auf den Punkt einer auch politischen Einigung zu fokussieren, unter freiwilliger, größtmöglicher Aufgabe von Souveränität, setzte bei den „neuen“ Mitgliedern eine entgegengesetzte Entwicklung ein.
Sie, die bislang unter der kommunistischen Flagge unfreiwillig zentralisiert waren, nutzten die neue Freiheit, um endlich wieder souverän nationale Staaten aufzubauen. Der Fächer in Richtung Eigenbrötelei öffnete sich im Osten, während er im Westen eigentlich dabei war, sich zu schließen. Die EU, in die die neuen Mitglieder drängten, war ihnen eher wirtschaftlicher Hafen und vor allen Dingen Schutz gegen den eventuellen Rückfall in alte Zeiten denn neue politische Heimat.
Das ist verständlich. Aber dieses Auseinanderdriften hat Europa auf dem Weg zur politischen Einigung zurückgeworfen. An einer solchen jedoch wird man nicht vorbeikommen. Denn auch die nun angestrebte Art „Wirtschaftsregierung“ für die EU z.B. oder eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik kommt ohne bessere politische Festigung nicht aus.
Serge Kennerknecht
[email protected]

 De Maart
De Maart

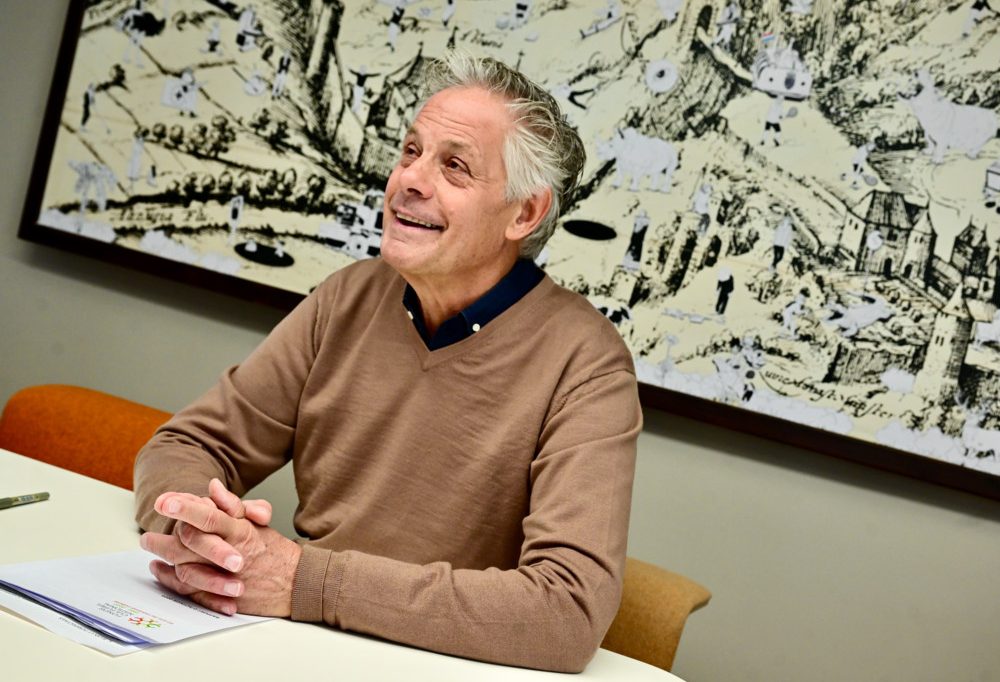





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können