Es ist nämlich wie mit den Aids-Fällen. Sobald weniger Anstrengungen, weniger Sensibilisierungs- und Informationskampagnen organisiert werden, sobald man sich in einer falschen Sicherheit wiegt, wird man auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Zahlen der Kranken oder im Fall der Verkehrssicherheit der Toten und Schwerverletzten steigen wieder und mit ihnen das Leid. Eine provisorische Bilanz geht von 47 Toten im letzten Jahr aus, die höchste Zahl seit 2005 (46 Opfer).
Zu oft konzentrieren wir uns auch auf die Toten, nehmen diese als Gradmesser für den Erfolg der Maßnahmen. Dabei vergessen wir, dass hinter jedem Schwerverletzten ebenfalls ein tragisches Schicksal steckt, wenn zum Beispiel die betroffene Person arbeitsunfähig wird, andauernd mit Schmerzen leben muss usw. Die zerstörten Existenzen werden zu oft ignoriert. Es wäre interessant, bei der Vorstellung der Unfallstatistiken zu erfahren, wie viele Unfallopfer behindert oder langfristig arbeitsunfähig wurden.
Sicher, es wird viel getan. Organisationen wie die „Sécurité routière“ intensivieren seit Jahren ihre Kampagnen. Die Polizei macht immer mehr Kontrollen gegen Raser, gegen das Handy am Steuer, gegen das Fahren mit Autos mit schlechten Reifen und unzureichender Beleuchtung, gegen Alkoholmissbrauch usw. Aber alle diese Initiativen zeigen nicht die erwünschte Wirkung. Der Einzug von nicht weniger als 2.240 Führerscheinen im letzten Jahr zeigt deutlich, dass es noch viel Nachholbedarf gibt was die Verkehrssicherheit angeht.
Keine Tabus
2009 gab es neun Tote bei Motorradunfällen. Das Anbringen von doppelten Leitplanken soll das Verletzungsrisiko bei den Motorradfahrern mindern. Aber es muss auch ein Mentalitätswechsel her. Viele Motorradfahrer müssen erkennen, dass sie schnell fahren können, aber nicht unbedingt müssen, und dass es sehr gefährlich ist, die Gefahren zu unterschätzen.
Schwache Verkehrsteilnehmer (13 Tote im letzten Jahr) müssen besser geschützt werden. Aber auch hier ist es wichtig, ihnen zu erklären, wie sie helfen können, sich besser zu schützen, indem sie zum Beispiel hellere oder reflektierende Kleidung anziehen, wenn sie abends spazieren gehen, oder indem sie es vermeiden, ohne aufzupassen, auf oder schlimmer drei Meter neben dem Zebrastreifen die Straße zu überqueren.
Den Autofahrern muss ans Herz gelegt werden, die Verkehrsordnung einzuhalten, das Fuß an gefährlichen Stellen vom Gas zu nehmen, nicht zu viel zu trinken, wenn sie fahren, und im Allgemeinen mehr Rücksicht auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu nehmen.
Eine große Verantwortung lastet aber auch auf der Politik. Lange diskutierte, kontroverse und unbeliebte Themen wie fest installierte Radare oder das Herabsetzen der Alkoholgrenze auf null Promille dürfen kein Tabu mehr sein. Infrastruktur-Verbesserungen der in Luxemburg oft schlechten Straßen können ebenfalls helfen, die Anzahl der schweren Unfälle zu reduzieren.
Die repressive Politik, die strengere Strafen und mehr Kontrollen vorsieht, muss unbedingt durch eine bessere Aufklärungspolitik ergänzt werden.
Den Automobilbauern obliegt die Verantwortung, immer bessere, sicherere Autos zu bauen. In diesem Zusammenhang darf nicht nur die Sicherheit der Fahrzeuginsassen im Zentrum stehen, sondern auch die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer.
Im Allgemeinen muss umgedacht werden. Innovative Ideen wie das „shared space“ sind zukunftsweisende Konzepte, denen eine höhere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden muss. Am Ende aber sind es Toleranz, gegenseitiger Respekt und Vernunft, die beste Garanten für ein harmonisches Zusammenleben auf unseren Straßen bleiben.
René Hoffmann
[email protected]

 De Maart
De Maart

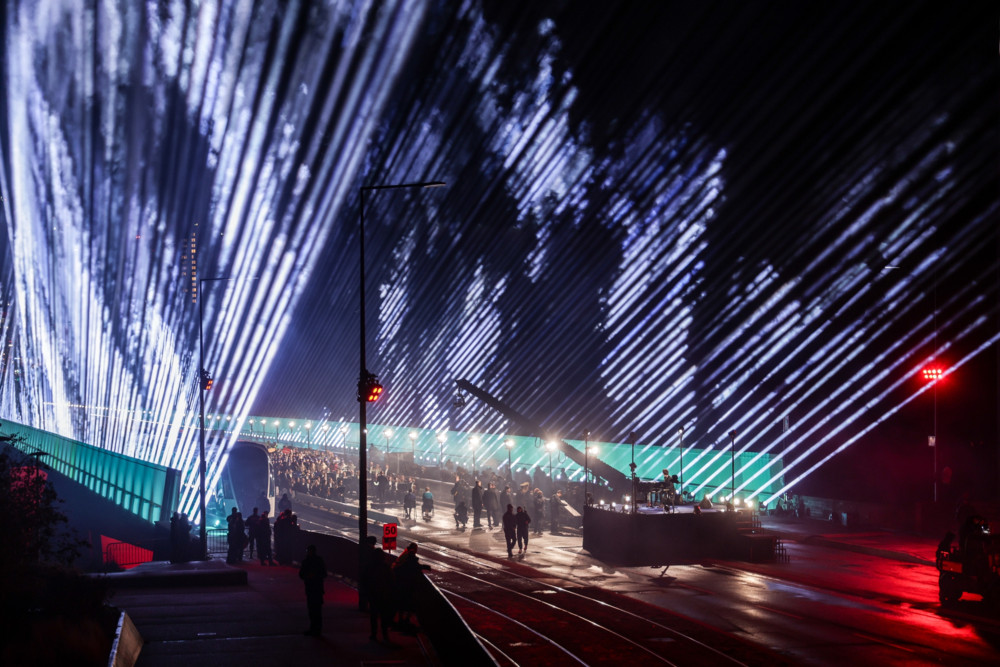





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können