Der rezente Aufschrei gegen den vermeintlichen Schuldigen der Bildungsmisere offenbart manch zeitgenössisches Symptom. Zunächst wäre das Unbehagen in den eigenen vier Wänden zu nennen. Etliche Zeitgenossen fliehen in ihrer sog. freien Zeit aus den mehr oder minder kostspielig erworbenen vier Wänden, um einer aggressiven Sport- oder Konsumkultur nachzugehen. Zu Hause sein ist einfach obsolet, ein Buch lesen, faulenzen, im Garten sitzen, selbigen pflegen, die Ferien in Balkonien verbringen: für die Generationen „Porsche“ und „Youtube“ einfach nur dröger Zeitverlust.
Nun haben Hausaufgaben die ungute Eigenschaft, dass die zu Hause erledigt werden sollen. Leicht zu erraten ist die latente Forderung hinter dem Empörungsgehabe der Elternvertreter oder vermeintlicher Bildungsexperten: Da die Eltern zu zweit einer bezahlten Arbeit nachgehen müssen und bis 18.00 Uhr nicht zu Hause sind, sollte auch die Hausaufgabe abgeschafft werden. Dieser sozio-ökonomisch einleuchtende Grund tut der Sinnhaftigkeit von Hausaufgaben jedoch keinen Abbruch. Letztere waren, sind und bleiben eine unabdingbare Voraussetzung für die Festigung der Inhalte und Kompetenzen, die der Lehrer im Unterricht vermittelt hat. Genau wie die Fußballspieler und Berufsmusiker müssen auch Schüler ständig wiederholen, was sie im Unterricht ein erstes Mal gestreift haben, damit sich ein „nachhaltiger“ Lernfortschritt einstellt.
Beipflichten hingegen muss man den Kritikern von Hausaufgaben allemal hinsichtlich der Gewichtung von Hausaufgaben, sowohl in puncto Schwierigkeitsgrad als auch bezüglich des Umfangs: Zu viele Kollegen und Kolleginnen im Schulbetrieb sehen nur ihr jeweiliges Fach und vergessen darüber den kumulativen Effekt aller Hausaufgaben pro Tag und pro Schüler. Deswegen aber die Hausaufgaben abschaffen zu wollen, ist vor allem für die Schüler und für den Wissens- bzw. Forschungsstandort Luxemburg kontraproduktiv.
Bliebe die Alternative „Ganztagsschule“. Dieser durchaus gangbare Weg würde vor allem Schülern aus sozio-ökonomisch schwächeren, sog. bildungsfernen Haushalten zugutekommen. Lehrkräfte müssten dann bis ca. 17.00 Uhr Nachhilfe erteilen. Der Vorteil dabei wäre ein doppelter: Neben dem bereits genannten der allmählichen, zumindest in der Theorie wirksamen Nivellierung sozialer Ungerechtigkeit könnte auch die Lehrperson daraus einen Nutzen ziehen. Die Nachmittage müssten zwar in der Schule verbracht werden, doch bei einer stringenten Organisation seitens der Schulleitung könnten an diesen Nachmittagen etwa im Sekundarbereich alle mündlichen Prüfungen, die jährlich zu leistenden Weiterbildungskurse, Elterngespräche und andere behördliche Verpflichtungen wie Gespräche mit den Vorgesetzten, nicht zuletzt aber auch die Korrekturen und Unterrichtsvorbereitungen besorgt werden.
Dann müsste man sich als Sekundarlehrer im Konsum- und Dienstleistungsland Luxemburg auch nicht mehr die semidebilen Bemerkungen anhören, wonach „man mittags ja immer schon frei sei“.
A bon entendeur, salut.

 De Maart
De Maart
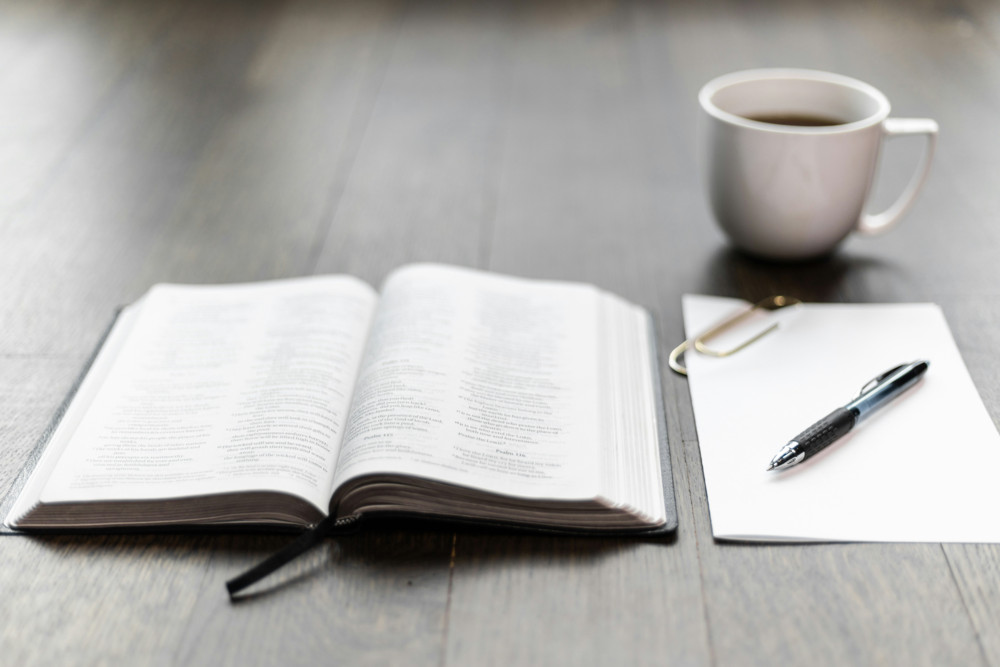






Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können