In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Unsere Musikspezialisten haben sich diese Woche die neuesten Alben von Eels, A Perfect Circle und God is an Astronaut angehört.
 Altherrenverschrobenheit
Altherrenverschrobenheit
von Jeff Schinker
Maynard James Keenan tut einfach, was ihm gerade passt – und trägt passenderweise auf manchen Fotos Pippi-Langstrumpf-Zöpfe. So hat der Tool-Sänger auf der letzten Tournee von seiner Drittband Puscifer kurzerhand Wrestling-Choreografen als Support Act mit in den Ring, der dann tatsächlich auch auf der Bühne stand, genommen. Manchmal hat er keine Lust auf Musik und produziert lieber Wein, manchmal macht er sich auch einen Spaß daraus, neugierige Journalisten zu verschrecken. Seine Prioritätenliste entspricht auf jeden Fall nicht im entferntesten der Prioritätenliste seiner Fans.
Weswegen Keenan vor zwei Jahren ganz gemächlich das dritte (sehr gute) Puscifer-Album, auf das (unfairerweise) niemand wartete, veröffentlicht. Und jetzt, wo die Gerüchte um ein neues Tool-Album umhergehen, belebt er seine erfolgreiche Zweitband A Perfect Circle wieder. So unberechenbar wie Maynard ist Eat the Elephant zwar leider nicht, so hässlich wie das Cover-Artwork dann aber auch sicherlich nicht. Die Platte beginnt sowohl vielversprechend als auch enttäuschend: Vielversprechend, da der ruhige, klavierlastige Titelsong mit seiner fast jazzigen Perkussion und seiner schwermütigen, traurigen Atmosphäre ein ausgezeichneter Opener ist, enttäuschend, weil im direkten Vergleich mit einem Song wie „The Package“, der beim Album „Thirteenth Step“ an erster Stelle stand, nun jeder Tool-Einfluss fehlt – sprich die typische Härte ist weg und man merkt, dass 14 Jahre seit der letzten Platte verstrichen sind. Dies ändert aber nichts daran, dass die neugewonnene Gelassenheit – es gibt Klavierparts auf den meisten Tracks – der Band überaus guttut und die erste Hälfte des Albums sowohl abwechslungsreich als auch vorzüglich komponiert ist: „Disillusioned“ setzt die Schablone für den neuen Klang der Band, „So Long, and Thanks for All the Fish“ ist klassischer Alternative-Rock, der von Maynards Stimme getragen wird. Letztere ist übrigens das ganze Album über vorzüglich dehnbar, vielfältig und grandios – und macht „TalkTalk“ und „By and Down the River“ zu Highlights des Albums.
Etwas erschreckend ist dann aber doch, dass A Perfect Circle nicht mehr zu rocken vermögen. Dies ist an sich weniger schlimm, wenn man bedenkt, dass die Band dies nur noch auf zwei Tracks versucht. Erinnert man sich aber daran, wie diese Band auf „Weak & Powerless“ mal perfektes Popgespür mit Härte und Atmosphäre kombinierte, fühlt sich ein Track wie „Delicious“ dann doch wie eine arg bemühte, steife und aufgesetzte Zeitreise in die 2000er-Jahre an. Da bevorzugt man doch die neuen A Perfect Circle, bei denen sich die momentanen Wutausbrüche – siehe das Ende von „Disillusioned“– in Songs mit wechselnden Atmosphären wie Aprilwetter manifestieren.
Gegen Ende der Platte treten sie dann noch mehr aus der Comfortzone des verschrobenen, gemächlichen und meist sehr gut geschriebenen Altherren-Indie heraus: „Hourglass“ kombiniert EDM-Synthies mit Autotune, typischen Perfect-Circle-Arpeggi und einem delikaten Klavier. Was sich hier auf dem Papier vielleicht wie ein monströses Hybrid liest, klingt tatsächlich aber, dank Maynards Stimme und eingängigem Songwriting, äußerst gut. Das abschließende „Get the Lead Out“ erinnert sogar an alt-J, wird mit tribalem Hiphop-Beat unterlegt und endet, falls man die Vinyl-Version der Platte besitzt, in einer Endlosschleife.
Durch den Einsatz von Synthies und weniger Härte sowohl bei Puscifer wie auch bei A Perfect Circle schwinden die Unterschiede zwischen Maynards Bands so langsam. Schlimm ist das angesichts der Qualitäten der letzten Puscifer und dieser Platte nicht, ein neues Tool-Album könnte dennoch wieder für etwas mehr Vielfalt sorgen.
Anspieltipps: The Doomed, Disillusioned, TalkTalk, By and Down the River


Melancholie als Grundton
Von Jeff Schinker
Das Leben von Marc Oliver Everett liest sich wie ein Roman – das Buch zum eigenen Leben hat der Sänger und Hauptmann von Eels dann auch irgendwann geschrieben. Vom Vater, der als Quantenphysiker von Nils Bohr persönlich verspottet wurde, weil er unlösbare Paradoxe der zeitgenössischen Physik mit der Parallelwelttheorie zu erklären versuchte und der seinen Körper späterhin dem Suff, der Fressgier und den Zigarren zum Opfer gab, bis hin zur Schwester, die nach ihrem Freitod in ihrem Abschiedsbrief vermerkte, ihre Aschen sollen im Klo runtergespült werden, damit sie ihren Vater in einer seiner Parallelwelten wieder treffe, hatte es Everett ganz sicher nicht leicht. Wer so was mitgemacht hat, hört sich einerseits die üblichen Familienbeschwerden der Freunde mit etwas weniger Aufmerksamkeit an, dürfte andererseits aber den Blues und die Melancholie als Lebensgrundeinstellung adoptiert haben.
Auf diesem seinem zwölften Album will der Ton nach dem traurigen „The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett“ wieder optimistisch sein – aber auch The Deconstruction klingt von der Stimmung verschiedener Songs her anfangs höchstens wie ein Wunschkonzert für Hobbymelancholiker, ein Ponyhof für Pferdehasser. Nach und nach lässt Everett aber ordentlich Licht in sein Album – ein Song wie „Today is the Day“ ist fast schon nervig in seiner Lebensbejahung, „Sweet Scorched Earth“ ist ein schönes Liebeslied, das ohne Kitsch auskommt (sofern dies bei Liebesliedern heutzutage überhaupt noch möglich ist).
Im Gegensatz zu der Album-Trilogie, die der Musiker zwischen 2009 und 2010 herausbrachte und welche die drei unterschiedlichen Stilausrichtungen der Band innerhalb jeweils einer Platte vorstellten, wechselt die Scheibe, die mit 15 Songs (darunter drei instrumentale Intermezzi) etwas zu lang daherkommt, zwischen bluesigen Indie-Rock-Tracks (das tolle „Bone Dry“) und Balladen, die manchmal spärlich und melancholisch („Premonition“), manchmal opulent und orchestral („Rusty Pipes“) instrumentiert sind.
Dafür, dass wir mit einer Wartezeit von vier Jahren aber noch nie so lange auf ein Eels-Album warten mussten, und dafür, dass der Titel auf etwas mehr Experimentierfreudigkeit hoffen ließ, ist Eels’ neue Platte streckenweise zu überraschungslos und zu simpel. Aber vielleicht ist simpel genau das, was man dem Mann jetzt wünschen sollte.
Anspieltipps: The Deconstruction, Bone Dry, Premonition, Sweet Scorched Earth


Kathartische Traumaverarbeitung
von Jeff Schinker
Viele Besprechungen von Post-Rock-Bands beginnen damit, dass der Rezensent bedauert, wie sehr dem Genre in den vergangenen Jahren die Luft ausgegangen sei. Einem solchen Autowerkstattbericht bleiben nach dieser Bestandsaufnahme exakt zwei Entwicklungsmöglichkeiten: Der Kritiker lobt die Band, deren neue Scheibe er gerade rezensiert, weil er sie als lobende Ausnahme eines Genres in der Krise sieht – oder er nutzt die gehörte Musik als weiteren Zementstein für die Sargkammer. Dass eine solche rhetorische Masche schlicht und einfach faul ist, scheint klar. Schlimmer ist allerdings, dass die meisten solcher Rezensenten die rezenten Evolutionen dieses weitestgehend instrumentalen Genres, das sich der klassischen Strukturen der Rockmusik bedient und von ihnen entfernt, eigentlich gar nicht kennen. Denn Post-Rock ist kaum mehr mit den langgezogenen Epen, die das Genre damals markiert haben, zu vergleichen – und kommt heutzutage meistens relativ schnell zur Sache.
Der Grund für diese Masche – letztlich sind solche Rezensionen redundanter als das Genre, dem sie ebendiese Redundanz vorwerfen – liegt darin, dass es in der Tat schwer ist, die instrumentale Musik solcher Bands zu umschreiben, da man sich hier nicht an Texte lehnen kann, um die Gefühlsgeschichte der Künstler nachzuerzählen. Ungleich ungestümer Indie-Bands kann man auch keine langen Exkurse über den Hedonismus der Mitglieder halten – Post-Rock-Bands bestehen meist aus unscheinbaren Typen, die ein ruhiges Privatleben führen oder eben kein Interesse daran haben, dies an Tabloids weiterzuleiten.
Das neue, neunte und beste Album von God is an Astronaut heißt Epitaph und braucht trotz unserer vorherigen Aussagen eine kurze biografische Erläuterung, welche die Entstehungsgeschichte der Platte beleuchtet: „Epitaph“ thematisiert und verarbeitet nämlich den Tod des siebenjährigen Cousins der Kinsella-Brüder Nils (Bass) und Thorsten (Gesang, Gitarre, Synthies). Dass eine Band nach fast zehn Platten ihre stärkste Musik veröffentlicht, ist äußerst selten, kann sich aber durchaus mit einer vielleicht klischeehaft anmutenden Theorie der Katharsis und der Traumaverarbeitung erklären – die Platte ist nicht nur vorzüglich geschrieben und produziert, sondern auch emotionsgeladener als die Vorgänger.
Der Opener „Epitaph“ beginnt mit einer bedächtigen Klaviermelodie, die sich nach zwei Minuten aufbäumt, von Beats untermalt wird, bis sich dann eine bedrohliche Atmosphäre aufbaut – meteorologische Metaphern ersparen wir euch hier – die in einen berührend schönen Schlussteil mitsamt Kinsellas textlosem Gesang mündet. Überhaupt klingt die Platte teilweise sowohl federleicht als auch bleischwer – „Mortal Coil“ beginnt mit elegantem Klavier und luftiger Basslinie, bis die gesättigten Gitarren einen mitreißen, um einen dann mit einem akustischen Finale wieder zu entlassen, „Séance Room“ beginnt wie ein klassischer Post-Rock-Track mit atmosphärischen Arpeggi, bis die Synthies, die auch von 65daysofstatic stammen könnten, und das Schlagzeug Akzente setzen und die Séance kräftig intensivieren. Auf dem dunklen „Medea“ werden fast alle Klänge von Kinsellas Stimme, die durch Effektgeräte verfremdet wird, produziert, um eines der atmosphärisch intensivsten Stücke der Bandgeschichte zu bilden. Auf „Komorebi“ werden nur wenige Noten gespielt, der Song versetzt den Zuhörer aber dank der Ambient-Klänge in eine melancholische Stimmung.
Dass die Platte das bisher schönste Album der irischen Band ist, verdanken wir auch der Produktion, zu welcher die ausgezeichneten Xenon Field (zurzeit auch im Vorprogramm der Tournee von God is an Astronaut) beigetragen hat – wo die Alben der Band manchmal an einer zu klinischen Produktion und zu konventionellen Klangkulissen litten, wurde hier viel Zeit in die Entwicklung einer ganz eigenen Klangwelt investiert, die der Qualität der Songs und ihrer Atmosphäre nicht nur gerecht werden, sondern ihre Grundstimmung erst hervorrufen.
Anspieltipps: Mortal Coil, Séance Room, Epitaph, Komorebi

 De Maart
De Maart
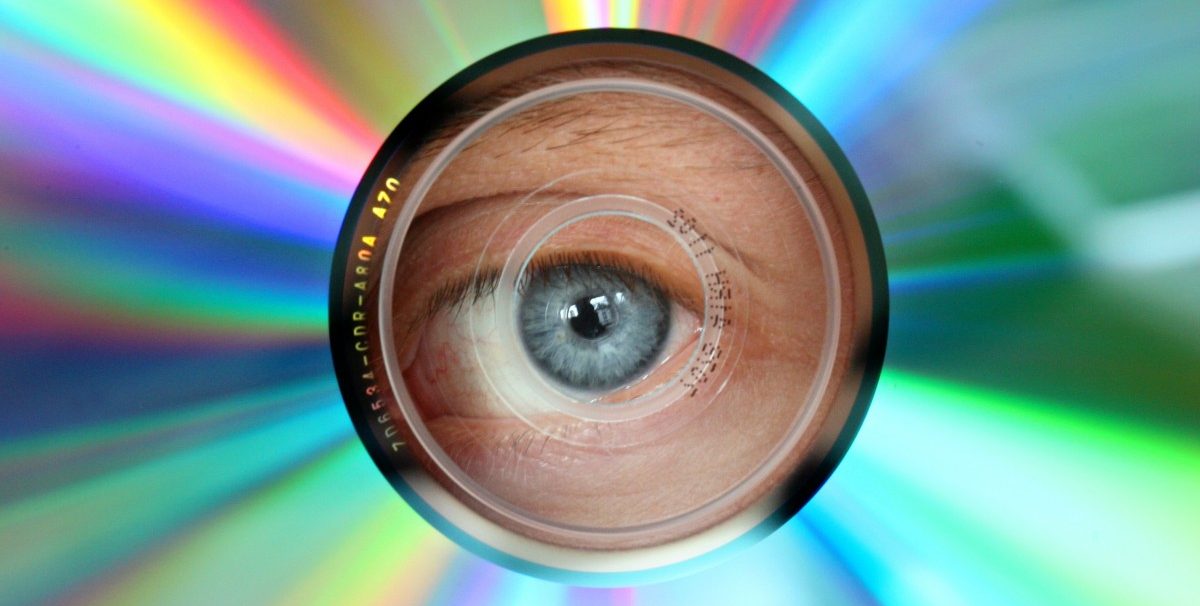




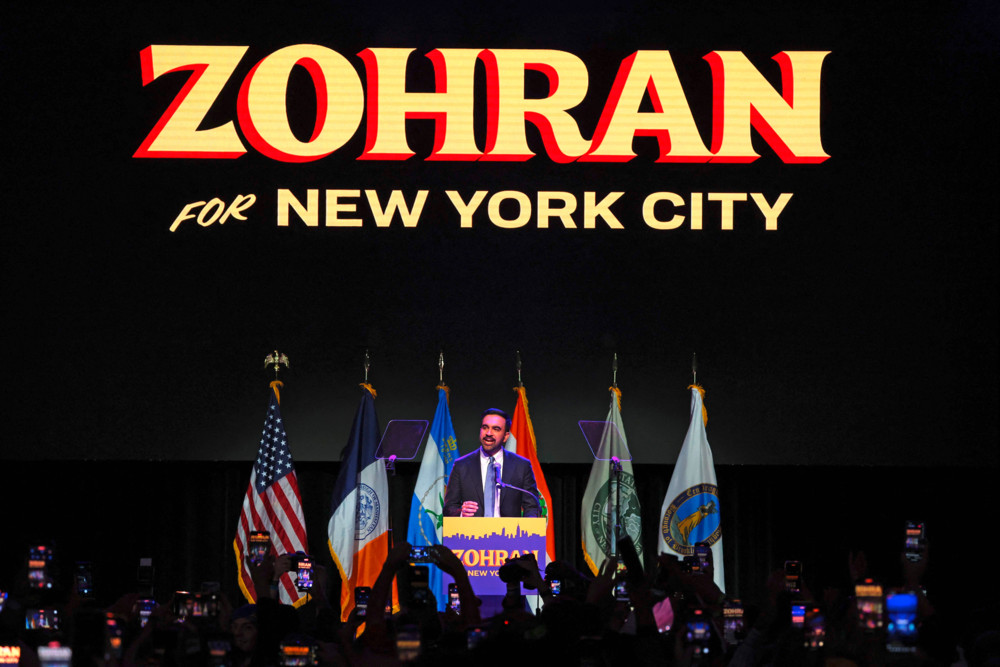


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können