„Empowerment Kultur“: Keine Scheu vor dem Skandal
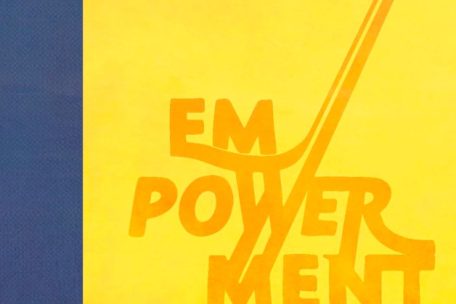
Vor zwei Jahren geriet der österreichische Kulturmanager Fabian Burstein nicht unbedingt zufällig in das, was man modischer Weise einen „Shitstorm“ nennt. Als Leiter des Kulturprogramms der Bundesgartenschau in Mannheim, kurz und schmissig auch „BUGA 23“ genannt, hatte er den Auftritt einer Senioren-Laientanzgruppe, kostümiert als Geishas, Pharaonen, Azteken und ähnlichem Ethnokitsch, abgesagt.
Man erwartete zur Großveranstaltung internationale Gäste, die womöglich eine solche Darbietung als Versuch, „die Grenzen zwischen harmlosem Amüsierbedürfnis und unsensibler Veräppelung auszuloten“, befremdlich gegenüberstehen würden. In Windeseile wurde die Absage von einer lokalen Zeitung wie auch vom bundesdeutschen Schmierblatt Bild zum Skandalon erhoben. Wobei die Behauptung aufgestellt wurde, Bursteins Entschluss wäre ein Paradebeispiel für zügellose Altersdiskriminierung. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, mit was für einer Flut an Hassmails der Mann sowohl im Internet wie unter Privatadresse konfrontiert wurde. Womit dann auch die Initialzündung für „Empowerment Kultur – Was Kultur braucht, um in Zeiten von Shitstorms, Krisen und Skandalen zu bestehen“ beschrieben wäre – Fabian Bursteins Ratgeber für Leute, die sich nicht einfach wegducken wollen vor der Gefahr, etwas vermeintlich Falsches (oder Richtiges) zu sagen oder zu machen, das die Dauerempörten auf die Social-Media-Barrikaden treibt (wenn sie sich nicht längst dort wohnlich eingerichtet haben).
Leisetreterei und Korruption

Anhand einer ganzen Reihe von Beispielen, wobei nahezu notgedrungen Fälle aus der berüchtigten österreichischen „Freunderlwirtschaft“ überwiegen, versucht der Autor die Folgen von Vermeidungsstrategien auf individueller wie kollektiver, bzw. gesellschaftlicher Ebene darzulegen, die sowohl die Kulturverwaltung – also die Organisation und Abwicklung kultureller Ereignisse – wie Kultur insgesamt stark in Mitleidenschaft ziehen. Kurz gesagt: Leisetreterei fördert Korruption. So gesehen wirken Skandale, auch wenn sie für konkret Beteiligte schrecklich auszuhalten sein dürften, wie Schlaglichter, die plötzlich aber auch jene Ecken ausleuchten, in denen es sich vordem im Halbdunkel gut munkeln ließ. Burstein plädiert für mehr Mut und für deutlich mehr Unterstützung für jene Mutigen, wenn sie an den öffentlichen Pranger gestellt werden. So wie Burstein. Der sich durch die Kampagne von Bild und Konsorten nicht einschüchtern ließ, sondern, „Empowerment Kultur“ beweist es: dagegenhält!
„Das 21. Jahrhundert“: Der große Wurf

„Dieses Buch erzählt eine Geschichte, und die besteht selbst aus zu unterschiedlichen Zeiten entwickelten Vorstellungen von geschichtlichen Verläufen, in fast jedem Text ist das der Fall. Es erzählt also eine Geschichte der Entstehung unterschiedlicher Geschichten in einem Kopf, der ein schon bestehendes Bild von geschichtlichen Verläufen – in Kunst, Politik und anderen Systemen – mit immer wieder anderen Zwischenergebnissen abgleicht.“
Der Kopf, um den es hier geht, ist der des Kulturkritikers Diedrich Diederichsen. Der Verlag Kiepenheuer und Witsch hat ein massives Konvolut an Texten veröffentlicht, die von ihm im Laufe der letzten knapp zweieinhalb Jahrzehnten in unterschiedlichen Kontexten – Periodika meist, wie Tageszeitungen oder Kunstjournalen, aber auch Ausstellungskatalogen – schon einmal veröffentlicht worden sind.
Zuerst irritiert der Titel der Essaysammlung. Denn „Das 21. Jahrhundert“ hat noch nicht einmal ein Viertel seiner Laufzeit hinter sich. Wie also will man da dessen Grundzüge resümieren, seinen Charakter bestimmen? Mit leichter Koketterie verweist Diederichsen auf Carl Einstein, der in ähnlichem Vorgriff 1926 seine „Kunst des 20. Jahrhunderts“ herausbrachte, um dann aber deutlich seriöser den vielfältigen oder vielschichtigen Ansatz seiner Arbeit als eine Form von Roman, als ein sowohl kaleidoskopisches wie autofiktionales Erzählen zu bezeichnen. Dabei wird die Absicht, „einen Begriff von Abläufen, Unterbrechungen, Wiederholungen, von Beschleunigung und Verlangsamung zu gewinnen“, die maßgeblich seit der Studentenrevolution von 1968 nicht bloß die mitteleuropäische Geschichte quasi konfigurierte, klar ins Auge gefasst. Selbstverständlich steht dabei auch die Frage im Raum, wie es – setzt man den großen, gesellschaftlichen Umbruch in den 1960er Jahren als zentralen historischen Fixpunkt voraus – nur so weit kommen konnte. Wie war es möglich, dass der emanzipatorische Aufbruch zu neuen, weitaus offeneren gesellschaftlichen Realitäten wie zuvor zu einem Netz aus proto- oder neofaschistischen Regierungen in Ungarn, Russland, Argentinien, und nun auch in den USA, führte?
Akribie als Stilmittel

Im Vorwort seines „21. Jahrhunderts“ spricht Diedrich Diederichsen diesen aktuellen Weltenzustand an und will seine Texte durchaus auch methodisch als etwas verstanden wissen, das den „Weg dahin, über viele Stationen, die keineswegs nur solche des Niedergangs und der Regression sind“, beschreibt. Selbstkritisch, und im Rückgriff auf das Bild des romanhaften Konvoluts an Essays gibt der Autor allerdings zu bedenken, dass seine „Protagonist_innen (…) Ideen unterschiedlicher Stärke und Haltbarkeit sind“. Was dann folgt, ist ein thematisch in fünfzehn Kapiteln unterteiltes Monster an mannigfachen Zustandsbeschreibungen und Verlinkungen, wobei vor allem ins Auge sticht, um wie viel Präzision sich Diederichsen bemüht, Phänomene zu begreifen. Einerlei, ob es um eine Aufführung der Berliner Volksbühne wie im allerersten, ursprünglich am 5. Januar 2000 im „Theater heute“-Journal publizierten Text geht, oder ob er sich mit Gegenkulturen wie Camp, mit Krautrock oder Oper, mit Diskursethik und Gentrifizierungsgewinnlern, mit Jazzgrößen wie John Coltrane sowie Stars wie Lady Gaga oder dem schier unverwüstlichen Iggy Pop befasst – in jedem Fall besticht Diederichsen mit einem Maß an Akribie, mit der er seine Sujets zu erfassen und zu vermitteln sucht! Man kann in dieser Sorgfalt auch ein Stilmittel erkennen, das darüber entscheidet, dass das Textkonvolut nicht als ein wildes Sammelsurium oder Durcheinander an Moden und Meinungen abgetan werden kann.
Bliebe noch, angesichts des politisch wie kulturell angebrachten Pessimismus, ein Trotzdem in Form eines Satzes von Diedrich Diederichsen zu zitieren: „Fortschritte sind so real wie die Menschen, die sie tragen“. Das Buch ist, man mochte es kaum hoffen, das, was gemeinhin als großer Wurf bezeichnet wird. Nicht zuletzt helfen Diederichsens Essays beim Sortieren der unübersichtlicher gewordenen Gegenwart und sollten in keinem aufgeklärten Haushalt fehlen.

 De Maart
De Maart
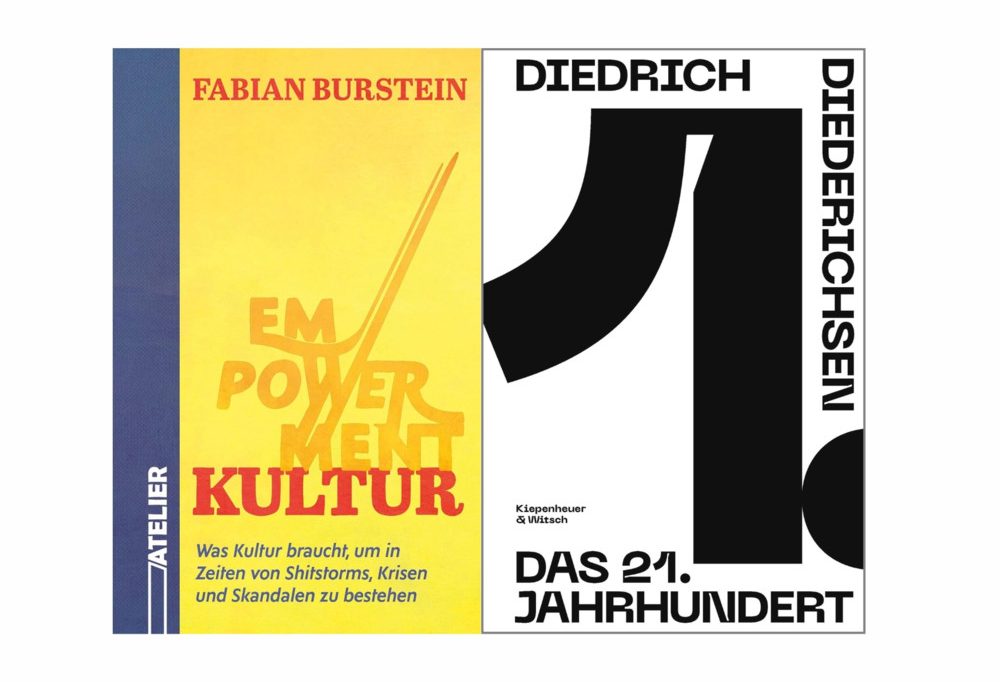






Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können