Die letzten Wettbewerbsfilme steigerten das Niveau der Berlinale nochmal erheblich – und zeugen von thematischem und formalem Abwechslungsreichtum. In „Touch Me Not“, der mit dem Goldenen Bären für den besten Film ausgezeichnet wurde und „Twarz“ (Grand Prix du Jury) werden zwischenmenschliche Beziehungen und Identitätsstiftung in Bezug auf das Wohlfühlen im eigenen Körper thematisiert, wohingegen „Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ und „Unsane“ inzestuöse Begierden und die beklemmende Darstellung der Psychosen eines Stalkers inszenieren. Das historiographisch angehauchte „Museo“ über den Raub mexikanischen Erbgutes war im Gegensatz dazu erfrischend leichtfüßig. Die Wettbewerbsauswahl hob sich einen der besten Beiträge für den Schluss auf: „In den Gängen“ ist ein wunderbar berührender, erzählerisch einfacher Film über einen schüchternen Großmarktangestellten, der die Liebe sucht und den Tod findet.
No Weirdness in Sexuality?
In gleich vier fast aufeinanderfolgenden Wettbewerbsfilmen wurde die Schwierigkeit zwischenmenschlicher Beziehungen durch die Inszenierung diverser Tabuthemen und gestörter Verhältnisse thematisiert – und das Wohlfühlen in der eigenen Haut meist in Bezug auf ein ausgeglichenes Sexleben dargestellt. Die ersten beiden davon gingen als große Gewinner des Festivals hervor.


Bei „Touch Me Not“, ausgezeichnet mit dem Goldenen Bären für den besten Film, wurde sexuelle Intimität im Rahmen der Suche nach dem Wohlfühlen im eigenen Körper problematisiert: Der Film belichtet in einer Reihe unterkühlter, loser zusammenhängender Szenen eine Art körperliche Identitätssuche der Hauptfigur Laura, die sich nicht berühren lassen will oder kann und die deswegen einen Therapeuten und später einen Callboy aufsucht. Mit Christian Bayerlein, der mit körperlichen Einschränkungen leben muss, sucht sie einen Workshop für Körperwahrnehmung auf, woraufhin der Film eine teilweise utopische, marginalisierte Gruppe von Leuten porträtiert, die einer enttabuisierten Sexualität freien Lauf lassen.
Der Film hat viele berührende Momente – insbesondere im Lauf einer Szene, in welcher der Behinderte Christian über die Teile seines Körpers, die er mag, redet und sein Sexleben, das wohl freizügiger als das vieler gehemmter Menschen sein dürfte, dem Zuschauer sehr transparent vermittelt („there’s no weirdness in sexuality“, sagt er) – und ist in seiner Thematik wie auch in seiner Herangehensweise durchaus gelungen.
Das Verwischen von Dokumentarfilm und Fiktion hingegen ist in dem Sinne ineffizient, da die strukturellen Mittel der Fiktion keineswegs der dahinschleppenden Dramaturgie des Filmes verhelfen, sodass dessen teils wattigen, teils klinischen Farben und Ambiente im Kontext der losen, umstrukturierten Form den Zuschauer oftmals zu sehr einlullen, da wo das Thema eine konsequentere, klarere Inszenierung verdient hätte.


Unbequemlichkeit im eigenen (entstellten) Körper ist in „Touch Me Not“ die Ausgangssituation, die es zu überwinden gilt – in „Twarz“ (Silberner Bär/Großer Preis der Jury) begleiten wir die Hauptfigur Jacek tragischerweise bei dem entgegengesetzten Prozess. Jacek führt ein Leben, das durch die Liebe für Metallica, für seinen Hund, fürs Autofahren und für seine Freundin Dagmara abgesteckt ist. Er ist zwar ein Außenseiter in einem spießigen, katholischen polnischen Dorf, zieht aber Stolz und Bewunderung aus diesem Anderssein. Als er einen Berufsunfall erleidet – Jacek arbeitet an der Errichtung der weltgrößten Jesus-Statue – wird die landesweit erste Gesichtstransplantation an ihm vollbracht. In Polen wird er kurzerhand zur Berühmtheit und für Werbekampagnen rekrutiert, die Beziehung zu seiner Familie und seiner Freundin wird allerdings wegen seiner Entstellung problematisch.
Der Film pendelt anschließend zwischen Satire und tragischem Porträt und leidet an dieser Unentschiedenheit, da die Tragik von Jaceks Situation zu sehr der Persiflage diverser soziologischer und religiöser Umstände untergeordnet wird, um die ethischen und intimen Missstände der physischen Metamorphose oder Häutung in ihrer Tiefe darzustellen.
Nichtsdestotrotz porträtiert der Film auf eine intelligent-skurrile Art die Langeweile, die Verklemmtheit und das Unausweichliche des Provinzlebens – die dramatische Ironie, die will, dass Jaceks Entstellung ausgerechnet der Errichtung einer Jesus-Statue zu verschulden ist, eröffnet interessante allegorische Perspektiven.
Den Verstand verloren?


Vor einiger Zeit hat Steven Soderbergh („Ocean’s Eleven“) behauptet, er würde keine Filme mehr drehen. Dabei war er ebenso konsequent wie Stephen King, der vor gefühlt 20 Romanen einmal sagte, er würde mit dem Schreiben aufhören. „Unsane“, der integral mithilfe eines iPhones gedreht wurde, schildert anfänglich den Alltag von Sawyer Valentini (Claire Foy), die, nachdem ein Stalker ihr das Leben zur Hölle gemacht hat, einen Neuanfang in einer weit entfernten Stadt wagt – und dort prompt bei ihrem Chef und #metoo-Anwärter durch ihre kalte, karrieristische Attitüde positiv auffällt.
Als es Sawyer dann nach einem Tinder-Treffen aber nicht gelingt, mit ihrem Date zu schlafen, da sie ihn einen Moment lang durch ein Erinnerungsaufblitzen mit ihrem Stalker verwechselt, sucht sie eine Psychiaterin auf, die sie für eine Woche wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung stellt. Sawyer versteht nicht, was ihr passiert – bis einer der Patienten, mit der sie ein Zimmer teilen muss, ihr erklärt, dass es sich dabei um eine Versicherungsmasche handelt. Soderbergh greift hier erneut das Thema einer profitsüchtigen Gesundheitsindustrie auf, die genauso viele Patienten produziert, wie sie im Nachhinein heilt: Wer „Side Effects“ gesehen hat, fühlt sich hier auf vertrautem Terrain. Als Sawyer sich fast damit abgefunden hat, dass sie einem Versicherungsbetrug zum Opfer gefallen ist – der nicht länger als sieben Tage andauern kann – muss sie feststellen, dass einer der Krankenpfleger niemand anders als ihr Stalker ist.
Leider arbeitet der Film manchmal mit zu offensichtlichen und zu oft gebrauchten Kniffen des Psycho-Thrillers, sodass verschiedene erzählerische Wendungen zu sehr voraussehbar, vielleicht sogar klischeehaft sind, was der Zeichnung der Figur des Stalkers etwas schadet.
Weiterhin wird das anfängliche Hauptthema des Films – die Wahrnehmung der Realität als demokratischer Konsens und die Möglichkeit der Ausbeutung dieser Gegebenheit in Fällen von Betrügen – in der zweiten Hälfte mit einer philosophisch banaleren Hinterfragung eingetauscht: Wenn der Streifen in einen Verfolgungsthriller in einem Huis Clos umkippt, beschränkt er sich darauf, damit zu spielen, dass man nicht weiß, ob Sawyer spinnt und sich das Vorhandensein ihres Stalkers nur einbildet oder ob dieser wirklich da ist – und sich eine mögliche Beziehungsidylle zusammenspinnt. Der Film bleibt ein spannender Thriller, dessen Hauptfigur erfrischend antipathisch ist – nicht jedes Opfer muss automatisch charmant und gutmütig sein.


![]()
„Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ ist wohl der Film der Berlinale, der am meisten polarisiert hat – während der Vorstellung gab es seitens der Zuschauer einen andauernden Exodus, der je nach Moment des Verlassens entweder einem Gefühl großer Langweile oder großen Ekelns geschuldet war. Philip Grönings „Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ ist ein langsamer, verstörender Film, der quasi nahtlos Momente poetischer Schönheit mit Szenen brutalstem Unwohlfühlen nebeneinanderstellt und sogar stellenweise überlagert.
In 48 Stunden muss Elena ihre Philosophiekenntnisse in einer mündlichen Abiturprüfung unter Beweis stellen. Weswegen sie ihren Zwillingsbruder Robert aufsucht, der selbst durchgefallen ist, um ihr gegen alkoholische Bezahlung eine empirische Philosophiestunde zu halten, die vom Regisseur Gröning wiederholt wird.
Die beiden liegen deswegen während zwei Drittel der Spielzeit auf Kornfeldern und Wiesen unweit einer Tankstelle, welche nicht nur eine Bierreserve für Robert, sondern auch das soziale sowie das erzählerische Epizentrum dieser Tragödie darstellen wird. Zugegebenermaßen, die Prämisse eines Films, dessen sehr bedächtiger Anfang mithilfe von Heidegger-Zitaten voranschreitet, klingt besorgniserregend. Die intelligente Figurenzeichnung und ein erzählerisches Detail sorgen aber dafür, dass der Film (langsam) in Fahrt kommt: Elena, die eifersüchtig auf die Freundin ihres Zwillingsbruders zu sein scheint, wettet, sie würde bis zur Prüfung noch „mit wem schlafen“ und beginnt quasi sofort, jeden männlichen Tankstellenbesucher anzumachen.
In sehr schönen Plänen filmt Gröning, der auch Kameramann war, das gleichgültige Verrinnen der Zeit in der Natur – für den Menschen alleine kennzeichnet sich die Zeit durch das Warten, das Erwarten und folglich die Hoffnung.
David Foster Wallace hat im Kurzgeschichtenband „Oblivion“ geschrieben, das Gewissen sei der Albtraum der Natur. Gröning zeigt in seinem Streifen empirisch, dass das Gewissen als bewusstes Empfinden der Zeit albtraumhafte Konsequenzen haben kann.
Nach fast zwei Stunden kontemplativem, aber sehr schön gefilmten und außerordentlich gut gespielten Kinos bricht der Film mit seinem Ton und öffnet seine geschlossene Theoriewelt, um das Chaos hineinzulassen.
Kurz zuvor hat Robert Elena erklärt: Die Zukunft kann man beeinflussen, die Vergangenheit kann man nur kennen. Aber die Gegenwart kann man weder beeinflussen noch kennen. Wenn der Film dann Minuten später in die Tragik eines solchen puren Moments kippt, kehrt ein unbehagliches Gefühl der surrealen Entstellung ein, der auch daher leitet, dass die Geschehnisse, die in der Gegenwart uns auf uns zukommen, eigentlich immer Momente totaler Überraschung sind. Ein kleiner Bruch in der Routine, ein kleiner Riss in unserer normativen Zeitvorstellung (Routine und Wiederholung sind eigentlich ein Abschotten vor der Zeit), und wir stellen fest, dass wir nichts unter Kontrolle haben.
Hier merkt man auch, wie der Film in der ersten langen Hälfte die Lunte des Tragischen geschickt legt: Die Überlegungen über die Zeit, die Rivalität, das Aufbäumen einer orientierungslosen Lust, die Unbeständigkeit und die wilde Experimentierfreudigkeit der Jugend, das Wissen um das Verrinnen dieser Momente, das Gewissen um das baldige Ende einer Ära, das Unbehagen des Körpers, das sich mittels einer absoluten Simulation der totalen Selbstsicherheit manifestiert – all dies wird subtil in dem Zusammenspiel der Darsteller, dem Einflechten philosophischer Grundrisse und der semantischen Verdichtung eines spezifischen, symbolgeladenen Ortes (die Tankstelle) dargestellt.
Von Dieben und Hochstaplern

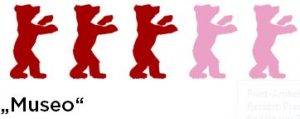
„Museo“ beginnt mit einer Off-Voice, die nostalgisch erzählt, wie skeptisch Juan, bester Kumpel des Erzählers, stets gegenüber dem Anspruch der Geschichtsschreibung, wahre Kenntnis zu erlangen, war. Wieso wollen uns die Geschichtsbücher weismachen, sie wissen, wieso diese oder jene historische Figur auf die eine oder die andere Art gehandelt hat, wenn wir selbst manchmal Schwierigkeiten haben, unsere eigenen Handlungen zu erklären oder zu legitimieren?
Ein Incipit als Paradoxon, bedenkt man, dass der Film uns anschließend die verblüffende, aber wahre Geschichte zweier ewiger Studenten erzählt, die das Nationalmuseum für Anthropologie von Mexiko-Stadt an einem Weihnachtsabend ausrauben – und sich danach auf den Weg nach einem potenziellen Käufer machen, um die Heiligtümer der Inka wieder loszuwerden.
Leider stellen die beiden fest, dass ihre relativ unüberlegte Handlung die gesamte Nation schockiert – überall in den Nachrichten macht sich die Gewissheit bereit, der Raub sei von einer professionellen, gerissenen Bande organisiert worden – und dass die gestohlenen Relikte unverkäuflich, da zu wertvoll und zu wiedererkennbar, sind. Was eine hektische, eigentlich tragische, aber angenehm leichtfüßig gefilmte Flucht nach vorne zur Konsequenz hat.
Der Film ist aber nicht nur ein gut gespieltes und clever inszeniertes Roadmovie, das sich bemüht, die wahren Begebenheiten so getreu wie möglich widerzuspiegeln: Zwei Aspekte verleihen „Museo“ zusätzlichen Tiefgang.
Zum einen wäre da die bereits am Anfang des Artikels angekündigte Thematisierung der Unmöglichkeit realer Geschichtsschreibung, da man die wahren Motivationen hinter menschlichen Handlungen schlicht nicht kennen kann. Ob man dafür aber das Ende der realen Geschichte zugunsten dramaturgischer Zwecke ändern musste, bleibt fragwürdig.
Zum anderen thematisiert der Film (zwar etwas oberflächlich) die Frage des rechtmäßigen Besitztums kulturellen Erbgutes – im Laufe einer hitzigen Diskussion mit einem möglichen Käufer wird darauf hingewiesen, dass viele Museen nur dadurch entstanden sind, weil man Sammlern, die das Erbgut einer Nation eigentlich mehr oder weniger illegitim entführt hatten, ihre (ethisch gesehen unrechtmäßigen) Besitztümer wieder abkaufte.


Vielleicht werden diese beiden Thematiken etwas zu wild und inkonsequent in das wilde Potpourri des Films geworfen – zum unterhaltsamen Denkanstoß reicht der Film trotzdem.
Die Wettbewerbsauswahl schloss mit „In den Gängen“, einem der schönsten Filme der 68. Berlinale, ab. Regisseur Thomas Stuber zeigt, wie der schüchterne, wortkarge Christian in einem Großmarkt eine Arbeit als Stapler in der Getränkeabteilung findet, Freundschaft mit seinem älteren Arbeitskollegen Bruno knüpft und sich in Marion aus der Süßwarenabteilung verliebt – die aber (unglücklich) verheiratet ist.
Obwohl das sich im Resümee genauso spannend wie Christians Job selbst liest, gelingt dem Film ein fesselndes Porträt einer Arbeiterklasse, die sich zwar nicht mehr als solche sieht (dafür fehlt mittlerweile die ideologische Solidarität), die nichtsdestotrotz aber zusammenhält. „In den Gängen“ zeigt schonungslos ein Leben in der ästhetischen und finanziellen Misere, ohne in die manchmal zu plakative Kritik des Social Realism noch in eine ästhetische Transzendenz zu verfallen.
Die Kamera zeigt die Hässlichkeit des Großmarktes, den Skandal der Lebensmittelverschwendung (all die kaum abgelaufenen Produkte, die im Mülleimer landen), aber auch die Mühe, mit der sich die Arbeiter durch Freundschaft und Vorstellungskraft das Leben aufbessern. Wenn Bruno, der Christian stoisch-zynisch durch die Arbeitswelt leitet, von den verschiedenen Fehden und Streitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Abteilungen um die limitierte Anzahl an Gabelstaplern erzählt, ist das sowohl trist als auch ermunternd: Es ist die Belastbarkeit dieser Figuren, ihr Humor und die Empathie, mit der das Drehbuch, die Schauspieler und der Regisseur ihr Leben darstellen, die den Streifen zu einem diskreten Meisterwerk machen. Ohne in das etwas Dösige eines Philippe-Delerm-Buches oder das Naive einer Amélie Poulain zu verfallen, gelingt es dem Film, die Simplizität als auch das Triste dieser Existenzen wertzuschätzen.
„In den Gängen“ ist ein delikater, behutsamer Film, der das graue Alltagsleben in Ostdeutschland zu keinem Zeitpunkt poetisiert, dem es aber trotzdem gelingt, zu bewegen.
Der Film kommt ohne große Worte aus, die kargen Figuren sind in dem Ausdrücken ihrer Gefühle unbeholfen, was die Momente der Emotionsausbrüche dann, ein bisschen wie in einem Roman von Kazuo Ishiguro, umso berührender macht.
„In den Gängen“ ging zwar bei der Preisverleihung der internationalen Jury leer aus, wurde aber von der ökumenischen Jury, in der Vesna Andonovic vom Luxemburger Wort teilgenommen hat, mit dem Preis für einen Wettbewerbsfilm ausgezeichnet.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können