13. November 2025 - 6.56 Uhr
RomanClarice Lispector – die geheimnisvolle Grande Dame der brasilianischen Literatur

Die Ich-Erzählerin von „Die Passion nach G.H.“ ist eine Bildhauerin in Rio de Janeiro. Als sie eines Tages das Zimmer ihres Dienstmädchens betritt, das kurz vorher gekündigt hat, findet sie dort rätselhafte Zeichnungen aus Kohlestrichen an der Wand – und eine riesige Kakerlake im Kleiderschrank. Die Bildhauerin zerquetscht das Insekt vor Ekel. Als Wiedergutmachung isst sie einen Teil des Breis, das aus der Kakerlake herausquillt. Es folgt eine Art philosophische Meditation über Transzendenz. Die Gedanken der Ich-Erzählerin erinnern mehr an eine Obsession als eine Passion, der Roman von Clarice Lispector an Franz Kafkas „Die Verwandlung“, G.H. an Gregor Samsa.
Ich wurde geboren, um zu schreiben“, . (…) Jedes meiner Bücher ist eine mühevolle und glückliche Premiere.
„Ich wurde geboren, um zu schreiben“, . (…) Jedes meiner Bücher ist eine mühevolle und glückliche Premiere. Diese Fähigkeit mich ganz zu erneuern, während die Zeit verstreicht, das nenne ich leben und schreiben.“ Im Alter von sieben Jahren schreibt Lispector ihre erste Erzählung. Geboren ist sie 1920 unter dem Namen Haia im ukrainischen Tschetschelnyk als dritten Tochter einer jüdischen Familie, die kurz nach ihrer Geburt vor den antisemitischen Pogromen floh – ihre Mutter Mania Krimgold war während eines Pogroms von Soldaten vergewaltigt und mit Syphilis infiziert worden – und mit den Kindern in den Nordosten Brasiliens emigriert. Die Familie ist arm, doch reich an Bildung, die Mutter stirbt früh, und Vater Pinchas zieht mit den Kindern von Recife (Pernambuco) nach Rio de Janeiro. Nach dem Abitur beginnt Clarice Lispector zu arbeiten, schreibt sich in die juristische Fakultät ein und arbeitet als Journalisten für eine Nachrichtenagentur sowie für die Zeitung „A Noite“. Sie heiratet den Studienkollegen und späteren Diplomaten Maury Gurgel Valente, den sie nach Europa und in die USA begleitet. Nach der Scheidung ließ sie sich mit ihren beiden Söhnen in Rio nieder.
In die Tiefe der Seele
Ihren ersten Roman „Perto do Coração Selvagem“ (Nahe dem wilden Herzen), der 1944 erscheint, übrigens ist der Titel ein Zitat von James Joyce, nimmt die Kritik begeistert auf. Das Buch ist eine Sensation. Damals herrscht in Brasilien die realistische und sozialkritische Literatur vor. Lispector setzt neue Maßstäbe. Ihre Art zu schreiben, ist eigenwillig. Sie geht dem Innenleben in einer bis dahin nicht bekannten Weise auf die Spur und verfeinert dabei ihre sowohl stilistischen als auch erzähltechnischen Stilmittel. Ihre Texte sind oftmals handlungsarm, nicht selten Miniaturen, wurden aber umso mehr „Tiefenbohrungen“ in die menschliche Seele genannt. Mit „A maçã no Escuro“ (1961, Der Apfel im Dunkeln) setzt sie den Erfolg fort. Die Autorin erhält für ihre Werke mehrere Preise. Sie schreibt Romane sowie Kurzgeschichten und Erzählungen wie etwa „Laços de Familia“ (1960), veröffentlicht Essays und Kinderbücher ebenso wie Kolumnen in der Zeitung „Jornal do Brasil“, die posthum in dem Band „A Descoberta do Mundo“ (Die Entdeckung der Welt) erschienen. 1977, im Jahr ihres Todes, veröffentlicht sie ihren letzten Roman „A Hora da Estrela“ (Die Sternstunde) – später von Suzana Amaral verfilmt und bei der Berlinale ausgezeichnet.
In ihrem letzten Interview antwortet Clarice Lispector auf die Frage nach der Aufgabe des Schriftstellers mit den Worten „zu schweigen“. Neben der Besonderheit ihres Stils ist es vor allem ihre einzigartige Weise, die Alltagsrealität zu beobachten, die sie in eine Atmosphäre des Geheimnisvollen und Magischen hüllt. Der Lyriker Carlos Drummond de Andrade schrieb nach ihrem Tod: „Clarice kam aus einem Geheimnis, ging fort in ein anderes.“ Ihr gesamtes Werk kreise um das Spannungsverhältnis der menschlichen Existenz zwischen Realität und seelischer Erfahrung. Emotionale Krisen oder sogar scheinbar unwichtige Vorgänge führten zur plötzlichen Erkenntnis über die Wahrheit des Seins. Der Preis für die Freiheit und die Einsicht in die Absurdität des Universums sind Vereinsamung und Isolation. In „Cidade Sitiada“ (1949), entstanden während eines Aufenthalts in Bern, geht es um eine Frau aus der Vorstadt, die bei der Verwirklichung ihrer Lebensziele – Ehe und Geld – eine körperliche Leere verspürt, bis sie die Welt poetisch und fantastisch und doch realer als die provinzielle Wirklichkeit erfährt. Das Buch habe sie gerettet, bekennt die Autorin später. 1959 kehrt sie nach Stationen als Diplomatengattin in Italien, Großbritannien, der Schweiz und den USA und ihrer Scheidung definitiv nach Brasilien zurück.

Der nun zum zweiten Mal auf Deutsch veröffentlichten Roman „A Paixão Segundo G.H.“, 1964 im Original erschienen, handelt von einer Hausfrau, die sich ihrer Einsamkeit bewusst wird. „Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres“ (1969) ist der innere Monolog einer Frau, die sich ihrer Ängste bewusst wird, in „Agua Viva“ (1973) führt das Schreiben zur Befreiung und zur Entdeckung der „vierten Dimension“ der Persönlichkeit. Schreiben kann neue Realitäten freisetzen, wie etwa in „O Sopro da Vida“ (1978). Das Buch erscheint im Jahr nach ihrem Tod. Die Autorin war kurz vor ihrem 57. Geburtstag an Krebs verstorben.
Ihr Werk wurde zwar in mehrere Sprachen übersetzt, im deutschen Sprachraum dauerte aber eine Zeit lang, bis ihr Werk gebührend gewürdigt wurde. Dazu beigetragen hat nicht zuletzt die Biografie von Benjamin Moser („Why this world?“, 2009), der sie als mystische Melancholikerin bezeichnet und einige Neuübersetzungen ins Deutsche in den vergangenen Jahren, so zum Beispiel des Romans „Der große Augenblick“ (2019) und die beiden Bände ihrer „Sämtlichen Erzählungen“ (2020) sowie Kurzgeschichten unter dem Titel „Ich und Jimmy“ (2022), ebenso ihrer Kolumnen 1946 bis 1977 im Jahr 2023. Diese „Crônicas“ können als typisch brasilianische Literaturgattung bezeichnet werden. Sie handeln von alltäglichen Begebenheiten aus ihrem Leben in Rio de Janeiro, von Begegnungen, Konzert- und Kinobesuchen, aber auch von ihrem Schreiballtag. Sie geben einen Einblick in Lispectors Stil, der leichtfüßig wirkt und sowohl humorvoll als auch pointiert ist, aber auch von sprachlicher Ausdrucksvielfalt zeugt, abrupte Wendungen und Perspektivwechsel. Nicht zuletzt demonstrieren sie die Finesse der Autorin zwischen Intuition und ästhetischer Reflexion: „Merken Sie, wie unbekümmert ich schreibe? Ohne viel Sinn, aber unbekümmert. Wen schert schon der Sinn? Der Sinn bin ich.“
Merken Sie, wie unbekümmert ich schreibe? Ohne viel Sinn, aber unbekümmert. Wen schert schon der Sinn? Der Sinn bin ich.“
Oftmals wurde Lispector als unpolitische Schriftstellerin bezeichnet. Sie hält sich zwar in ihren Einlassungen gegen die brasilianische Literatur zurück, setzt sich aber für bessere Bildungschancen der ärmeren Bevölkerungsschichten und für die indigene Bevölkerung ebenso ein wie gegen die Kinderarmut. Ihre Ausdrucksweise bleibt subtil. Auch wenn sie oft als schwer fassbar und in ein mysteriöses Dunkel gehüllt erschien, „halb Göttin, halt Raubtier“, wie ein Rezensent einmal schrieb. Vom französischen Feminismus wurde sie vereinnahmt, verglichen sowohl mit Marguerite Duras als auch mit Virginia Woolf. Die in den vergangenen Jahren auf Deutsch erschienenen Bände wie „Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau“ und „Aber es wird regnen“ geben Zeugnis von ihrer Meisterschaft in der kurzen literarischen Form. Lispector mochte das Unabgeschlossene. Der türkische Autor Orhan Pamuk nannte sie „eine der geheimnisvollsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts“. 1975 nahm sie am ersten „Weltkongress der Hexerei“ teil. Zu ihrer jüdischen Identität äußerte sie sich lange nicht, in den „Estado Novo“ von Präsident Getúlio Vargas (1930-1945) durften ab 1937 keine Juden mehr einreisen.
Mysteriöses Dunkel
Der Penguin-Verlag hat mit der Veröffentlichung ihrer Werke den deutschsprachigen Lesern neu zugänglich gemacht. Auch wenn der Übersetzer Luis Ruby seine Arbeit an „A Paixão Segundo G.H.“ als Zumutung beschrieb, ist es ihm gelungen, den Kosmos der Schriftstellerin sichtbar zu machen. In einer ihrer Erzählungen heißt es: „Morgens in der Küche sehe ich auf dem Tisch das Ei. Ich erblicke das Ei mit einem einzigen Blick. Auf der Stelle merke ich, dass man ein Ei nicht dauerhaft ansehen kann. Ein Ei anzusehen, hält nie bis in die Gegenwart: kaum sehe ich ein Ei an, wird daraus, dass man ein Ei schon vor drei Jahrtausenden angesehen hat. Sobald man ein Ei ansieht, ist es die Erinnerung an ein Ei.“ Rilke habe 24 Gedichte über eine Rose geschrieben, bemerkte Hélène Cixous, „aber Clarice Lispector lässt uns das stille Atmen einer Rose erleben.“
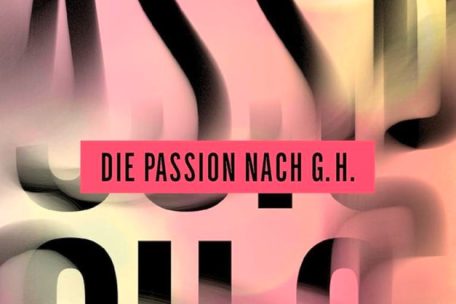
Clarice Lispector: Die Passion nach G.H. Aus dem Portugiesischen von Luis Ruby. Penguin Random House. München 2025. 228 Seiten. Etwa 25 Euro.

 De Maart
De Maart




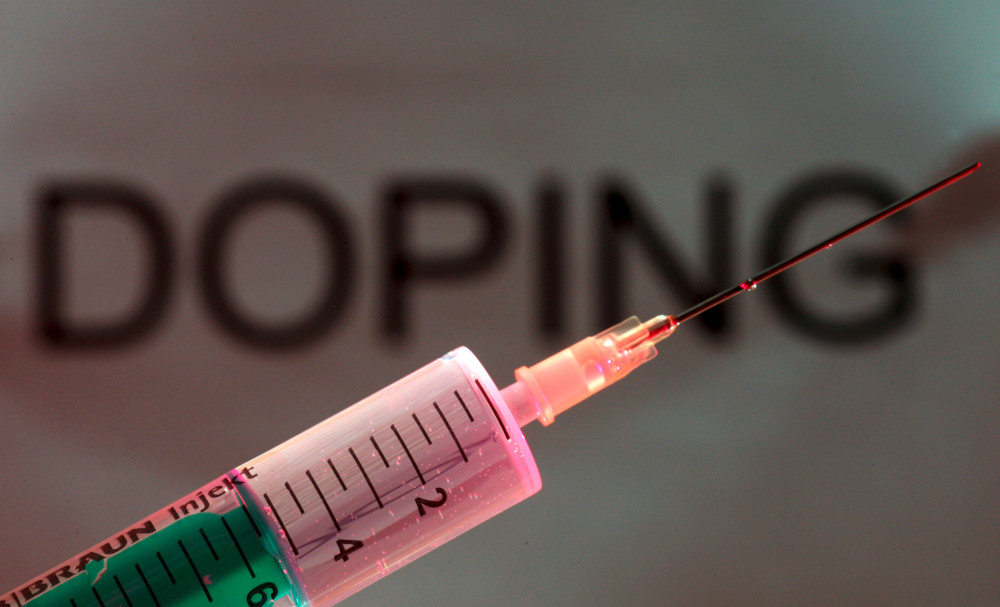



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können