Von Kai Florian Becker
Am Samstagabend absolvierten Jason Williamson und Andrew Fearn den letzten Auftritt ihrer aktuellen Europatournee. Laut Steve Underwood, ihrem Manager, Merchandise-Verkäufer und Chef ihres früheren Labels Harbinger Sound, war es an der Zeit, dass Band und Crew eine Auszeit bekommen. Zu Letzterer zählte das ehemalige Bandmitglied Simon Parfrement. Der fuhr auf dieser Tour den Van, was nicht als Degradierung zu verstehen ist. Er ist ein fester Teil der Sleaford-Mods-Familie geblieben.
Denn er war es, der Williamson 2006 zu Sleaford Mods animierte. Kurz darauf begann dieser dann – unter den Einflüssen von mitunter dem Wu-Tang Clan und Mike Skinner alias The Street –, seine Frustration über schlecht bezahlte Jobs und andere Alltagsbeobachtungen mit Roni-Size-Samples zu unterlegen. Das war die Initialzündung für die Sleaford Mods. 2009 kam besagter Fearn hinzu; drei Jahre später stieg Parfrement aus, blieb aber als Fahrer, Medienproduzent und Fotograf dabei. Verrückte Geschichte.
Verrückte Vorband
Verrückt war auch die Performance der Vorband Massicot. Das All-Girl-Trio aus der Schweiz klinge laut Underwood, der die drei Damen ebenfalls unter Vertrag hat, wie die holländische Band The Ex. Mara Krastinas kleiner, roter Bass, der einem Spielzeuginstrument ähnelte, klang allerdings wie der von Les Claypool (Primus). In diesen Frickel-Bass-Sound mischte sich der experimentelle Noiserock von Sonic Youth und verspielter, an Tortoise angelehnter Postrock. Das war so gar nicht die Musik, die man im Vorprogramm der Sleaford Mods erwartet hätte. Andererseits eine interessante und letztlich gelungene Wahl.
Danach wurden alle Instrumente weggeräumt, vier mit Kabelbinder festgezurrte Getränkekisten auf der linken Bühnenseite platziert, darauf ein Laptop gestellt und nebendran ein Mikrofon mit Ständer. Fertig. Kurze Pause, Licht aus und die einzigartige Zwei-Mann-Show konnte beginnen. Sleaford Mods loteten die Definition einer Low-Budget-Show neu aus. Aber das zählt nicht bei der Bewertung eines Konzerts. Es sind nicht der Aufwand, die Kosten oder die Manpower, die eine Show ausmachen, sondern deren Wirkung und Einzigartigkeit. Und da lagen die Sleaford Mods am Samstag ganz weit vorne.
Keine Spur von Müdigkeit
Kaum knallten die ersten Beats aus den Lautsprechern, schon strömten die Besucher vom Hof nach drinnen und füllten den Innenraum zu drei Vierteln. Wie auf Knopfdruck war das Atelier mit Leben erfüllt. Dabei gab es auf der Bühne fast nichts zu sehen. Fearn, der Mann, der alle paar Minuten auf die Tastatur des mit Aufkleber vollgepappten Laptops drückte, hatte – also zu 99 Prozent der Zeit – seine Hand in der Hosentasche, hielt mit der anderen eine Bierflasche und schunkelte und wippte hin und her oder zuckte mit seinem ganzen Körper. Vereinzelt hatte er auch Lust, mitzusingen – ohne Mikrofon jedoch, wie ein Fan, der die Bühne geentert hatte (siehe „TCR“).
Sein Genialer Partner Williamson sah derweil selten in Richtung Publikum, während er seine herrlich wütenden Verse losfeuerte. Mit geschwellter Brust, einem Arm auf dem Rücken, sprechsang er sich in Rage. Es hätte auch der Bruder von Liam Gallagher sein können. Brillant! Wenn weniger mehr ist, dann ist weniger Sleaford Mods. Was nicht für Williamsons Texte gilt. Seine Wutreden füllen Seiten (siehe „Just Like We Do“). Sleaford Mods, das ist die britische Arbeiterklasse in Reimform. Das Publikum feierte sie laut. Für die letzte Show einer Tour eine großartige Leistung. Von Müdigkeit war keine Spur zu sehen.

 De Maart
De Maart






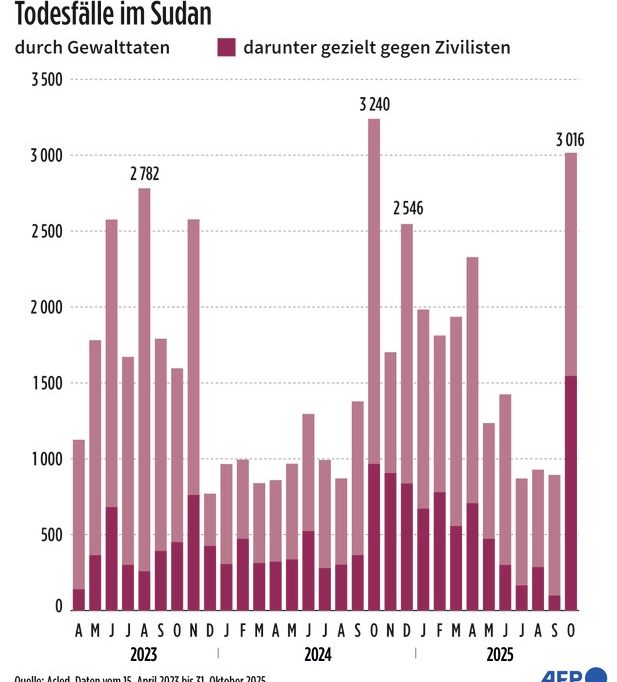
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können