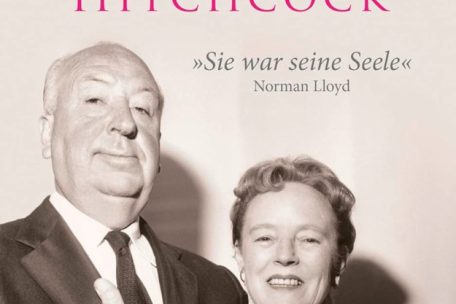
Mindestens zwei Seiten des Ruhms
Alfred Hitchcock (1899-1980) gehört selbst jetzt noch, 45 Jahre nach seinem Ableben, zu den größten Filmregisseuren überhaupt. Zwar fand gelegentlich der Einfluss seiner Ehefrau Alma Reville (1899-1982) auf sein Werk Erwähnung, aber erst Thilo Wydra hat mit seiner im letzten Jahr erschienen Doppelbiografie den Versuch unternommen, beide an Bedeutung auf eine Stufe zu stellen.
Hitchcock lernte seine spätere Frau in den frühen 1920er Jahren in den Filmstudios des Londoner Stadtteils Islington kennen. Er war ein Grafiker, der die für den Stummfilm so notwendigen Zwischentitel entwarf, sie damals bereits ein alter Hase im Filmgeschäft. Als Kind wurde Alma Reville schon von ihrem Vater, der im Kostümfundus der Twickenham-Filmstudios beschäftigt war, mit zur Arbeit genommen. Dort lernte sie ab 1915, quasi von der Pike auf, das Filmemachen kennen. Zuerst als Mädchen für alles, dann als Scriptgirl bzw. die Fachkraft, welche auf die Continuity, also auf die Anschlüsse zwischen den Einstellungen achtet, und schließlich als Cutterin und Drehbuchautorin. Alfred Hitchcock sollte zeitlebens behaupten, dass Alma so viel mehr vom Film verstünde als er. Weshalb sie dann auch in den Produktionen, die er zu verantworten hatte, praktisch in jeder Phase des Prozesses entscheidendes Mitspracherecht hatte. Auch Thilo Wydra kolportiert in seinem Buch „Alma und Alfred Hitchcock: Eine Liebe fürs Leben“ jene Abnahmevorführung von Hitchcocks „Psycho“-Schocker (1960), als seine werte Gattin mit untrüglichem Blick erkannte, was alle anderen bei den Dreharbeiten wie in der Postproduktion übersahen: Die Leiche in der Dusche blinzelte noch! Also musste umgeschnitten, Aufnahmen des abfließenden Wassers dazwischen montiert werden, um den Missstand zu beheben.
Alma und Alfred Hitchcock lebten ein im Grunde sehr zurückgezogenes Leben. Mit ihrer 1927 geborenen Tochter Patricia bildeten sie eine im bürgerlichen Sinne typische Kleinfamilie, die sich selbst nach dem Umzug der Briten Ende der 1930er Jahre nach Hollywood genau so verhielten. Man wohnte bescheiden, ohne den für Filmleute in Kalifornien so typischen Swimmingpool oder Tennisplatz (obwohl sie sich den Luxus hätten leisten können). Gäste wie Grace Kelly, Hitchcocks Lieblingsschauspielerin und spätere Fürstin von Monaco, mussten mit ihrem hochadeligen Gatten in der Küche essen, weil es keinen Dining Room gab. So einfach der mit Kinohits wie „The Lodger“ (1927) oder „Die 39 Stufen“ (1936) berühmt gewordene Regisseur privat auch lebte, so ausgebufft war er in beruflicher Hinsicht. Beispielsweise gründete er bereits in den 1930er Jahren eine Firma, die sich um seine Publicity kümmerte. In Hitchcocks „goldenem Jahrzehnt“, den 1950ern, in denen Klassiker wie „Das Fenster zum Hof“ und der seinerzeit verkannte „Vertigo“ entstand und das mit „Psycho“ auch kommerziell für den Regisseur höchst profitabel endete, wurde Hitchcock zu einer Marke, die mit dem Schattenriss seiner imposanten Figur beworben wurde.

Es ist dem Autor Thilo Wydra hoch anzurechnen, dass er sich den vor allem nach dem „Psycho“-Erfolg und den Beschwerden der Schauspielerin Tippi Hedren über die Dreharbeiten zu dem Film „Die Vögel“ (1963) aufkommenden Gerüchten um den Regisseur als misogynem Lustmolch (die seit Donald Spotos Hitchcock-Biografie aus den 1980ern wie Tatsachen behandelt wurden) beherzt entgegentritt. Nicht nur die entsetzten Angehörigen werden zur Ehrenrettung herbeizitiert, sondern auch Umstände, die ihn alles andere als frauenfeindlich dastehen lassen. Die Produzentin Joan Harrison wäre als Beispiel zu nennen, die durch den Regisseur und seine Ehefrau gefördert wurde – und nicht zuletzt Alma Reville selbst, die von Zeitgenossen als freundlich und zurückhaltend, nichtsdestotrotz aber als eine ausgesprochen eigenständige Persönlichkeit beschrieben wurde.
Trotz einiger Fahrlässigkeiten wie etwa den Unfalltod, den der Autor der britischen Schauspielerin Madeleine Carroll 1942 andichtet, ist Wydras Doppelbiografie empfehlenswert, weil er sich auch um einen Umstand kümmert, der bislang wenig beleuchtet wurde: die Abhängigkeit der Hitchcocks von Filmproduzenten und Verleihern nämlich. Da mehrere Versuche, sich unabhängig zu machen, nicht zum erhofften Ergebnis führten, blieb Alfred Hitchcock über Jahrzehnte ein Auftragsregisseur der Filmstudios, bei denen er unter Vertrag stand. Dass er oft genug Filme drehen musste, zu denen er keine Lust hatte, ist deshalb ein Faktum, das geradezu dramatisch wenig zu dem Weltruhm passt, den der Regisseur über seinen Tod hinaus erlangte!
Thilo Wydra: „Alma und Alfred Hitchcock: Eine Liebe fürs Leben“, Heyne Verlag, München 2024. 496 S.
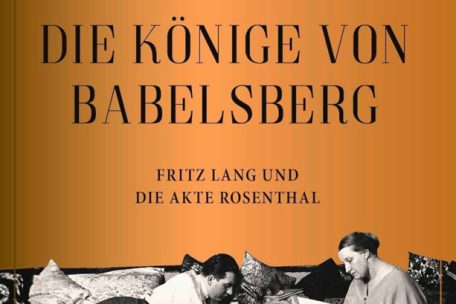
Dem Vergessen anheimgefallen
Am frühen Morgen des 26. September 1920 wird Elisabeth Rosenthal, die Ehefrau des Filmregisseurs Fritz Lang, in deren gemeinsamen Wohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg erschossen aufgefunden. Die Polizei geht von Selbstmord aus. Doch der ermittelnde Kommissar hat seine Zweifel, die maßgeblich durch die Untersuchungsergebnisse der Pathologie gestützt werden. Denn diese widersprechen den Aussagen von Fritz Land und seiner zukünftigen Gattin, der Schriftstellerin Thea von Harbou, die sich beide zum Todeszeitpunkt von Elisabeth Rosenthal als einzige Zeugen in der Wohnung aufhielten. „Die Harbou log. Oder sie erinnerte sich falsch“, konstatiert Polizeikommissar Beneken, und: „Fritz Lang log. Oder er erinnerte sich falsch. Niemals aber erinnerten sich zwei Zeugen in der gleichen Weise falsch. Zweifellos hatten sie sich abgesprochen.“
Und so geht es in Ralf Günthers historischem Kriminalroman „Die Könige von Babelsberg“ darum, herauszufinden, weshalb die Zeugen „der Verwirrung den Vorzug vor der Erklärung“ gaben. Etwa zur Hälfte des Buches hin kommt es zu einer überraschenden erzählerischen Exkursion: Außerhalb seiner Dienstzeit trägt Polizeikommissar Beneken probeweise Damenstrümpfe unterm Gehrock und es drängt ihn als Tänzerin auf die Bühnen des sündigen Berlins der anbrechenden 1920er Jahre. Gleichzeitig wird der Druck durch Vorgesetzte auf den braven Mann, der stets meint, er müsse seine Pflicht als Ermittler „ohne Ansehen der Person, des Geschlechts, der Religion, der politischen Orientierung“ erfüllen, immer größer. Denn Fritz Lang und Thea von Harbou sind Teil einer neuen, mächtigen Elite. Und die will, dass die Ermittlungen um den Tod von Elisabeth Rosenthal, wenn nicht eingestellt, so doch im Sande verlaufen sollen. „Berühmte Leute, Filmleute. Die haben Spezialregeln“, meint der Pathologe beschwichtigend. Aber Beneken will sich nicht korrumpieren lassen.

Im realen Leben hat Fritz Lang seine Vita mit immer neuen, fantasievollen Details ausgeschmückt – aber seine erste Ehefrau nach deren Tod nie wieder erwähnt. Auch Thea von Harbou schwieg sich zeitlebens über die wahren Begebenheiten an jenem Morgen des 26. September 1920 beflissentlich aus. Von daher kann man Ralf Günthers Roman in gewisser Weise als Ehrenrettung verstehen. Ihr Tod wurde nie aufgeklärt, die Ermittlungsunterlagen sind tatsächlich verschwunden. Gäbe es Günthers „Könige von Babelsberg“ nicht, könnte man meinen, Elisabeth Rosenthal hätte nie existiert.
Ralf Günther: „Die Könige von Babelsberg: Fritz Lang und die Akte Rosenthal“, Kindler Verlag, Hamburg 2024. 272 S.

 De Maart
De Maart







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können