In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Unsere Musikspezialisten haben sich diese Woche die neuesten Alben von E.S.T., Leon Bridges, Toundra, Rolo Tomassi und Snow Patrol angehört. Ihre Bilanz fällt von austauschbar bis fantastisch sehr gemischt aus.
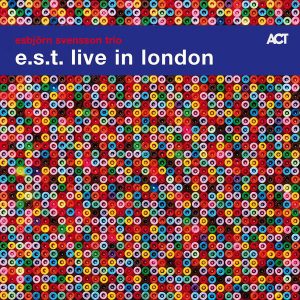
Von einem anderen Stern
von Gil Max

Eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 2005 erinnert schmerzhaft an den Verlust eines der innovativsten Musiker der Jahrtausendwende, dessen Band eine weitere Facette seiner Genregrenzen überschreitenden Spielkunst zeigt.
„Sweden: 10 points“, das sind die Schweden vom Grand Prix de l’Eurovision ja hinlänglich gewohnt. Für mich allerdings ist es der erste „Zehner“, den ich vergebe, seit es diese Rubrik gibt. Irgendwie, habe ich mir bislang eingeredet, ist immer eine Verbesserung möglich und absolute Vollkommenheit höchst selten anzutreffen. Man stößt heute ja kaum noch auf makellose Meisterwerke wie „Kind of Blue“, „Astral Weeks“ oder „Dark Side of the Moon“.
Es sei denn, man legt diesen Live-Mitschnitt des Esbjörn Svensson Trios auf, dessen Leader exakt vor einer Dekade, nämlich am 14. Juni 2008, bei einem Tauchunfall in den Schären vor Stockholm ums Leben kam. Das nun erstmals erschienene „Live in London“ zeigt die Band auf der Höhe ihres Schaffens und kann auf eine Stufe mit ihrem anderen famosen Konzertdokument „Live in Hamburg“ gestellt werden.
Bis auf das unvermeidliche „Behind the Yashmak“, mit dem man jahrelang den Fans gegen Ende der Shows den Rest gegeben hat, spielte sich die Band hier, zwei Jahre vor Hamburg, durch eine völlig andere Setlist, so dass sich beide Alben hervorragend ergänzen. Alles, was man an dieser Formation liebt, ist da: zum Beispiel die prägnanten Melodielinien, die in langen Schleifen exzessiv gesteigert werden und eine Art hypnotische Wirkung erzielen. So hypnotisch, dass das Publikum im Anschluss an „The Unstable Table & the Infamous Fable“ erst nach einem „Dead Calm“ von geschlagenen 13 Sekunden in der Lage ist, Beifall aufbranden zu lassen.
Auch die integrierten Elemente aus Klassik, Pop, Electro, die den Jazz von e.s.t. so spannend und den Sound der Band so einzigartig machen, sind vorhanden. Bassist Dan Berglund schmuggelt gar Metal-Passagen ins e.s.t.-Spiel, wenn er seinen Kontrabass so stark verzerrt, dass er wie eine E-Gitarre mit gehörig Distortion klingt. An der Debatte, ob dies überhaupt noch als Jazz bezeichnet werden könne, haben sich die drei Schweden nie beteiligt. Drummer Magnus Öström meinte zu diesem Thema einmal: „Drei Individualisten bringen ihre Erfahrungen und Vorlieben auf einen Nenner. Nennt es einfach e.s.t-Musik. Wir können damit leben.“
Ebenso gelassen reagierten sie im Frühjahr 2006, als das amerikanische Jazz-Magazin Downbeat e.s.t. als erste europäische Band aufs Cover nahm mit der Schlagzeile „Europe Invades!“, was heftige, teils wütende Reaktionen, vor allem von US-Musikern, hervorrief. Dazu noch mal Öström: „Wir nehmen ihnen ihre Identität nicht weg. Wir schaffen uns vielmehr eine eigene. Jazz ist längst kein rein amerikanischer Besitz mehr, er hat sich globalisiert.“
Wer diese Musik nicht für Jazz hält, sollte sich mal das Pianosolo von „Eighty-eight Days In My Veins“ anhören; Bill Evans hätte seine Freude daran gehabt. Oh ja, Esbjörn fehlt!
ANSPIELTIPPS: Eighty-eight Days In My Veins, When God Created the Coffeebreak

Ein gutes Ding
von Tom Haas

2015 hat ein Freund mir zum Geburtstag „Coming Home“, das Debüt von Leon Bridges, geschenkt. Ich war damals Feuer und Flamme – das Album war die schönste Hommage an die Granden des Soul wie Curtis Mayfield oder Sam Cooke, die mir bis dato untergekommen war. Die Produktion spielte bis ins letzte Detail verliebt mit der Ästhetik der frühen 60er, der Klangfilter, das Knirschen und Knacken, es war perfekt. Der Künstler war anscheinend im goldenen Jahrzehnt des Soul in Kälteschlaf versetzt und jetzt wieder aufgetaut worden.
„Good Thing“ hinterließ nach dem ersten Hören ein flaues Gefühl im Magen – der Sound war unerwartet glatt, mehr Ne-Yo als Marvin Gaye. Aber der Entschluss, dem Album eine zweite Chance frei von Erwartungen zu geben, hat sich selten so sehr ausgezahlt. Bridges hat sich entwickelt, von einer Epigone zum eigenständigen Künstler. Die Retrospektive des Erstlings vermischt sich auf dieser Platte mit dem Aktualisierungsanspruch eines Musikers, der sich traut, eigene Akzente zu setzen und ein individuelles Klangbild zu entwerfen.
Herausgekommen ist ein vielschichtiges Werk, das von Jazz („Bad Bad News“) über Funk („If It Feels Good“) und R’n’B („Beyond“) hin zu Tracks wie „Forgive You“ reicht, das fast schon dem Indiepop zuzuordnen ist. Das Bindeglied beim Tanz zwischen den Genres ist die warme Soulstimme von Bridges, die er selbstsicher zum Leitmotiv der Gesamtkomposition stilisiert und die im Vergleich zum Vorgänger an Reife gewonnen hat. Auch die Instrumente kommen abwechslungsreicher zum Einsatz, vor allem die Percussions stechen teilweise durch ein sehr eigenwilliges Spiel hervor.
Trotzdem bleibt das Gefühl, dass der letzte Schliff, die letzte Politur dieses Diamanten vielleicht nicht nötig gewesen wäre. Der Weggang vom klassischen Retro-Soul hat unweigerlich die Blüten des zeitgenössischen Pops knospen lassen, was dem Album streckenweise nicht allzu gut tut – ein bisschen mehr Traditionsbewusstsein und Streichereinsatz wie bei der Eröffnung hätte dem Werk besser zu Gesicht gestanden. So ist das Resultat ein stabiles Album eines guten Künstlers geworden – „Good Thing“ ist vielleicht ein Zwischenschritt nach dem beachtlichen Debüt und dem hoffentlich folgenden Meisterwerk.
ANSPIELTIPPS: Bad Bad News, From Georgia to Texas

Desert Sessions
von Jeff Schinker

Toundra sind eine Postrock-Band aus Spanien und liefern seit mehr als einer Dekade mit bewundernswerter Unauffälligkeit ausgezeichnete Alben. Mit „Vortex“ gelingt ihnen ein weiterer großer Wurf, der die potenziellen Flauten des Genres gekonnt umschifft. Wenn sie sich lediglich der klassischen Trinität der Rockmusik (also Bass, Gitarre und Schlagzeug) bedient, läuft instrumentale Musik immer die Gefahr, irgendwann in einer Art belanglosem Leerlauf zu enden, da sie die Wiederholungsschleifen der Riffs nicht durch eine kraftvolle Stimme und/oder starke Texte wettmachen kann. Viele Postrock-Bands greifen deswegen auf Synthies und Beats zurück, um mit Atmosphäre und Vielfältigkeit zu punkten. Russian Circles sind mitunter eine der wenigen Bands, die mit dem oben erwähnten instrumentalen Dreigespann vollends überzeugen.
Toundra, die vor zwei Wochen im städtischen Café „Rocas“ aufgetreten sind, verstehen es, dank progressiver, lang gezogener, intensiver Kompositionen, toller Riffs und Gitarren, die Melodien zu tragen vermögen und so die Abwesenheit des Gesangs effizient kaschieren, an diese Kultband anzuknöpfen. Auf ihrem vierten Album (das erste, das nicht schlicht numerisch betitelt wurde) sind die Tracks zwar lang, aber dennoch äußerst kompakt. Es wird nicht eigenbrötlerisch gefrickelt, um zu zeigen, wer der beste Gitarrist ist – jedes Riff bedient den Song.
Daraus resultieren dann starke, unheilvolle und staubige Tracks wie das sich zu einem Riffgewitter hochtürmende „Cobra“, in das der Opener „Intro Vortex“ mündet, oder das ebenso mitreißende „Tuareg“. Herzstück der Platte ist aber das schön verschachtelte „Mojave“, das wie ein ruhiger Tool-Track beginnt, um dann subtil die verschiedenen Songteile, die von einem beeindruckenden Einfallsreichtum zeugen, nahtlos ineinander übergehen zu lassen. Vielleicht stellt sich bei weniger dringlichen Kompositionen wie „Kingston Falls“ dann manchmal doch eine gewisse Monotonie ein, empfehlenswert ist die Platte aber durchaus.
ANSPIELTIPPS: Cobra, Mojave, Tuareg

Gegen den Tag
von Jeff Schinker

Rolo Tomassi liefern mit ihrem fünften Album „Time Will Die And Love Will Bury It“ ein dunkles Meisterwerk an der Schnittstelle zwischen Prog und Postcore. Nichts für zarte Gemüter – denen entgehen aber Momente schillernder Schönheit und unheimlich knackige Riffs.
Wer Rolo Tomassi nicht kennt und die Band zum ersten Mal hört, wird unweigerlich glauben, das Quintett hätte zwei Sänger – ein zierliches Mädchen, das elegant über die Gitarrenläufe und Staccati singt und, wie das Klischee es so will, ein etwas schwerfälliger, meist bärtiger Mann, der ins Mikrofon brüllt und grunzt. Wer die Band aus Sheffield dann zum ersten Mal live erlebt, dürfte nicht schlecht staunen – und ab dann voreilige Gender-Kategorisierungen hinterfragen.
Eva Spence vereint nämlich beide Gesangsstile in einer Person – und dürfte sich so mit ihren eindrucksvollen Klangspagaten als Pendant zum Tausendsassa Mike Patton (Faith No More, Mr. Bungle, am Dienstag in der Rockhal mit Dead Cross) positionieren. Die Parallele kommt nicht von ungefähr, da Rolo Tomassi zum Teil an eine etwas weniger brachiale, experimentellere Version von Dillinger Escape Plan, wo in deren frühen Tagen Mike Patton ja auch mitwirkte (aber bei welcher Band hat Mike Patton eigentlich nicht mitmusiziert?), erinnern.
Sieht man von dieser gesanglichen Gegebenheit, die der Band wohl lange den Ruf eines Kuriositätenkabinetts einbrachte und von der eigentlichen Musik ablenkt, ab, stellt man fest, dass „Time Will Die And Love Will Bury It“ das wohl am besten durchdachte Album ihrer Karriere ist. Im Gegensatz zu früheren Alben gibt es hier reichlich Zeit zum Durchatmen. Sogar die richtig krachigen Songs, auf denen Eva Spence brüllt, was das Zeug hält, öffnen sich gegen Ende für Harmonie und Wohlklang: So endet „Balancing the Dark“, das mit seinem fräsenden Bass bis ins Mark geht und an die Hardcore-Band These Arms Are Snakes erinnert, mit versetzten Jazz-Drums und verträumten Fender-Rhodes-Klängen. Das derbe „Alma Mater“ kulminiert seinerseits in einen schönen Gesangspart. Ja, sogar bei dem erbarmungslosen „Rituals“ entdeckt man nach mehrmaligem Durchlauf schöne Klavier-Arpeggios inmitten des Krachs.
Die Laut-leise-Dynamik, die von einer Band wie den Pixies entwickelt wurde, wird hier zu einem Pendeln zwischen den Extremen. Teilweise sorgt ein solches Wechselbad im Laufe der progressiveren Songs für ordentliche Tempi- und Intensitätswechsel, teilweise werden die sanften und krachigen Passagen aber auch auf die Songs verteilt. So wird nach dem Ambient-Intro („Towards Dawn“) ein lupenreiner Poprock-Song geboten („Aftermath“), bevor Eva Spence dann auf „Rituals“ keine Lust mehr auf nett hat.
Am eindrucksvollsten sind aber die Tracks, auf denen die beiden Identitäten der Band innerhalb einer lange gesponnenen Komposition aufeinandertreffen (so geschehen auf den ausgezeichneten „The Hollow Hour“ und „A Flood of Light“) – weil hier die dichte, sumpfige Dunkelheit der Platte immer wieder von Licht durchdrungen wird.
ANSPIELTIPPS: The Hollow Hour, Aftermath, Alma Mater, A Flood of Light

Die Tyrannei der Balladen
von Jeff Schinker

Snow Patrol sind nach sieben Jahren mit ihrem neuen Album „Wildness“ zurück. Dass niemand gemerkt hat, dass sie so lange weg waren, sagt viel über die Schnelllebigkeit der zeitgenössischen Musikindustrie, aber auch über die Qualität dieser doch sehr austauschbaren Band aus.
Das neue Album soll durch eine stilistische und thematische Kursänderung herausstechen – Sänger Gary Lightbody behandelt nun persönliche Themen wie die Demenz seines Vaters. Die Songs klingen aber nach wie vor wie Stadionhymnen und resümieren so eines der großen Paradoxe der Popmusik: Um authentisch zu klingen, muss der Musiker so nah wie möglich am Leiden des lyrischen Ichs kleben, um Erfolg zu verbuchen, muss dies aber in mitsingbare Melodien eingepackt, von stampfenden Beats untermalt und geschrammtem Einheitsbrei auf der Gitarre begleitet werden.
„Heal Me“ klingt wie ein weniger pompöser U2-Abklatsch, die Lyrics im Opener „Life On Earth“ („Shouldn’t need to be this fucking hard/It’s just life on earth“) spiegeln die Simplizität (sprich: Langeweile) des Songs getreu wieder. „What If This Is All the Love You Ever Get?“ ist eine Feuerzeug-Ballade, die so langweilig ist, dass man riskiert, bei seiner Live-Aufführung einzunicken und so die Haare der herumstehenden Fans anzuzünden.
Songs wie „Don’t Give In“ oder „A Dark Switch“ versuchen, mit der Tyrannei der Balladen, mit der diese seichte Platte ständig kämpft, zu brechen, klingen dann letztlich doch etwas platt. Furchtbar schlecht ist das, was Snow Patrol hier während der zehn Songs abziehen, nicht. Die Wahrheit ist noch ernüchternder: Ihre Musik ist einfach herzlich egal.
HÖRT DOCH LIEBER: Sufjan Stevens

 De Maart
De Maart






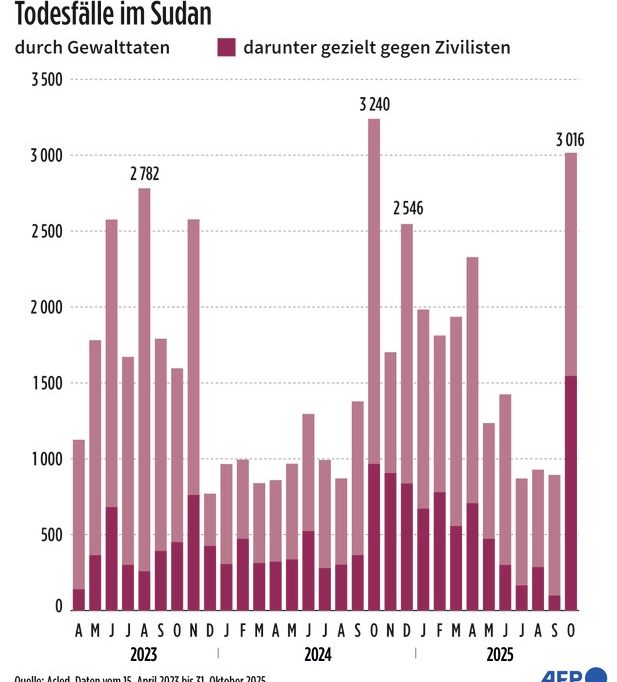
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können