Die beiden Kinder, Rubén und Izan, saßen gerade mit ihrem Vater beim Abendessen, als die Flut ihr Wohnhaus zerstörte. Rubén und Izan, drei und fünf Jahre alt, wurden sofort vom reißenden Wasser mitgerissen. Sie wurden bis heute, eine Woche nach der Flutkatastrophe, nicht gefunden. Ihr Vater überlebte, weil er sich an eine Mauer klammern konnte. Die Mutter kam ebenfalls davon: Sie arbeitete zum Unglückszeitpunkt in einem Supermarkt.
Rubén und Izan gehören zu den vielen Menschen, die seit der Horrorflut, die am 29. Oktober das Hinterland der spanischen Stadt Valencia überrollte, vermisst werden. Sie sind vermutlich tot. So wie eine große Zahl weiterer Verschwundener, von denen jede Spur fehlt. Viele von ihnen werden möglicherweise nie mehr gefunden werden. Die meterhohe Regen- und Schlammwelle, die wie ein Tsunami eine breite Spur des Todes und der Zerstörung hinterließ, hat vermutlich etliche Leichen ins Meer gespült.
An mehreren Stränden südlich der Mittelmeerstadt Valencia wurden in den vergangenen Tagen bereits leblose Körper entdeckt, bestätigte die Polizei. Die Identifizierung der Opfer gestaltet sich jedoch extrem schwierig und langwierig. Nachdem die Körper tagelang im Wasser trieben, ist eine klare Identitätsfeststellung nur noch über eine DNA-Probe möglich. Diese muss dann mit der Gen-Datenbank der Vermissten abgeglichen werden, erklärte ein Polizeisprecher.
Die mögliche Nachlässigkeit und die Fehler, die begangen worden sein könnten, sind eine andere Phase der Krise. Jetzt bauen wir erst einmal das Leben wieder auf und kümmern uns um die Opfer dieser Tragödie.
Unmittelbar nach der Hochwassertragödie gingen bei der Leitstelle nahezu 2.000 Meldungen über vermisste Personen ein. Vielen dieser Vermissten gelang es, sich zu retten, wie man inzwischen weiß. Sie konnten aber wegen des Zusammenbruchs des Handynetzes zunächst nicht ihre Familien kontaktieren. Eine aktualisierte Zahl der Vermissten wurde bisher nicht veröffentlicht. Tatsache ist auf jeden Fall, dass immer noch etliche Familien auf der Suche nach ihren Angehörigen sind.
So wie Maya Z., die immer noch ihren Vater sucht. Der Lkw-Fahrer war in der Nähe eines überbordenden Flusses mit seinem tonnenschweren Laster fortgespült worden. Augenzeugen nahmen von diesem Todesdrama ein Handyvideo auf. „Die zerstörten Aufbauten des Lkws wurden inzwischen entdeckt“, berichtet die Tochter. „Aber von der Fahrerkabine und meinem Vater gibt es keine Spur.“
Überflutungsrisiko sei Behörden bekannt gewesen
Doch auch die bisherige offizielle Bilanz dieser Starkregen-Katastrophe ist schon grauenhaft genug: Mindestens 215 Tote. 70 Kleinstädte und Dörfer im Süden und Westen der Großstadt Valencias wurden verwüstet. Ortschaften, die Paiporta, Alfafar, Benetússer, Picanya, Riba-roja oder Torrent heißen. Ein Gebiet, in dem 850.000 Einwohner wohnen, verwandelte sich in einen Schlammfriedhof. Annähernd 100.000 Autos wurden von den Fluten mitgerissen oder demoliert. Die Zahl der beschädigten Häuser, Wohnungen und Geschäftslokale dürfte nicht geringer sein. Straßen, Brücken und Bahnverbindungen verschwanden in den Fluten. Die Schäden gehen in die Milliarden.
Erst langsam wird das Ausmaß dieses Dramas deutlich, was auch daran liegt, dass viele Ortschaften in den ersten Tagen nicht zugänglich waren. Es ist eine der schlimmsten Unwetterkatastrophen Europas in diesem Jahrhundert. Eine Katastrophe, die von Meteorologen als weiteres Indiz dafür gesehen wird, dass die Zahl der extremen Wetterlagen mit dem Klimawandel zunimmt. Vor allem, weil die Erwärmung des Mittelmeers und die damit einhergehende Wasserverdunstung dafür sorgen, dass sich die dort bildenden Unwetterwolken mit immer größeren Regenmengen aufladen.
„Das war eine angekündigte Katastrophe“, sagen Experten wie der Wasserbauingenieur Félix Francés, Lehrstuhlinhaber an der Uni Valencia. Das Überflutungsrisiko in der Region sei den Behörden bekannt gewesen, sagte er dem staatlichen Fernsehsender RTVE. Man habe es versäumt, die Kanäle und Bachbetten, die sich nach dem sintflutartigen Regen in tödliche Ströme verwandelten, entsprechend baulich anzupassen und zu entschärfen.
„Der Klimawandel tötet“, sagte Spaniens sozialdemokratischer Premier Pedro Sánchez am Dienstag. Sein Kabinett beschloss, die betroffene Provinz Valencia formal zum Katastrophengebiet zu erklären. Damit kann die Regierung besondere Haushaltsmittel zur Verfügung stellen, um der betroffenen Bevölkerung und den Ortschaften unbürokratisch unter die Arme zu greifen. Zunächst ist ein Notfonds von zehn Milliarden Euro geplant. Zudem soll der Wiederaufbau mit Steuerhilfen und günstigen Krediten unterstützt werden.
Bürger wollen jetzt keinen Parteienstreit
Zur öffentlichen Kritik, dass die Katastrophe vielleicht vermeidbar war, die Bevölkerung von den lokalen Behörden nicht gewarnt wurde und die Hilfe nur schleppend in Gang kommt, wollte sich Sánchez zunächst nicht äußern. „Die mögliche Nachlässigkeit und die Fehler, die begangen worden sein könnten, sind eine andere Phase der Krise. Jetzt bauen wir erst einmal das Leben wieder auf und kümmern uns um die Opfer dieser Tragödie.“ Die Bürger wollten jetzt keinen Parteienstreit, sondern dass alle zusammenarbeiten.
Es sei klar, dass immer noch viel zu tun sei. „Wir wissen, dass es immer noch vermisste Menschen gibt, dass Häuser und Geschäfte unter dem Schlamm begraben wurden und viele Menschen unter schwerem Mangel leiden.“ Inzwischen arbeiten nahezu 20.000 professionelle Helfer im Flutgebiet: Feuerwehrleute, Soldaten, Katastrophenschützer, Polizisten. Zudem sind Tausende von Freiwilligen im Einsatz.
Angesichts der vielerorts immer noch chaotischen Lage raten europäische Regierungen wie etwa Deutschland oder Österreich von Reisen in den Großraum Valencia ab. Im Herbst und Winter verbringen üblicherweise Hunderttausende europäische Rentner, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, die kalte Jahreszeit an der spanischen Mittelmeerküste.


 De Maart
De Maart

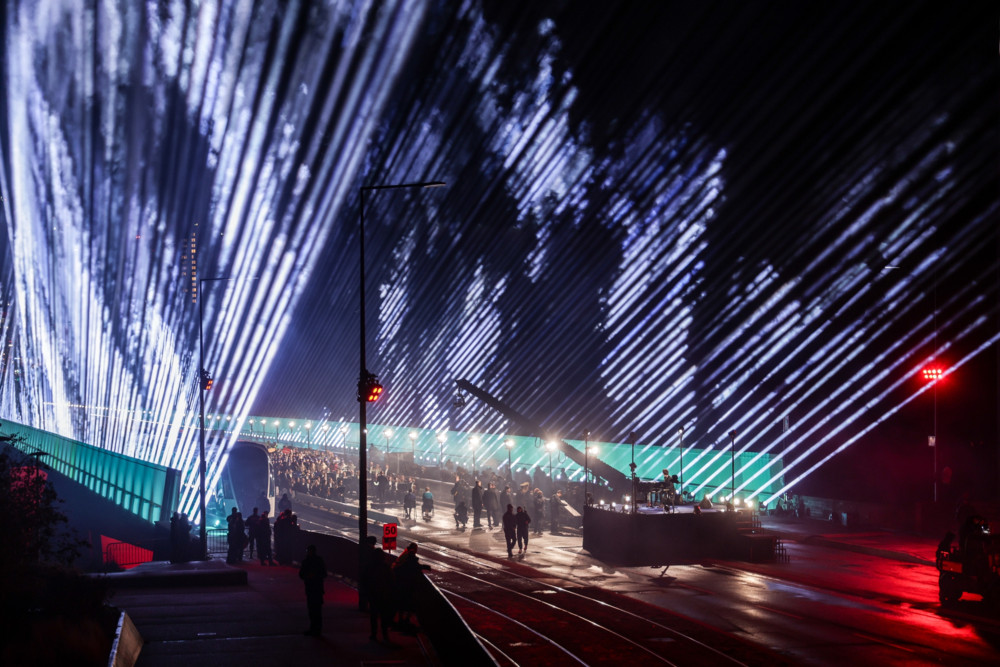





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können