Die Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer schwärmt zwar von der gemeinsamen europäischen Verteidigung gegen die russische Aggression, meint damit aber die Zusammenarbeit unter dem Dach der NATO. Die kürzlich beschlossene „pragmatische Annäherung“ an die EU soll um Himmels willen keinesfalls den Anschein erwecken, man erwäge den neuerlichen Beitritt zu Zollunion, Binnenmarkt oder dem Club generell. Denn dann würde eine neuerliche Volksabstimmung fällig, was die meisten politisch Verantwortlichen nach den unerfreulichen Erfahrungen von 2016, aber auch dem Austrittsreferendum Schottlands 2014, gerne vermeiden würden.
Vielleicht wurden die Gräben zwischen den beiden Lagern so brutal aufgerissen, vielleicht waren Bitterkeit und Verbalradikalität auf beiden Seiten so hoch, weil auf der Insel Volksabstimmungen über wichtige politische Weichenstellungen die absolute Ausnahme bleiben.
Der damalige Labour-Premierminister Harold Wilson musste sich jedenfalls zu Beginn des Jahres 1975 den Hohn der gerade erst an die Spitze ihrer konservativen Partei gewählten Oppositionsführerin gefallen lassen. Die Regierung sei „entscheidungsunfähig“, das Referendum ein „taktisches Mittel, um die Spaltung der eigenen Partei zu vermeiden“ – Margaret Thatchers Worte hatten damals genauso Gültigkeit wie 2016, als sich Tory-Premier David Cameron für die Volksabstimmung rüstete.
Ohnehin gab es viele Parallelen zwischen den vier Jahrzehnte auseinanderliegenden Ereignissen, wenn auch mit umgekehrten ideologischen Vorzeichen. Vor 50 wie vor neun Jahren zerfleischten sich in der Regierungspartei die ideologischen Flügel, die größte Oppositionskraft war nach zwei Wahlniederlagen mit sich selbst beschäftigt, die Liberalen spielten kaum eine Rolle, der schottische Nationalismus befand sich auf dem Vormarsch. Bei den jeweiligen Neuverhandlungen mit Brüssel kamen Zugeständnisse zustande, die im Abstimmungskampf kaum eine Rolle spielten. Wilson wie Cameron führten zwar im Kabinett eine pro-europäische Abstimmung herbei, gaben den Austrittsbefürwortern aber freie Hand, gegen die Linie der eigenen Regierung öffentlich mobil zu machen.
Ein Gefühl des Niedergangs
Der wesentliche Unterschied war die wirtschaftliche Lage. Mitte der 1970er-Jahre galt das Königreich als „kranker Mann Europas“, geschüttelt von dauernden Arbeitskämpfen und im scheinbar unaufhaltsamen Niedergang begriffen. Zu diesem Gefühl trug die Auflösung des einst weltumspannenden Empire bei. Nach zwei gescheiterten Anläufen war die Insel unter dem Tory-Premier Edward Heath erst 1973 verspätet in die damalige EWG eingetreten, begleitet von Dänemark und Irland.
43 Jahre später war Großbritannien greller, bunter und selbstbewusster geworden. Auch die Wirtschaft stand besser da, viele Daten fielen deutlich positiver aus als bei den vergleichbar großen Nachbarn Deutschland und Frankreich. Inzwischen lebten mehr als drei Millionen Bürger anderer EU-Staaten im Land, darunter Hunderttausende von Mittel- und Osteuropäern.
Weil 1975 Wirtschaft, Gewerkschaften, alle Parteiführungen und die Medien gemeinsam für Europa warben, ging die Sache positiv aus: 67,2 Prozent der Briten stimmten damals für den Verbleib. Dazu trug auch bei, dass die Nein-Sager keine attraktive Führungsfigur vorweisen konnten. Den Umfragen zufolge besaßen die Pro-Europäer wie Wilson, Heath oder Liberalenführer Jeremy Thorpe deutlich höhere Sympathiewerte als die prominenten Anti-Vertreter wie Tony Benn und Michael Foot (Labour) oder der konservative Ex-Minister Enoch Powell.
Heute europäischer als vor dem Brexit
Auch Oppositionsführerin Thatcher machte aktiv Wahlkampf für ein Ja. „Auf viele Leute wirkte es wie der Kampf zwischen Schwadronierern und Unzufriedenen auf der einen Seite und tüchtigen Typen mit Bodenhaftung auf der anderen“, bilanziert der Autor Andrew Marr in seiner „Geschichte des modernen Britanniens“.
Umso schwerer wogen 2016 zwei persönliche Entscheidungen. Zum einen entschied sich der damals noch weiter übers eigene Lager hinaus beliebte Londoner Bürgermeister und spätere Premier Boris Johnson nach langem Schwanken fürs Austrittslager, um den alten Rivalen Cameron aus dem Feld zu schlagen. Zum anderen wurde die eigentlich klar pro-europäische Labour-Party von einem eingefleischten Feind des Einigungsprojekts angeführt. Jeremy Corbyn ging sogar mitten im Referendumskampf in den Urlaub. Dabei seien bei allen Referendumskampagnen auf dem Kontinent „die Anhänger der Opposition entscheidend“ gewesen, warnte die dänische Politikprofessorin Sara Hobolt von der London School of Economics (LSE).
Und so kam es im Juni 2016 zum Brexit, wenn auch mit der deutlich knapperen Marge von 51,9 Prozent. Kommentatoren wie Sunder Katwala vom Thinktank British Future trösten sich mit dem Hinweis auf die weiterhin bestehenden engen Verbindungen zum Kontinent. „Trotz Brexit ist Großbritannien paradoxerweise heute ein viel europäischeres Land als es 1975 war“, analysiert der Politologe. „Vielleicht fühlen wir uns nicht als Europäer, aber die europäische Präsenz hat unser Lebensgefühl komplett verändert.“

 De Maart
De Maart



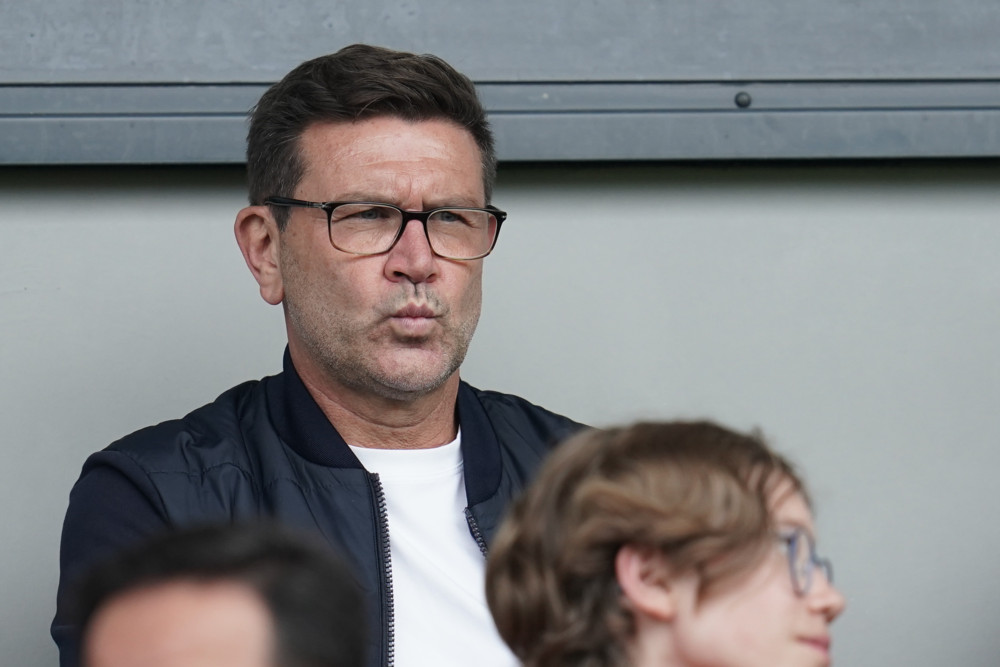



Keine Chance auf ein Referendum über Europa, sagt Freund Gregory aus Manchester. " The Earl of Darkness Farage is still hunting the ground." Und auch hier wie bei euch drüben gäbe es viele Teufelsanbeter.