Vor zwei Jahren hat die Europäische Union eine Studie mit dem Titel „Being Black in the EU“ veröffentlicht, in der die Diskriminierung von Afroeuropäer und Afroeuropäerinnen in verschiedenen Ländern analysiert wird. Ihr zufolge stellt Diskriminierung in Luxemburg ein akutes Problem dar. So ging aus der Studie hervor, dass schwarze Menschen hierzulande in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Bildung im Durchschnitt stärker diskriminiert werden und einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind als in anderen EU-Ländern. Neben Rassismus tritt Diskriminierung aber auch immer wieder in Form von Sexismus, Homophobie und Xenophobie auf.
Das Thema selbst schien nach einigen Wochen Berichterstattung wieder in den Hintergrund zu rücken. Das ändert jedoch nichts daran, dass auch in Luxemburg einige Erfahrungsberichte an die Öffentlichkeit gelangten, als es nach dem Tod von George Floyd, der durch Polizeigewalt in den USA ums Leben kam, zu einem weltweiten Aufschrei kam. In den Medien mehrten sich Berichte von Diskriminierungen in Beruf und Schule, sodass sich inzwischen die Frage aufdrängt, ob das Thema in Luxemburg auch wirklich aufgearbeitet wird.
Wird der Begriff „Diskriminierung“ allgemein mit einer bewussten, absichtlichen Beleidigung assoziiert, so agiert sie auf diversen Ebenen und unter verschiedenen Formen. Die wohl bekannteste ist die sogenannte „gewollte“ Diskriminierung. In diese Kategorie fallen verbale und physische Diskriminierungen, die auch strafrechtlich verfolgt werden können.
Eine weitere Form ist die „unbewusste“ Diskriminierung. Sie betrifft fast jeden Menschen und manifestiert sich im alltäglichen Sprachgebrauch und Handlungsmuster. Oft ist man sich der diskriminierenden Natur der eigenen Handlungen nicht bewusst: Bei Aussagen wie „Spiel nicht wie ein Mädchen“ ruft man eine Assoziierung zwischen dem weiblichen Geschlecht und Schwäche hervor, meist ohne sich der Tragweite dieser Aussage wirklich bewusst zu sein. Dabei muss es nicht immer in böswilliger Absicht sein, allerdings ist es für die Betroffenen dafür nicht weniger schmerzhaft. Sowohl bewusste als auch unbewusste Diskriminierung wird somit als Diskriminierung auf individueller oder persönlicher Ebene verstanden.
Diskriminierung begrenzt sich aber nicht ausschließlich auf die individuelle Ebene. Tut sie das nicht, dann spricht man von institutioneller Diskriminierung, bei der die diskriminierenden Faktoren fest im System verankert sind. Oft sind es Rahmenbedingungen wie Gesetze, Regeln oder gesellschaftliche Strukturen, die die Benachteiligung tolerieren, begünstigen oder ermöglichen.
Diversität ist nicht gleich Akzeptanz
Luxemburgs Bevölkerung ist sehr international. Von den rund 590.700 Menschen, die im Jahr 2017 im Großherzogtum lebten, besaßen 309.200 die luxemburgische Staatsbürgerschaft – das entspricht 52,3 Prozent. Bei den Ausländern bildeten Portugiesen mit 96.800 Einwohnern die größte Gruppe. Das sind immerhin noch 16,4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Demnach weisen die Luxemburger Gesellschaft und das luxemburgische Schulsystem eine große Diversität in Bezug auf die Nationalitäten auf – und somit auch eine große Vielfalt an Kulturen, Hautfarben, Religionen und anderen sozialen und biologischen Zuschreibungen. Eine große Diversität ist aber nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit hoher Toleranz oder Akzeptanz.
Diskriminierung gibt es auch im Luxemburger Schulsystem. Entsprechende Berichte der Luxemburger Medien gibt es einige. Laut Luxemburger Verfassung haben alle Menschen die gleichen Chancen und Rechte. Im Schulsystem aber führt die Auslegung dieses Grundgesetzes zu Ungleichheiten: In der Schule sollten alle SchülerInnen eigentlich nach denselben Grundkriterien bewertet werden. Auf den ersten Blick wirkt dies fair. Hiermit wird jedoch ignoriert, dass nicht alle SchülerInnen gleich sind und dass es teilweise große Unterschiede in deren jeweiligen Ausgangspositionen gibt. Indem man alle SchülerInnen gleich behandelt, werden die bestehenden Ungleichheiten noch verstärkt.
Eine Art der institutionellen Diskriminierung ist auch die Gleichbehandlung von Erstsprachlern und Zweitsprachlern. Das wurde bereits im Bildungsbericht von 2018 festgestellt. Die Chancen, einem höheren Bildungsweg zugeteilt zu werden, fallen bei sozioökonomisch benachteiligten SchülerInnen niedriger aus. Betrachtet man nun die Sprachhintergründe, dann zeigen sich ebenfalls Bildungsungleichheiten, und zwar zum Nachteil von Jugendlichen mit ausländischen Wurzeln. Laut Experten manifestieren sich diese Ungleichheiten bereits im frühen Alter, etwa ab dem „Cycle 2“.
Die sinkenden Chancen der Benachteiligten und die zunehmenden Chancen der Privilegierten bewirken eine Zunahme sozialer und schichtbezogener Ungleichheiten in der Bildungsbeteiligung bzw. im Bildungserwerb. Der Anteil diverskultureller SchülerInnen in der Sekundarstufe ist in den letzten zehn Jahren also weniger stark gestiegen als der Anteil diverskultureller Kinder im Schulsystem insgesamt. Folglich werden Jugendliche mit sozioökonomisch schwachen Hintergründen – etwa Nichtmuttersprachler und solche mit spezifischen Bedürfnissen – systematisch benachteiligt, während andere bevorteilt werden. Ungleichheit reproduziert sich somit fortwährend.
Keine Identifikationsfiguren
Doch die systemische Diskriminierung geht über die Bewertungsstruktur hinaus. Auch das Schulmaterial ist nicht an die kulturelle Vielfalt des Landes angepasst. Für Kinder und Jugendliche sind positive Identifikationsfiguren von großer Bedeutung für die eigene Entwicklung. Schulbücher zeigen aber oft eine eindimensionale Perspektive der Gesellschaft, bei der vorrangig heterosexuelle, weiße Menschen abgebildet sind – oft in veralteten, geschlechtsspezifischen Rollen. Das Buch zum Fach „Vie et Société“ kam erst 2017 heraus. Allerdings ist in mehr als 140 Illustrationen keine einzige Person mit dunkler Hautfarbe zu sehen.
Demnach dürfte es wohl kaum überraschen, dass sich immer mehr Jugendliche nicht mehr im Schulmaterial und in den behandelten Büchern wiederfinden. Positive Identifikationsfiguren spielen bei der persönlichen Entwicklung eine elementare Rolle. Lehrt man nur eine eindimensionale Perspektive der Gesellschaft, so lernen die Kinder auch nur eine begrenzte Sicht auf die Gesellschaft. Das ist verheerend, sollte man Toleranz, Offenheit und Akzeptanz bei Kindern fördern wollen.
Neben dem Schulmaterial kommt es auch in offiziellen Dokumenten zu unbewussten, rassistischen Vermittlungen. In einem offiziellen Dokument des Luxemburger Bildungssystems wird bei Illustrationen der höheren Bildungswege auf Fotos mit weißen SchülerInnen zurückgegriffen. Der zweite Bildungsweg wird hingegen mit „nicht-weißen“ Personen illustriert. Auch wenn man dies als unabsichtlich interpretieren kann, so wird jedoch angedeutet, dass Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe für eine höhere Ausbildung ungeeignet sind.
Ein weiterer, wesentlicher Aspekt institutioneller Diskriminierung ist der Umgang mit Diskriminierung selbst. Dem Luxemburger Bildungswesen fehlt es an einem nationalen, flächendeckenden Antidiskriminierungskonzept. Immer wieder berichten Betroffene, dass sie in ihrer Schule nicht ernst genommen werden oder dass ihnen kein Glauben geschenkt wird. Es fehlt an Aktionsplänen, die sowohl den SchülerInnen als auch den Lehrkräften helfen.
Pauschale Strafen helfen nicht
Diskriminierungsfälle zwischen Jugendlichen sind durchaus möglich. In der Regel werden dann die verantwortlichen Personen sanktioniert und darauf hingewiesen, „dass man das nicht sagt“. Damit ist das Problem aber keineswegs gelöst. Jegliche Form von Diskriminierung sollte aufgearbeitet werden. Zum einen muss sich der oder die Betroffene ernst genommen fühlen, zum anderen muss dem oder der Diskriminierenden erklärt werden, warum die Aussage oder Handlung verletzend war. Vorfälle pauschal mit Sanktionen zu bestrafen, hilft weder den Diskriminierten noch den Diskriminierenden. Fordert man von den TäterInnen, sich zu hinterfragen und eigenständig Lösungsvorschläge vorzuschlagen, so handelt man konstruktiv und verhindert, dass diese Menschen in einen Trotzreaktionsmechanismus verfallen.
Diskriminierung geht aber nicht nur von Jugendlichen aus. Immer öfter werden rassistische, sexistische oder homophobe Aussagen von Lehrkräften bekannt. Bewusst diskriminierende Lehrkräfte befinden sich eindeutig in der Unterzahl. Allerdings fühlen sich diese Menschen immer noch sicher genug, solche Aussagen in der Öffentlichkeit tätigen zu können. Zahlreiche junge Frauen haben in ihrer schulischen Laufbahn mindestens einer Lehrperson begegnen müssen, die ihnen gegenüber sexistische Aussagen geäußert hat. Bekannt sind Sätze wie „Mit diesem Ausschnitt ist dir eine gute Note garantiert“ oder „Eine Frau kann erst dann gut schreiben, nachdem sie das erste Mal Sex hatte“.
Ebenfalls berichten viele junge Menschen mit ausländischen Wurzeln, dass sie sich mit rassistischen Aussagen in ihrer Schulzeit abfinden mussten, weil eine konsequente Aufarbeitung fehlte. Das Problem ist nicht neu. So schrieb etwa die Direktion des „Lycée Nic Biever“ 2002 in einem offiziellen Brief: „Suite à un comportement inadmissible (…), le régent en colère avait prononcé les mots ‚du Neger‘. En Luxembourgeois, prononcé dans ce contexte, ceci est une impréciation sans arrière-fond raciste“. Dass sich die Bereitschaft, das eigene Handeln infrage zu stellen, kaum geändert hat, zeigt auch die Behauptung des Direktors des „Athenée“, dass „Blackfacing“ nicht als rassistisch eingestuft werden könne.
Deutlich wird hier das Phänomen, dass Personen in Machtpositionen davon ausgehen, Deutungshoheit zu haben. Anstatt Betroffenen Gehör zu schenken, beharrt man auf der eigenen privilegierten Position, ohne in Erwägung zu ziehen, dass diese Handlungen diskriminierend sein können für Menschen, die nicht männlich und/oder weiß sind. Zudem verdeutlicht es die Verschlossenheit gegenüber einer reflektierten Aufarbeitungsarbeit. Das Fehlen solcher Aufarbeitungsmechanismen verweist auf ein Problem im System selbst. Wie wichtig ein antidiskriminierender pädagogischer Ansatz ist, zeigen Studien, die belegen, dass Kinder die Stereotypen in ihrem Umfeld bereits in ihrem fünften Lebensjahr übernommen haben.
Einblick und Ausblick
Immer wieder hört man, dass man ohnehin nicht gegen persönliche Meinungen ankommen könne und dass die Schule kein Ort von politischen Statements sein sollte. Zwar sollte der Klassensaal nicht zur Arena politischer Agenden werden, doch ist im Grundgesetz festgelegt, dass kein Mensch aufgrund von Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung diskriminiert werden darf. Damit wird die Schule zwangsläufig zu einem Ort, an dem Beleidigungen und Ungleichheitsbehandlungen kein Platz haben dürfen, unabhängig von der eigenen Sicht der Dinge. Somit können Diskriminierungen nicht mit dem „Recht auf eine eigene Meinung“ verteidigt werden.
Eigene Ansichten sollte man also für sich behalten, sofern sie denn von der Gesetzgebung abweichen. Das gilt auch für den Humor. Sarkastische, ironische oder zynische Anmerkungen werden nicht von jedem als solche verstanden. Zudem kann eine Aussage, die man selbst vielleicht als witzig verstehen mag, andere verletzen.
Um einen Ausblick zu ermöglichen, muss man zwischen zwei Aspekten der Thematik unterscheiden: dem Aspekt der akademischen Ungleichheiten, denen man sich spätestens seit dem nationalen Bildungsbericht bewusst ist, und dem Aspekt der bewussten Diskriminierungen sowie des Schulmaterials, die bislang ignoriert wurden. Um den Bildungsungleichheiten entgegenzusteuern, wurden internationale Schulmodelle ins Leben gerufen. Inwiefern diese die festgestellten Ungleichheiten auffangen können, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.
Zudem sollte man das Schulmaterial überarbeiten. Lernt man in der Schule nur weiße Helden und Heldinnen kennen, so vermittelt man den Schülern und Schülerinnen, dass es nur Helden in dieser Hautfarbe gibt. Neben einer zeit- und gesellschaftsgemäßen Überarbeitung des Schulmaterials sollte man auch Erfahrungsberichte über Diskriminierungen ernst nehmen und die Fälle konsequent aufarbeiten. So könnte man Antidiskriminierungs-Ansätze in die Ausbildung der Lehrkräfte einbauen und im Schulalltag zur Pflicht machen. Dies würde der kulturellen Vielfalt unserer Gesellschaft und unserer Schülerschaft Rechnung tragen. Dabei geht es nicht darum, Unterschiede zu ignorieren, sondern darum, zu lernen, die Vielfalt wertzuschätzen. Man sollte Toleranz und Akzeptanz für Menschen mit anderen Gebräuchen und Handlungen fördern. Die Schule sollte ein Ort sein, an dem niemand Diskriminierung zu befürchten hat – und das unabhängig vom familiären Hintergrund und unabhängig von persönlichen Meinungen. Dies fordert das Grundgesetz ein.
Auf persönlicher Ebene kann jeder Mensch lernen, den eigenen Sprachgebrauch und die eigenen Handlungsmuster zu hinterfragen und anzupassen. Kein Mensch ist frei von Stereotypen, allerdings wäre Kritikfähigkeit sowie die Bereitschaft, das eigene Handeln anzupassen, unserer Gesellschaft und vor allem unseren SchülerInnen gegenüber gerechter.
*Andy Schammo studiert Erziehungswissenschaften an der Universität Luxemburg und schreibt seine Abschlussarbeit zum Thema „Institutionelle Diskriminierung im Luxemburger Bildungswesen“. Er setzt sich privat gegen Diskriminierung und Ungleichheiten ein.

 De Maart
De Maart

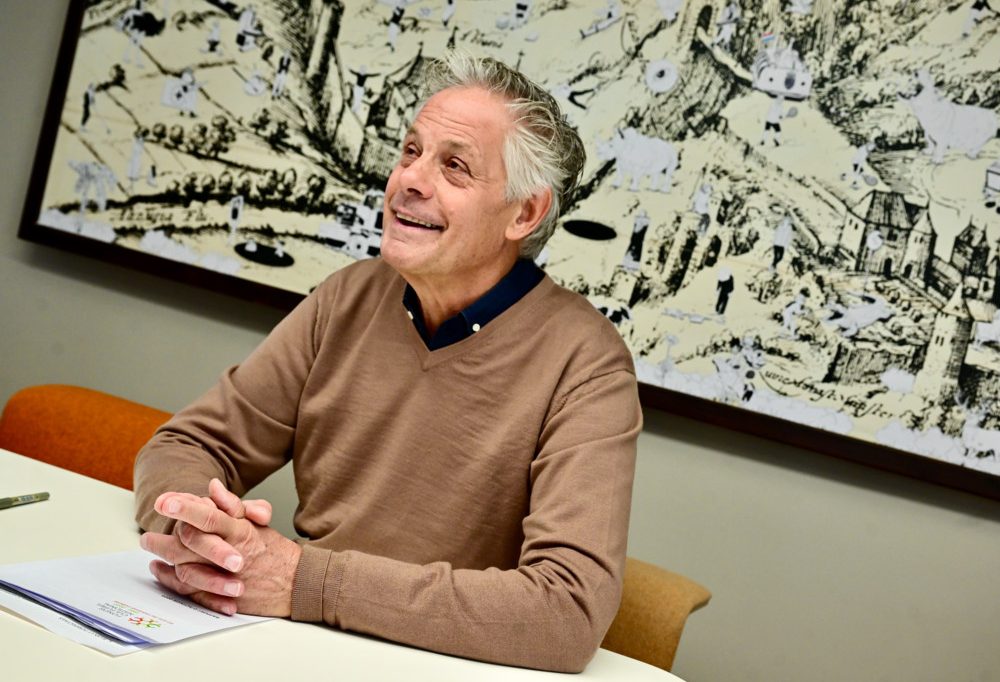





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können