Gewalt in der Geburtshilfe ist kein Randphänomen, sondern Alltag
auf Entbindungsstationen – auch in Luxemburg. Der vor vier Jahren ins Leben gerufene „Roses Revolution Day“ macht auf dieses Tabu aufmerksam: am 25. November, dem gleichen Datum wie dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.
 Valérie Peiffer (Foto: Didier Sylvestre) ist dreifache Mutter. Zwei Geburten, beides ungewollte Kaiserschnitte, hat sie alles andere als positiv erlebt. Das dritte Kind, das zum Zeitpunkt des Gesprächs zwei Wochen alt ist, kam auf natürlichem Weg zur Welt. Erst heute weiß Valérie, dass eine Geburt auch etwas Schönes sein kann.
Valérie Peiffer (Foto: Didier Sylvestre) ist dreifache Mutter. Zwei Geburten, beides ungewollte Kaiserschnitte, hat sie alles andere als positiv erlebt. Das dritte Kind, das zum Zeitpunkt des Gesprächs zwei Wochen alt ist, kam auf natürlichem Weg zur Welt. Erst heute weiß Valérie, dass eine Geburt auch etwas Schönes sein kann.
„Ich dachte, wenn die Geburt eingeleitet wird, kommt das Kind bald“, sagt Valérie über ihre erste Geburt. Fehlanzeige. Abends gegen sieben kam der Arzt ins Zimmer. Sie erinnert sich, dass er seine Jacke schon anhatte, quasi auf dem Sprung in den Feierabend. „Wie sieht’s aus, Frau Peiffer, holen wir das Kind noch heute?“ Von der Autorität des Arztes verunsichert, sagte die werdende Mutter Ja. Er drehte sich auf der Stelle um: „Ich gebe im OP Bescheid.“ Valérie bereute ihre Antwort sofort.
Die Autorität der Ärzte ist eines der Probleme, wenn es um Gewalt in der Geburtshilfe geht. Das bestätigen die Hebammen der „Association luxembourgeoise des sages-femmes“, kurz ALSF, die nicht mit Namen genannt werden wollen. „Die Frauen fühlen sich als Patient und glauben, sie müssen den Anweisungen der Ärzte, Hebammen und des Krankenhauspersonals folgen“, sagen sie aus Erfahrung. Gewalt in der Geburtshilfe erleben sie – wenn von der kleinsten, verbalen Gewalt ausgegangen wird – täglich.
Mit der Ruhe kommt die Reue
„Viele Frauen gehen davon aus, dass das, was sie erleben, normal ist. Eben weil niemand darüber spricht.“ Um kurz nach acht ist Lena auf der Welt. „Ich gehe davon aus, dass der Arzt einfach nur rechtzeitig in seinen Feierabend wollte“, sagt Valérie heute. Vorwürfe, nicht Nein zum Kaiserschnitt gesagt zu haben, macht sie sich bis heute. „Als ich mit meiner Tochter zu Hause war und Zeit hatte, über alles nachzudenken, habe ich jede Nacht geweint“, erzählt sie mit zittriger Stimme.
Der „Roses Revolution Day“ …
… wurde 2013 als Teil des Internationalen Gedenktages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ins Leben gerufen. Der Tag soll auf das Tabu von Gewalt in der Geburtshilfe aufmerksam machen.
Frauen, die schon einmal von psychischer oder physischer Gewalt bei der Geburtshilfe betroffen waren, sind am 25. November dazu aufgerufen, eine rosafarbene Rose vor die Kreißsaaltür zu legen, in denen ihnen die Gewalt angetan wurde. Wenn sie es wünschen, legen sie einen erklärenden Brief hinzu. Die Geste soll den Frauen dabei helfen, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten, ist aber gleichzeitig ein wichtiges Feedback an die Mitarbeiter der Krankenhäuser. Diese sind sich oft nicht bewusst, dass die Frauen bestimmte Dinge als Gewalt empfunden haben. So bekommen sie die Möglichkeit, sich darüber bewusst zu werden und gegebenenfalls ihre Routinen zu überdenken.
In Luxemburg wurde der „Roses Revolution Day“ erstmals vor zwei Jahren erwähnt. Bisher lag, den Hebammen der ALSF zufolge, noch keine Rose vor einem luxemburgischen Kreißsaal.
Sie sind allerdings der festen Überzeugung, dass sich das in diesem Jahr ändern wird. „Wir haben schon von einigen Frauen gehört, die vorhaben, in diesem Jahr eine rosafarbene Rose in einem Krankenhaus abzulegen“, sagen sie.
Sie wischt sich die Tränen aus den Augen, erzählt davon, wie sie nach dem Kaiserschnitt alleine im Aufwachraum gelassen wurde – ohne Kind und ohne Ehemann. „Ich habe meinen Körper bis zur Brust nicht gespürt, wusste nicht, wie lange ich schon da liege und vor allem nicht, wo mein Kind ist.“ Sie hörte nur das Rauschen und Piepsen der Krankenhausmaschinen und musste damals schon weinen.
„Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Es hat niemand mit mir geredet oder mich auf dem Laufenden gehalten, was genau nun passiert“, bedauert sie. Nach der Geburt erfuhr Valérie, dass der Arzt, der Lena geholt hatte, wohl bekannt dafür ist, Kaiserschnitte zu machen. „Das ist für ihn einfach planbar und bringt Geld“, vermutet sie.
Grobe Griffe, vorwurfsvolle Blicke
Nach einer gefühlten Ewigkeit kam eine Hebamme und legte ihr das Kind mit einem groben Handgriff an die Brust. Fast vorwurfsvoll wies sie die Mutter an, ihr Kind jetzt zu füttern, es habe Hunger. Dann zog sie die Decke herunter. Valérie erschrak fürchterlich: „Zwischen meinen Beinen war eine riesige Blutlache. Es sah aus, als ob ich verbluten würde.“ Wieder hatte niemand mit ihr kommuniziert, ihr erklärt, dass es normal sei, dass trotz Kaiserschnitt Blutungen auftreten. „Stellen Sie sich nicht so an, das ist völlig normal“, lautete die Aussage der Hebamme.
„Es sind auf keinen Fall nur die Ärzte, die Gewalt bei der Geburtshilfe ausüben“, betonen die Hebammen der ALSF in diesem Zusammenhang. „Es sind ganz oft auch die Hebammen, die Krankenhaushelfer oder sogar die Partner der Schwangeren.“ Das sei meist noch nicht einmal Absicht und passiere im Stress einer Geburt unbewusst. „Vieles passiert aus Routine. Die Hebamme oder der Arzt glauben zu wissen, was für Mutter und Kind am besten ist. Das heißt aber nicht, dass die werdende Mutter es auch so erlebt.“ Deshalb wäre es eigentlich die Aufgabe der Hebamme und des Arztes, die Frau bereits während der Schwangerschaft aufzuklären und sie darin zu bestärken, dass sie selbst – und sonst niemand – die Entscheidungen während der Geburt trifft. „Es ist ihr Körper und ihr Kind. Arzt und Hebamme sind nur da, um der Frau zu helfen“, betont die ALSF.
Darauf ist das luxemburgische Geburtssystem bisher nicht ausgelegt. Die wenigsten Frauen wissen, dass sie bereits während der Schwangerschaft eine Hebamme zurate ziehen können. Und Ärzten fehlt im Krankenhausalltag die Zeit, sich persönlich mit den Frauen auseinanderzusetzen. Um das Trauma zu verarbeiten, begab sich Valérie in psychologische Therapie – und nahm sich fest vor, dass bei der Geburt ihres zweiten Kindes alles anders wird. Nach einem Jahr wurde sie wieder schwanger. Mit ihrem neuen Arzt redete Valérie über ihre traumatische erste Geburt und über ihren starken Wunsch, ihr zweites Kind auf natürlichem Weg zur Welt zu bringen. Der Arzt sah gar kein Problem darin.
Eigentlich sollte alles anders laufen
Doch dann kam alles ganz anders: Als ihre zweite Tochter vier Tage nach dem errechneten Tag noch immer nicht auf der Welt war, wurde Valérie ungeduldig. Sie fühlte sich unwohl, hatte Schmerzen. „Der Arzt hat mir die Wahl gelassen. Entweder ich reiße mich jetzt zusammen oder wir holen das Kind morgen per Kaiserschnitt.“ Valérie entschied sich für die erste Option. Einen Tag später setzten die Wehen ein. „Im Krankenhaus wurden dann Eingriffe gemacht, von denen ich bis heute nicht weiß, was gemacht wurde.“ Die Hebamme gab ihr eine Spritze, damit die Wehen regelmäßig werden. „Für mich waren sie das eigentlich schon, aber ich wurde nicht gefragt.“
 Als das Kind nach einiger Zeit immer noch zu weit oben lag und der Muttermund nicht genügend geöffnet war, schlug die Hebamme vor, die Fruchtblase zu öffnen. „Wieder einmal unwissend, wie das vor sich geht, habe ich zugestimmt.“ Mit einer Art Haken öffnete die Hebamme die Fruchtblase und ein Schwall an Wasser platschte auf den Boden. „Weil ich nicht darauf vorbereitet war, habe ich mich derart erschrocken, dass der Muttermund sich ein paar Zentimeter geschlossen hat und das Kind noch weiter hochgerutscht ist“ – das Gegenteil von dem, was die Hebamme erreichen wollte.
Als das Kind nach einiger Zeit immer noch zu weit oben lag und der Muttermund nicht genügend geöffnet war, schlug die Hebamme vor, die Fruchtblase zu öffnen. „Wieder einmal unwissend, wie das vor sich geht, habe ich zugestimmt.“ Mit einer Art Haken öffnete die Hebamme die Fruchtblase und ein Schwall an Wasser platschte auf den Boden. „Weil ich nicht darauf vorbereitet war, habe ich mich derart erschrocken, dass der Muttermund sich ein paar Zentimeter geschlossen hat und das Kind noch weiter hochgerutscht ist“ – das Gegenteil von dem, was die Hebamme erreichen wollte.
Sie musste sich auf den Rücken legen – die in dem Moment ungemütlichste Position überhaupt –, ihre Füße wurden mit Klettverschluss an Aufstellern festgemacht. „Ich wollte das alles nicht, hatte aber auch keine Kraft, Nein zu sagen. Ich fühlte mich in dem Moment wie ein Objekt.“ Dann griff der Arzt ihr mit beiden Händen bis zum Ellbogen in den Unterleib. „Er hat mir fürchterlich wehgetan, sodass ich irgendwann nur noch geschrien habe, er solle aufhören.“
„Sie müssen jetzt still sein“
Der Arzt reagierte nicht auf die Schmerzensschreie der Mutter. Valéries Ehemann war zu perplex, um etwas zu sagen. Die ALSF betont, wie wichtig der Partner während einer Geburt ist. „Er kann als eine Art Anwalt fungieren und die Frau, die vielleicht gerade zu große Schmerzen oder Angst hat, im Kreißsaal vertreten.“ Deshalb sollten werdende Mütter immer mit ihrem Partner darüber sprechen, was sie bei der Geburt wollen und was nicht.
Als der Arzt das Kind auch mithilfe eines Vakuumextraktors nicht zu fassen bekam, verließ er mit den Worten „Wir machen jetzt einen Kaiserschnitt“ den Raum. „Mein Nein hat er noch nicht einmal mehr gehört“, sagt Valérie. Dass sie im OP das Gefühl hatte, dass wenn sie jetzt pressen würde, es funktionieren würde, interessierte niemanden. Bevor sie sich versah, spürte sie, dass der Arzt etwas an ihrem Unterbauch machte. Sie fragte, ob er schon schneide. Die Antwort war kurz und knapp: „Sie müssen jetzt still sein, ich muss mich konzentrieren.“
Kurze Zeit später hörte sie das Kind schreien. Psychische Gewalt bei der Geburtshilfe erleben Hebammen in Luxemburg täglich. „Das reicht von Sätzen wie ‚Stellen Sie sich nicht so an‘, ‚Das Kind ist da reingekommen, dann kommt es auch wieder raus‘ bis zu Manipulationen zugunsten des Arztes“, sagen die Hebammen. Dieser stellt sich dar, als sei er der Retter in der Not.
Selbst erlangtes Wissen
Als Valéries Schwangerschaftstest im März dieses Jahres erneut positiv ausfiel, hatte sie genug davon, nie über irgendwelche Vorgehensweisen aufgeklärt zu werden und begann, sich selbst zu informieren. „Ich habe bei allen möglichen Organisationen angerufen und bin einer Facebook-Gruppe zum Thema ‚Natürlich und selbstbestimmt gebären nach Kaiserschnitt‘ beigetreten.“
Zuvor hatten alle Ärzte ihr gesagt, dass nach zwei Kaiserschnitten eine natürliche Geburt ausgeschlossen wäre. In der Gruppe las sie das Gegenteil. Einen Arzt zu finden, der „diese Akrobatik mitmacht“, wie ihr voriger Arzt es beschrieb, stellte sich als eine Herausforderung dar. Es gebe nur einen Arzt im Land, der sich da rantraue. Valérie suchte ihn auf.
Für die dritte Geburt erstellte sie einen detaillierten Geburtsplan. Etwas, das sie dank der Facebook-Gruppe kennengelernt hatte. Auch die ALSF empfiehlt, ein sogenanntes „Projet de naissance“ zu schreiben. „Darin steht klar, was die Frau während der Geburt will und was nicht“, erklären die Hebammen. Valérie gab diesen auf der Entbindungsstation ab. „Ich hatte das große Glück, während der dritten Geburt durchgehend die gleiche Hebamme zu haben, die meinen Geburtsplan gelesen und auch respektiert hat“, ist die dreifache Mutter dankbar.
 Nur durch die Unterstützung der Hebamme und des Arztes konnte sie ihr drittes Kind, trotz aller Warnungen, auf natürlichem Weg gebären. „Es war das erste Mal, dass ich eine Nabelschnur gespürt habe.“
Nur durch die Unterstützung der Hebamme und des Arztes konnte sie ihr drittes Kind, trotz aller Warnungen, auf natürlichem Weg gebären. „Es war das erste Mal, dass ich eine Nabelschnur gespürt habe.“
Nicht für alle Beteiligten Routine
Die Hebammen der ALSF bedauern die Zustände auf luxemburgischen Entbindungsstationen und fordern mehr Aufklärungsarbeit. „Wenn der Frau bewusst gemacht wird, dass es ihr Körper, ihr Baby und ihre Entscheidung ist, was bei der Geburt getan oder nicht getan wird, hilft ihr das schon viel“, sagen sie.
Auch Ärzte und Hebammen müssten an Fortbildungen teilnehmen, um auf dem neusten Stand der Geburtshilfe zu bleiben. Es sei wichtig, daran erinnert zu werden, dass die Geburt für sie zwar Routine, für die Frau aber ein sehr intimer, einmaliger Moment sei, sagt die ALSF.
 Valérie ist glücklich darüber, wenigstens eine schöne Geburt erlebt zu haben. Das hat ihr teilweise geholfen, die anderen Erlebnisse zu verarbeiten. „Es ist möglich und wir haben es geschafft“, sagt sie heute und schaut dabei stolz ihre zwei Wochen alte Tochter an, die im Tragetuch schläft.
Valérie ist glücklich darüber, wenigstens eine schöne Geburt erlebt zu haben. Das hat ihr teilweise geholfen, die anderen Erlebnisse zu verarbeiten. „Es ist möglich und wir haben es geschafft“, sagt sie heute und schaut dabei stolz ihre zwei Wochen alte Tochter an, die im Tragetuch schläft.
Lesen Sie zum Thema auch den aktuellen Kommentar.

 De Maart
De Maart





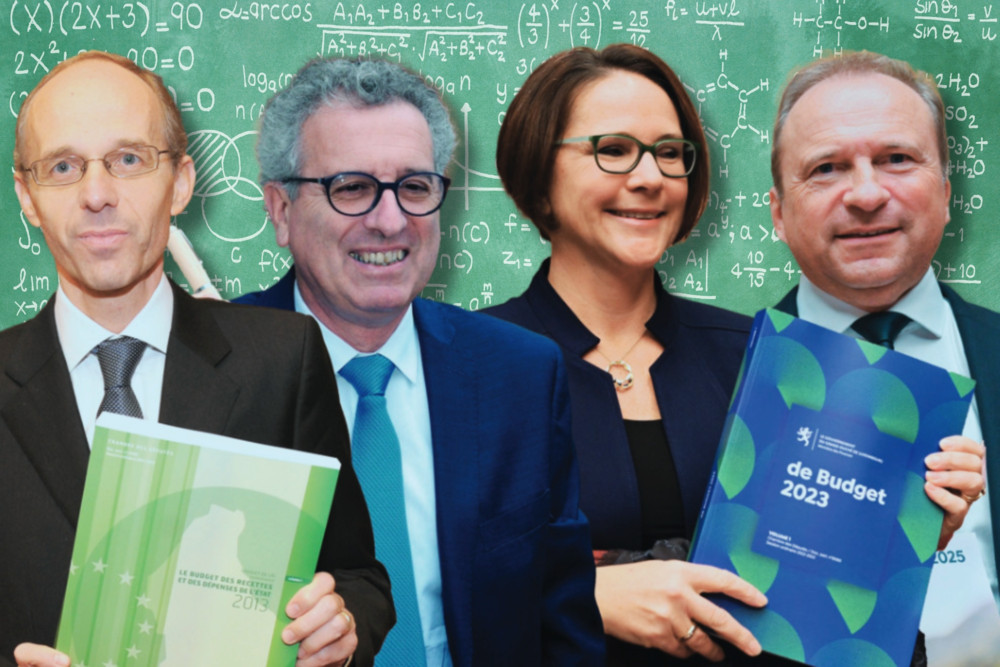



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können