So konnten all jene in Ruhe gemeinsam feiern, die sich auf Initiative des britischen Königshauses zum „Big Lunch“ trafen. Und die 20.000 Eintrittskarten-Besitzer für das abendliche Krönungskonzert im Schlosspark zu Windsor mussten nicht die Regencapes herausziehen oder sich unter Schirmen verstecken.
Wie anders die Szenerie am Samstag. Da schien es, als werde Charles Philip Arthur George, seit September als Charles III. Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland sowie 14 weiterer Staaten rund um den Globus, seiner viel bewunderten Mutter nacheifern. Auch die damals blutjunge Elizabeth II. war im Juni 1953 im kühlen englischen Regen zu ihrer Krönung in die Westminster Abbey gefahren.
Jene Zehntausende von Schaulustigen, die teils seit mehreren Tagen in der Londoner Innenstadt campiert hatten, ließen sich die Laune nicht verderben. Anderswo freilich dämpfte das nasse Wetter doch die Stimmung. Um die Welt ging etwa ein Foto aus dem westenglischen Newent, wo das örtliche Pub eigens Strand-Liegestühle vor einer Großleinwand aufgestellt hatte. Diese blieben leer, wie die Kasse der danebenstehenden Verkäuferin einer Obdachlosen-Zeitung.
In London hingegen eine goldene Kutsche, Kürassiere hoch zu Ross, Tausende marschierender Soldaten unter klingendem Spiel – all das gab die schönen Fernsehbilder ab, die man von Gelegenheiten royaler Prachtentfaltung gewohnt ist. Der Glamour aber sollte nicht davon ablenken, worum es am Samstag vor allem ging: einen auf jahrhundertealten Traditionen beruhenden Gottesdienst, der den 74-jährigen Monarchen mit seinen vielen Vorgängern, darunter dem geköpften Charles I. (1600-49), und wenigen Vorgängerinnen in die Reihe alter biblischer Könige stellt.
Wer dem zweistündigen Geschehen in der Westminster Abbey zusah, mag erhabene Musik und anrührende Bilder im Gedächtnis behalten haben. Für viele wird der Moment entscheidend gewesen sein, als der Erzbischof von Canterbury dem 74-Jährigen die Edwardskrone aufs Haupt drückte und wie ein Hutmacher nachprüfte, ob das ungewohnte Teil auch ordentlich saß. Dass Justin Welby anschließend wie ein Einpeitscher im Fußballstadion „God save the King“ rief, woraufhin der Slogan tausendfach zurückschallte – das hatte natürlich höchsten theatralischen Wert.
Ein spirituell Suchender
Wenig Zweifel aber bestehen bei Kennern der königlichen Seele, dass für Charles der vorhergegangene Vorgang viel wichtiger war: die Salbung durch den Erzbischof, wozu Händels berühmte Vertonung einer Passage aus dem Buch der Könige im Alten Testament erklang: „So wie Salomon gesalbt ward durch Zadok, den Priester, und Nathan, den Propheten …“ Diese zentrale religiöse Handlung wurde hinter etwas albern bemalten Stellwänden zelebriert und damit vor den Fernsehzuschauern verborgen.
Wie seine im September verstorbene Mutter nimmt auch König Charles seinen Glauben sehr ernst. In den Tagen nach der Amtsübernahme sprach er stets davon, er sei zu seiner Aufgabe „berufen“. Wie für Elizabeth ist auch für deren Sohn das Leben als Monarch nicht lediglich eine Position, die ihm von Sterblichen übertragen wurde.
Von Elizabeth II. wusste man, dass sie einem unkomplizierten Kinderglauben anhing und fest in der anglikanischen Staatskirche wurzelte. Hingegen geriet der Thronfolger mehr nach seinem Vater Philip, der Kleriker gern mit bohrenden Fragen zu theologischen Schriften ins Schwitzen brachte. Auch Charles versteht sich als spirituell Suchender. Seinem Biografen Jonathan Dimbleby hatte der damalige Prinz vor knapp 30 Jahren ausführlich über sein Interesse an den großen Konfessionen der Welt berichtet. Die weiterhin bestehenden Gegensätze, zumal zwischen den diversen Zweigen der Christenheit, seien doch eigentlich ganz irrelevant, ja geradezu gefährlich, gab der spirituell Suchende zu verstehen. Er, Charles, wolle weniger den Glauben verteidigen, sondern das Glauben – in diesem Kernsatz konzentrierte sich Charles‘ Zweifel am Eid, den britische Monarchen zu sprechen haben. Schließlich sind sie neben manch anderem auch weltliches Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche von England.
Dabei könnten die Briten kirchenferner, ja religionskritischer kaum sein. Bei der Volkszählung vor zwei Jahren identifizierten sich gerade noch 46,2 Prozent der Untertanen Ihrer und nunmehr Seiner frommen Majestät als Christen, weniger als eine Million Menschen gehen einigermaßen regelmäßig zur anglikanischen Messe, bei den Katholiken sind es nur unwesentlich mehr.
Ärger wegen „Huldigung“
Der Rolle des Kirchenoberhauptes hat sich Charles längst gebeugt. Der christlich-anglikanische Festgottesdienst versuchte aber doch, die anderen christlichen Strömungen sowie Angehörige anderer Religionen einzubeziehen. Premierminister Rishi Sunak, ein gläubiger Hindu, verlas die Epistel aus dem Kolosserbrief des Paulus. Eine Jüdin, ein Muslim und ein Sikh, sämtlich Angehörige des Oberhauses, durften royale Insignien wie Sporen, Ring oder Robe zum Altar bringen.
Auch Frauen spielten eine zentrale Rolle. So las die Bischöfin von London aus dem Lukas-Evangelium. Penelope Mordaunt, im normalen Leben konservative Ministerin für das Gesetzgebungsprogramm der Regierung im Unterhaus (Leader of the House), erhielt Bewunderung für die stoische Ruhe, mit der sie das 3,6 Kilo schwere Staatsschwert in Gleichgewicht hielt.
Wie nervös viele der Beteiligten waren, zeigte sich in der Tatsache, dass fast alle ihre kurzen Einlassungen von eigens angefertigten Spickzetteln ablasen. Das galt im Fall des Erzbischofs auch für einfachste religiöse Formeln, die eigentlich jeder Geistliche im Schlaf hersagen kann.
Welby, 67, hatte vorab für eine politische und religiöse Kontroverse gesorgt. In der vor Wochenfrist veröffentlichten Gottesdienst-Ordnung war von der Aufforderung des Erzbischofs an die Gemeinde die Rede, Menschen in der Kirche ebenso wie vor den Radio- und Fernsehgeräten sollten dem König „huldigen“. Die vorgeschlagenen Worte entsprachen im Wesentlichen dem Eid, den Zuwanderer bei ihrer Einbürgerungszeremonie leisten müssen. Allerdings besteht dabei die Möglichkeit, „feierlich zu bekräftigen“ anstatt sich auf eine Religion zu berufen.
Weder Harry noch Andrew auf dem Balkon
Welby erhielt sofort heftigen Widerspruch, nicht zuletzt von Klerikern selbst. Offenbar bekam daraufhin der König kalte Füße. Jedenfalls schickte er am Freitag seinen alten Freund Dimbleby an die Medienfront. Die ganze Idee sei „gut gemeint, aber nicht durchdacht“, teilte der 78-Jährige wegwerfend mit: „Soweit ich weiß, wollte der König noch nie, dass ihm jemand huldigt, es sei denn im Spaß.“ Eilends änderte die Staatskirche den Ablauf: Statt zu huldigen wurden die Briten nun lahm dazu aufgerufen, ihren Monarchen „zu unterstützen“.
Auf ausdrücklichen Wunsch des Königs hatte sich der legendäre Dirigent John Eliot Gardiner – die beiden kennen sich als Schafzüchter – um die Musik des Tages gekümmert. Dementsprechend bekamen die frühen Gäste Auszüge aus dem Magnificat und der Kantate „Singet dem Herrn“ von Johann Sebastian Bach zu hören. Im Lauf des Gottesdienstes sank das Niveau, insbesondere dann, wenn die uninspirierte Krönungsmusik englischer Komponisten wie William Boyce (für George III., 1761), Hubert Parry (für Eduard VII., 1902) und William Walton (für Elizabeth II., 1953) erklang.
Reibungslos verlief am Nachmittag, trotz tief hängender Wolken und Dauerregen, der Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes und der Vorbeiflug von Hubschraubern und Düsenjets der Royal Air Force. Zu besichtigen waren die sogenannten „working royals“ sowie deren Kinder und Enkel; weder Charles’ Sohn Harry, der zur Stippvisite aus Kalifornien angereist war, noch Charles’ Bruder Andrew, dem ein Sexskandal anhängt, waren geladen. Der König hat seit langem versprochen, er wolle die Institution verschlanken. Das wird schon aus biologischen Gründen gelingen: Viele der noch aktiven Royals, etwa zwei Cousins der verstorbenen Queen, haben die 70. Jahresgrenze bereits überschritten und dürften sich demnächst in den Ruhestand zurückziehen. Hingegen wartet auf Charles, 74, und Camilla 75, viel Arbeit – ganz egal, wie gut oder schlecht das Wetter wird.

 De Maart
De Maart


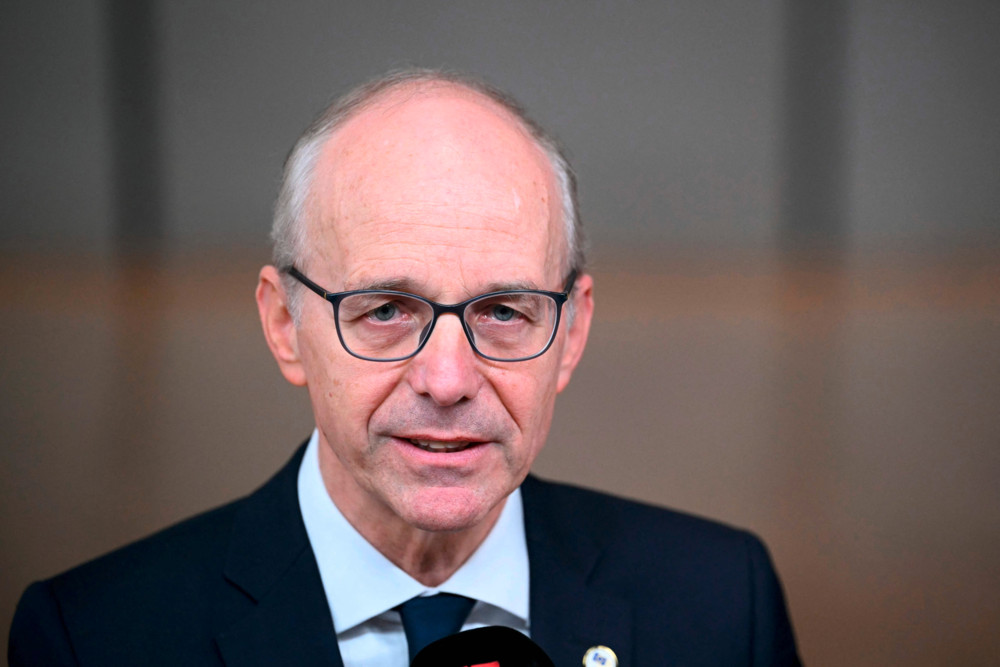

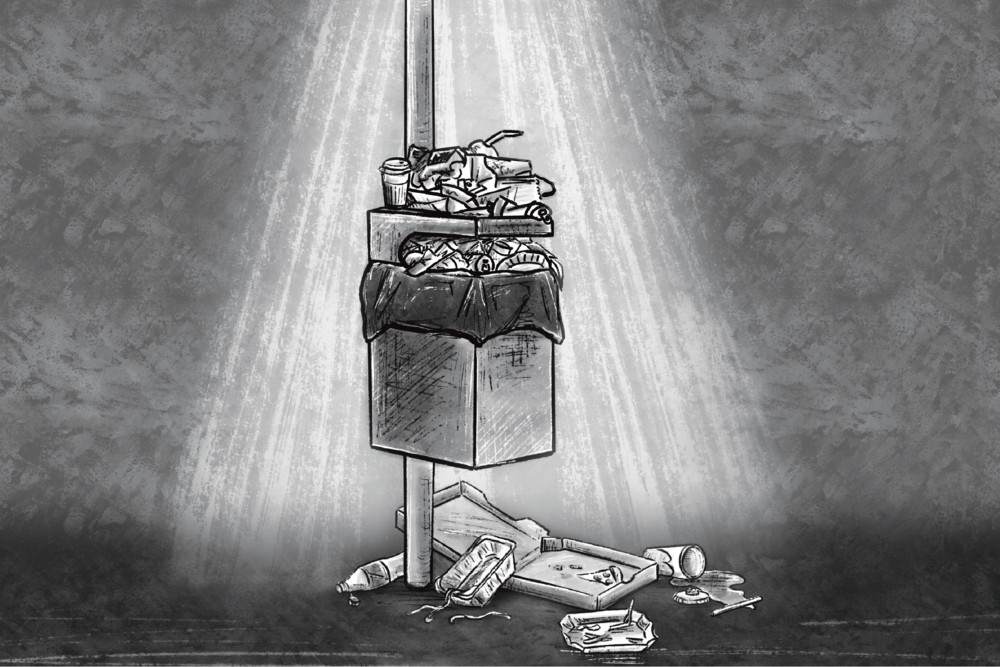


Ne wéi romantesch. E schéint Märchen. Vun engem Moment op den aneren ass an dem Vollek kee Mënsch méi aarm, et ass kengem méi kal, huet keen méi wéi a jiddereen eng gutt bezuelten Aarbecht.
De Charel freet sech drop, fir wann en endlech mat senge Kinnigin eleng am Schlofzëmmer ass, si ze froen:" Würden Sie, verehrenswürdige Frau Gemahlin und Königliche Hoheit Ihrem Gemahl, dem gleichfalls Hoheitsvollen König von Großbritannien und der umliegenden Dörfer, die Erlaubnis erteilen, zur Feier des Tages ausnahmsweise durch seine eigenen Hände Ihren Hoheitlichen Busen aus der Enge des Büstenhalters zu befreien? Ich habe Ihre Zofe beurlaubt."
Natierlech géing hien dat alles op englesch froen, dat kennt ech net, awer dat anert.
en
Kënnt Der dee Kabes net dem Wort iwwerloossen?
Déi hu 1500 Artikelen, do kënnt Der souwisou net mathalen.