Wenn jemand einen Bestseller nach dem anderen schreibt, könnte dies eigentlich ein guter Indikator dafür sein, dass man am besten die Finger von seinen Büchern lassen sollte. Beim schwedischen Schriftsteller Frederik Backman ist das anders.
„Der Schwedenroman ist inzwischen sozusagen das Billy-Regal der Unterhaltungsliteratur. Er ist unkompliziert, er ist ein Begleiter in vielen Lebenslagen, und vor allem ist er in fast jedem Haushalt zu finden.“ Das, was Steffen Jacobs vom rbb-kulturradio hier statuiert, trifft die publizistische Realität zwar recht gut – und doch ist seine Behauptung nicht vollends zutreffend.
Wenn auch spätestens nach der „Millennium“-Trilogie des schwedischen Journalisten und Autoren Stieg Larsson ein Hype um Romane aus dem skandinavischen Raum ausbrach, der bis heute nicht abklingen möchte, so liegt der Grund dafür definitiv nicht darin, dass Literatur aus dieser Ecke der Welt tendenziell unkompliziert daherkäme und lediglich darauf abzielen würde, zu unterhalten.
Vielmehr schaffen es zahlreiche Filme, Serien und eben auch literarische Werke aus dem Norden Europas häufig, spannende Charakterstudien zu präsentieren, ohne gleich in Extreme zu verfallen. Es wird nicht dick aufgetragen oder sich mit unnötigem Pomp und Deko aufgehalten, sondern gerade durch die eher nüchterne und bodenständige Haltung gegenüber den eigenen Figuren entsteht Raum für filigrane Details, die so manchen Charakter zwar außergewöhnlich und verschroben, aber trotzdem dem wahren Leben entnommen wirken lassen. Es entsteht eine Identifikationsebene, die den Leser nicht zum Flüchten veranlasst, sondern dazu, Missstände in Angriff zu nehmen.
Meister seiner Zunft
Ein wahrer Meister dieser Zunft ist der 34-jährige Schwede Fredrik Backman, der einst Religionswissenschaften studierte, abbrach und später dann als Gabelstaplerfahrer, Kellner und auch als Journalist tätig war, bevor er zu bloggen begann. Nun hat er den Status eines der bekanntesten Bestsellerautoren seines Landes inne. Dies lässt ein klein wenig aufatmen, da es scheinbar doch noch eine große Leserschaft jenseits der Kochbuchfanatiker und Pseudoerotikliebesschnulzenanbeter gibt.
Backmans Spezialität liegt im Anfertigen von Psychogrammen kleiner und mittelgroßer sozialer Gefüge. Somit trifft er den Nerv der Zeit und geht indirekt, ja vielleicht sogar unbeabsichtigt, fast schon aktivistisch gegen aktuelle soziopolitische Probleme vor, da er, statt melodramatische Abhandlungen über Nischenthemen zusammenzudichten, die ein großer Prozentsatz der potenziellen Leserschaft ohnehin nicht versteht, anhand von raffiniert gezeichneten Porträts versucht, zu erklären, warum der gesellschaftliche Karren zuerst im Kleinen gegen die Wand gefahren wird und dann erst das Miteinander im Großen scheitern kann, eventuell sogar muss.
Kein Handeln ist auch keine Lösung
Seine Romane handeln jedoch nie nur vom Scheitern allein, eher zeigen sie ohne erhobenen Zeigefinger und mit einem sehr eigenen, teils herrlich abstrusen Humor, wie Empowerment entstehen und funktionieren kann. Sei es bei „Ein Mann namens Ove“, in dem ein mürrischer ordnungsfetischistischer Rentner versucht, Suizid zu begehen, aber dies ihm einfach nicht gelingen will, da Menschen aus der Nachbarschaft in der kleinen Reihenhaussiedlung ihn in seiner gehegten und gepflegten Misanthropie stören.
Oder auch in „Britt-Marie war hier“, wo man einer älteren Frau mit ausgeprägtem Putzfimmel begegnet, die sich, nachdem sie mehr als ihr halbes Leben damit zugebracht hat, ihrem Gatten (der ihr fremdging) eine gute Ehefrau zu sein und Kreuzworträtsel zu lösen, in einem von der Finanzkrise gebeutelten Kaff als Hausmeisterin wiederfindet, da das Arbeitsamt Fällen wie dem ihrigen scheinbar nicht mehr bieten kann.
Bei beiden Romanen handelt es sich quasi um eine Art Coming of Age Story für Fortgeschrittene, welche die Hauptpersonen aber zu keinem Moment ins Lächerliche zieht, da nicht sie mit ihren Eigenarten im Fokus stehen, sondern ersichtlich wird, dass der Begriff „normal“ in der heutigen Gesellschaft total obsolet ist, weil jede Schüssel ihren Riss hat. Daher entwickeln sich die Protagonisten nicht allein, sondern im Verbund mit vielen Nebenakteuren weiter; es wird langsam, aber sicher entschlüsselt, warum ein verqueres Miteinander zu bestimmten Verhaltensweisen führen und wie man gemeinsam neue Gedankenwege gehen kann.
Verzicht auf Pathos und Kitsch
Fredrik Backman verzichtet dabei trotz harter Themen wie beispielsweise Krankheit, Tod oder auch Misshandlung auf jeglichen Pathos und Kitsch. Vielleicht gelingt es ihm gerade durch die Einfachheit seines Stils, zu berühren oder da zu treffen, wo es wehtut. Denn wer rausfinden möchte, warum die Welt oder auch die Gesellschaft mit leisen, aber teilweise auch immer lauter werdenden Schritten zugrunde geht, der verpasst es leider manchmal allzu gern, zuvor erst einmal bei sich selbst anzufangen. Zu verführerisch ist es, in etwas Hochkomplexem, Obskurem, in weiter Ferne Befindlichem nach Ursachen dafür zu suchen.
Wenn auch sein Stil eher einfach gehalten ist, so sind es die behandelten Themen nur auf den ersten Blick. In „Kleine Stadt der großen Träume“ geht es zum Beispiel anfänglich zwar scheinbar hauptsächlich um Eishockey, das eine verschlafene Stadt im Innersten zusammenhält, aber bald wird sich herausstellen, wie dieser Sport und vor allem die im Dorf mit ihm zusammenhängenden Dynamiken gefährliche Züge annehmen können.
Obgleich der junge schwedische Autor zu keinem Moment richtet, lässt er mittels des Handelns bestimmter Figuren (interessanterweise nicht immer, aber häufig Mädchen oder Frauen) keinen Zweifel daran, dass Wegschauen und Nichteinschreiten keine zu legitimierenden Alternativen sind.
Astrid Lindgren ist Backmans Aussage zufolge seine Lieblingsautorin. Gewissermaßen lesen sich seine Werke wie eine moderne Fassung ihrer Kinderbücher, die schon immer weitaus mehr waren als nur schlichte Unterhaltungsliteratur. Absolut lesenswert also!
Warum Sie dieses Buch unbedingt im Urlaub lesen sollten
Weil die hohe Anzahl der Seiten einerseits die Panik davor, dass es bald vorbei sein könnte, abflauen lässt und andererseits vorzüglich dazu geeignet ist, sich in das Buch zu vertiefen, während andere im Flugzeug extrem schnarchen, am Pool überteuerte Cocktails schlürfen oder prahlhälsige Diskussionen führen, die jeglichen Inhalts entbehren.
Weil etliche der beschriebenen Charaktere und Situationen ebenso gut der Realität in Luxemburg entliehen sein könnten. Vielleicht wird der Roman Ihnen dabei helfen, den unglaublich nervigen Nachbarn etwas besser zu verstehen oder den örtlichen Dorfverein in seinem Habitus und Kollektivitätsbewusstsein mal zu hinterfragen.
Weil er trotz seiner Antihelden eher eine unkonventionelle Schiene verfolgt. Es sind nicht die sogenannten „Randgruppen“, die ihren Weg zurück in die Gesellschaft beschreiten und schaffen müssen, sondern die Gesellschaft, die sich glücklich schätzen kann, dass es Menschen gibt, die dadurch, dass sie aus dem Rahmen fallen, zeigen, was eigentlich zählt.
Weil es nicht schaden kann, durch das Lesen und Emanzipieren von der eigenen Realität nach der Lektüre dieser vielleicht ein Stück weit näher zu sein. Lesen kann bekanntermaßen eine Flucht sein, bei Backman bringt sie einen aber dahin zurück, wo man zuvor noch davor weglief. Nur dass man nach der Rückkehr weniger Angst und mehr Mut hat.

 De Maart
De Maart


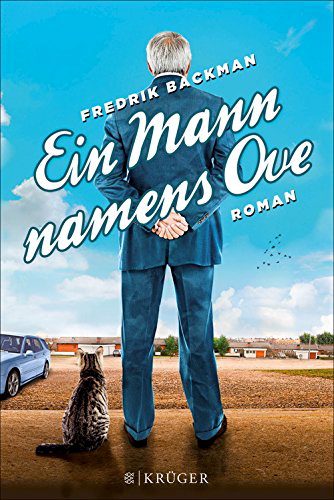
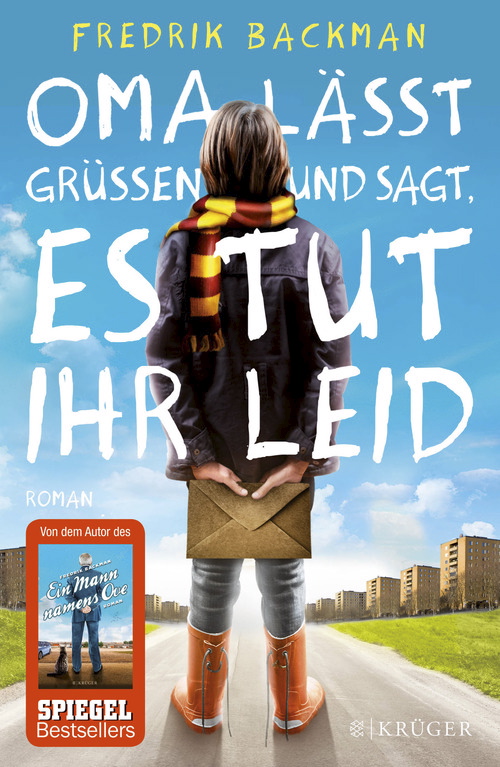
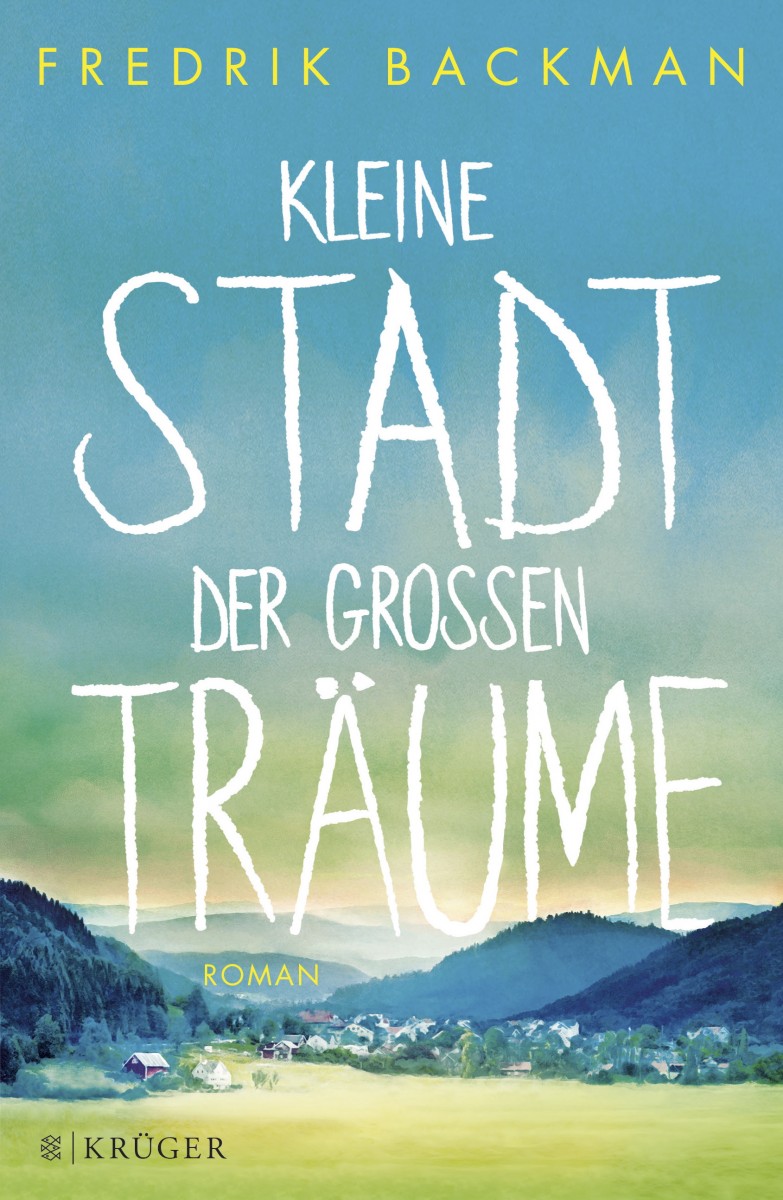
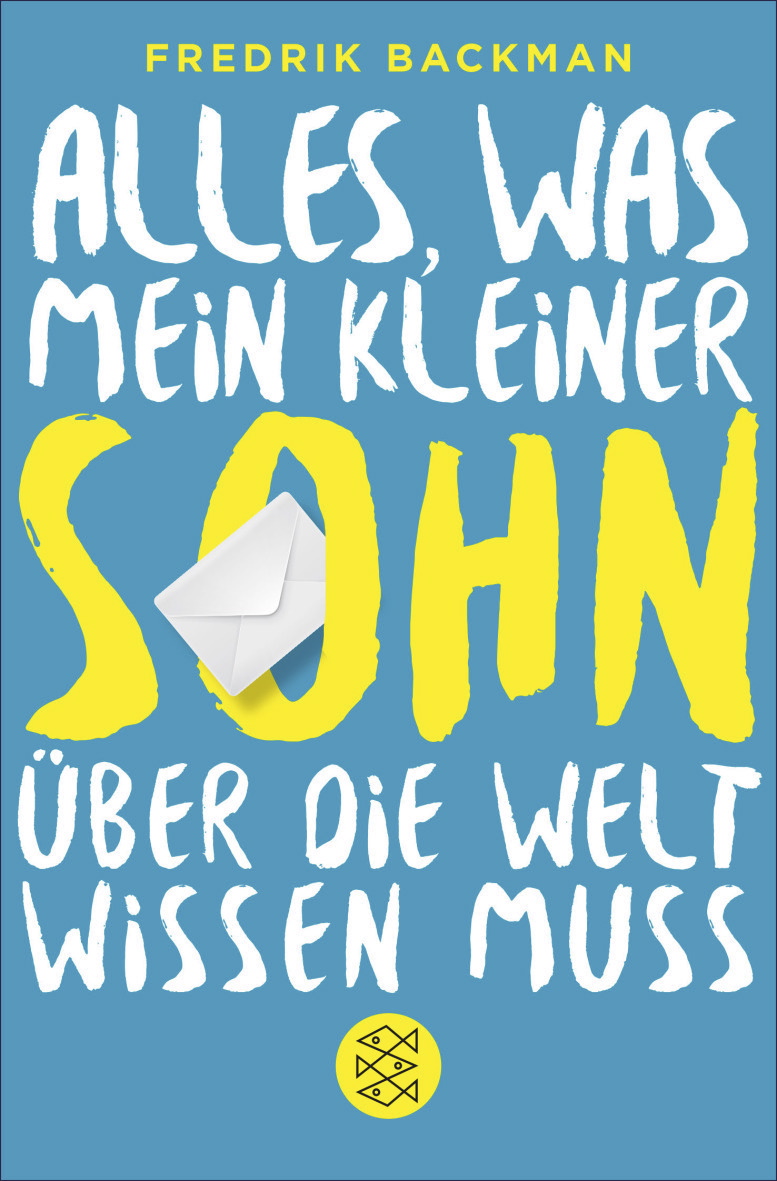
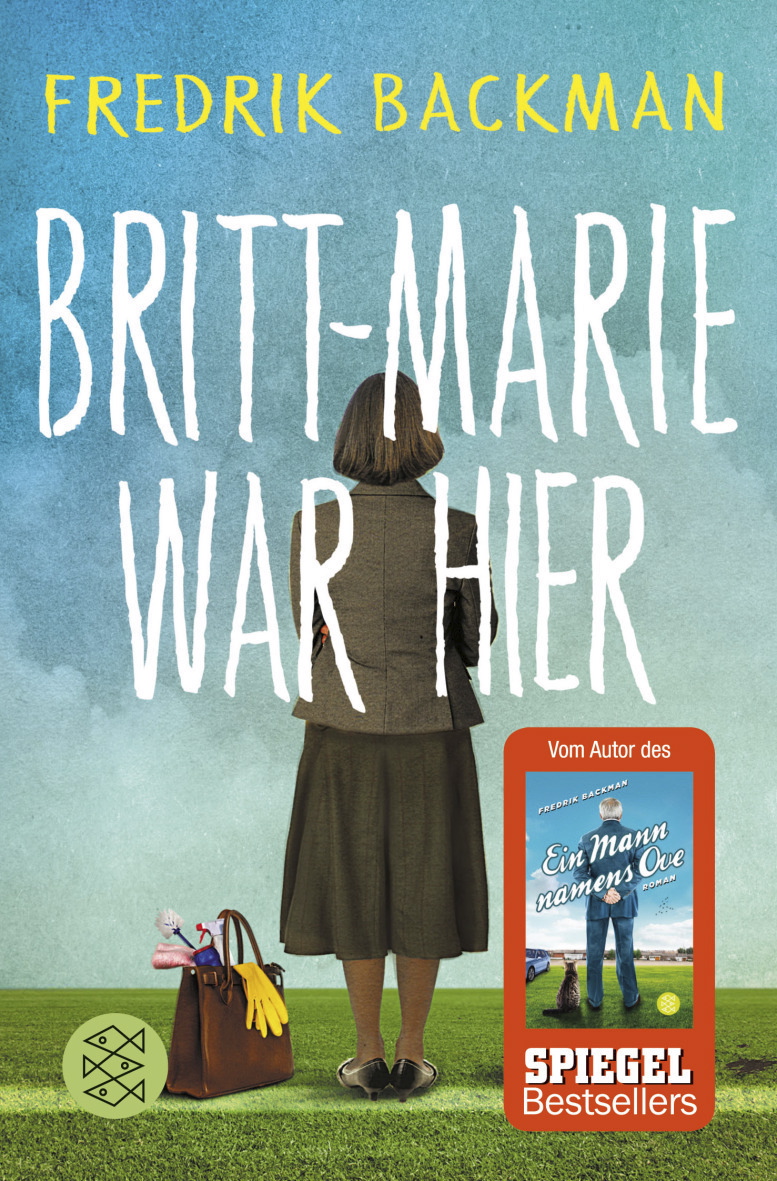
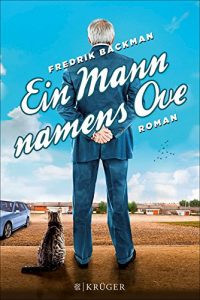
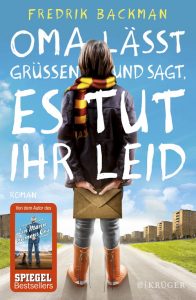
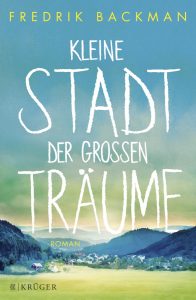
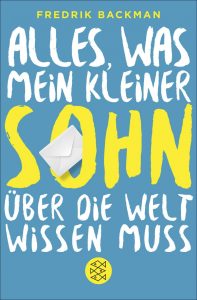
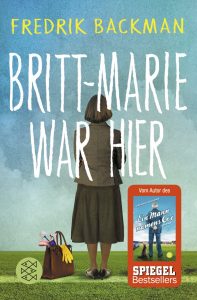






Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können