Bei den Verlierern war am Montag Wunden lecken angesagt, wobei SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig relativ gelassen ans Werk gehen konnte. Von den 39,5 Prozent für seine Partei bei einem Minus von 2,2 Prozentpunkten können Genossen in den anderen Bundesländern und auch Parteichef Andreas Babler nur träumen. Die vielen Krisen der vergangenen Jahre hätten eben auch die Wiener SPÖ Stimmen gekostet, erklärt Ludwig den erträglichen Verlustschmerz.
Weniger leicht tut sich die am Sonntag auf nur noch 9,7 Prozent mehr als halbierte ÖVP von Bundeskanzler Christian Stocker. Spitzenkandidat Karl Mahrer, der am Wahlabend noch krampfhaft das Desaster schönzureden versucht hatte, musste gestern doch das Unausweichliche tun und zurücktreten. Ob es die ÖVP nun noch in die Stadtregierung schafft, ist zweifelhaft. Anstatt sich mit dem Verlierer zusammenzutun, könnte Ludwig auch seine Koalition mit den liberalen NEOS fortsetzen, die am Sonntag als einziger Partner der Ampelkoalition im Bund dazugewonnen haben.
Die Ausgegrenzten
Die ÖVP würde damit das Schicksal der FPÖ teilen, die sich am Sonntag zwar mit 20,4 Prozent der Stimmen fast verdreifacht hat, aber sich weiter nur als Ausgrenzungsopfer inszenieren kann, weil Ludwig mit den Rechtspopulisten nichts zu tun haben will.
Kaum debattiert wird dagegen ein echtes Ausgrenzungsproblem, das jedoch die politische Landkarte ganz entscheidend beeinflusst. Obwohl die Bevölkerung Wiens in den vergangenen 20 Jahren von 1,6 auf zwei Millionen gewachsen ist, sank im selben Zeitraum die Zahl der Wahlberechtigten um 32.000 auf 1,11 Millionen. Das Bevölkerungswachstum resultiert nämlich zur Gänze aus der Zuwanderung. Dies führte dazu, dass bei den Wahlen am Sonntag rund 35 Prozent der Menschen im wahlfähigen Alter nicht abstimmen durften. In manchen Bezirken der Bundeshauptstadt ist das Problem noch viel gravierender. In Rudolfsheim-Fünfhaus etwa haben fast 46 Prozent der über 16-jährigen Einwohner keine österreichische Staatsbürgerschaft, in einigen Wahlsprengeln in Favoriten liegt die Quote der Wahlrechtslosen schon über der Hälfte. Die wenigen EU-Bürger unter ihnen durften immerhin über die Bezirksvertreter mitbestimmen, von den Gemeinderats- und Landtagswahlen waren auch sie ausgeschlossen.
Potenzial für SPÖ
Wie die jüngsten Wahlen unter Beteiligung aller wahlfähigen Bewohner Wiens ausgegangen wären, lässt eine in der Woche vor dem Urnengang durchgeführte Befragung des Foresight-Institutes unter 2.500 Wiener Migranten erahnen. Für die SPÖ ergab sich ein hochgerechneter Wert von 48 Prozent, also fast 13 Prozentpunkte mehr als sie tatsächlich erreicht hat. Statt eines kleinen Minus hätte Ludwig ein dickes Plus feiern können. Die ÖVP dagegen hätte mit sieben Prozent noch schlechter abgeschnitten. Auch die FPÖ wäre mit 18 Prozent deutlich schwächer, obwohl ihr Schüren von Verlustängsten selbst bei manchen – weitere Migration ablehnende – Migranten verfängt. Schlechter abgeschnitten hätten mit 10 bzw. 7 Prozent auch Grüne und NEOS. Lediglich die KPÖ hätte wie die SPÖ ein besseres Ergebnis und mit fünf statt tatsächlich vier Prozent den Einzug in den Gemeinderat geschafft.
Keine Reform in Sicht
Eine Änderung des gegenwärtig restriktiven Wahlrechtes zeichnet sich nicht ab. Warum das so ist, lässt sich mit der Frage „Cui bono“ beantworten: Die SPÖ befürwortet seit Langem eine Öffnung des Wahlrechtes für Menschen mit Migrationshintergrund, während die potenziellen Verlierer einer solchen Reform – ÖVP und FPÖ – strikt dagegen sind. Die NEOS fordern lediglich das uneingeschränkte Wahlrecht für alle EU-Bürger, die mindestens ein halbes Jahr ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Nur die Grünen wollen ungeachtet drohender Verluste auch Drittstaatsangehörigen zum Wahlrecht verhelfen.
Demokratieprobleme
Angesichts einer derart hohen Wahlrechtlosenquote hat die österreichische Demokratie ein Repräsentationsproblem, das noch dazu immer größer wird. Nicht nur Wien, auch andere urbane Regionen sind davon betroffen. Allerdings hätte die demokratische Lösung des Problems auch einen kontraproduktiven Aspekt. Auch das zeigt sich in Wien. Denn das große migrantische Potenzial der Sozialdemokraten ergibt sich auch aus einem Niederreißen aller Hemmschwellen gegenüber extremistischen Strömungen vor allem in der türkischen Gemeinschaft.
Werben um Graue Wölfe
So hatte die Wiener SPÖ im vergangenen Wahlkampf ohne Rücksicht auf ihre türkische Schwesterpartei CHP die große Anhängerschaft von Präsident Recep Tayyip Erdogan umworben. Während Bürgermeister Ludwig eine Solidaritätsbekundung für den abgesetzten und inhaftierten Istanbuler CHP-Bürgermeister Ekrem Imamoglu konsequent verweigerte, lud er kurz vor der Wahl mehrere türkische Bürgermeister von Erdogans AK-Partei nach Wien ein. Die türkischstämmige SPÖ-Abgeordnete Aslihan Bozatemur besuchte sogar eine Ramadanfeier der rechtsextremen Grauen Wölfe. Nicht nur in Wien pflegt die SPÖ mit Blick aufs türkische Wählerpotenzial beste Kontakte zur islamischen Milli-Görüs-Gemeinschaft, die in Deutschland als extremistisch und verfassungsfeindlich eingestuft ist. Während die Genossen nicht müde werden, autochthonen Rechtsextremismus zu brandmarken, sind sie beim importierten Extremismus auffallend still. Dass dieser mindestens ebenso große Beachtung verdiente, zeigt der jüngste Jahresbericht der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG): Erstmals ging 2024 die Mehrzahl der antisemitischen Übergriffe in Österreich nicht auf das Konto rechter Extremisten, sondern wurde von Muslimen verübt.

 De Maart
De Maart






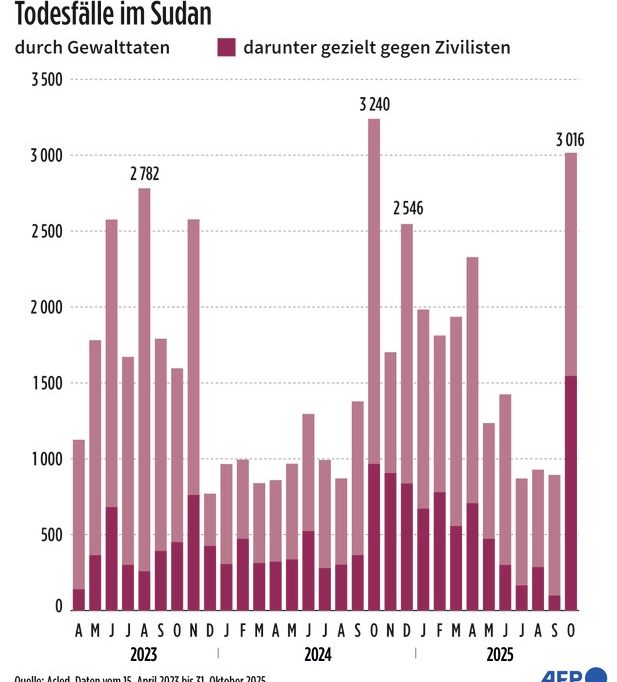
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können