Man stelle sich vor, es gebe kein Wachstum mehr – und niemanden würde es stören. Die Experten vom Statec würden keine Alarmglocken läuten und die Politik nicht in Panik verfallen. So ungefähr ist es, wenn man Timothée Parrique zuhört. Der 35-jährige Franzose, der an der Universität Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines Wirtschafts- und Umweltwissenschaften und im schwedischen Uppsala ökologische Ökonomie und Nachhaltigkeitswissenschaften studiert hat, ist ein Verfechter des Degrowth und Postwachstums. Dazu hat er seine Dissertation „The Political Economy of Degrowth“ geschrieben, in der es um die sozialen und ökologischen Folgen des Wirtschaftswachstums geht – und schließlich um die verschiedenen Ansätze, den Degrowth umzusetzen.

Vor zwei Jahren hat Parrique dies unter dem Titel „Ralentir ou périr. L’économie de la décroissance“ veröffentlicht. Er befürwortet darin „eine Verringerung von Produktion und Wachstum, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern, die demokratisch im Geiste der sozialen Gerechtigkeit und im Interesse des Wohlstands geplant wird“. Nun war der Franzose, der mittlerweile an der Universität in Lausanne forscht, anlässlich des 20. Geburtstages des „Conseil supérieur pour un développement durable“ (CSDD) in Luxemburg.
Parrique kritisiert die eng mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Wachstumsdenken verhafteten Konzepte, die die Menschen dazu gebracht haben, die planetaren Grenzen zu überschreiten. Er lehnt aber auch das Konzept des „grünen Wachstums“ ab, denn er hält ein Wachstum ohne Umweltverschmutzung, Ressourcenabbau und Treibhausgasemissionen für unmöglich. Als Alternative schlägt er ein Modell für eine Postwachstumsgesellschaft vor, die zu Gleichheit, sozialer Gerechtigkeit und kollektivem Wohlbefinden beiträgt. Den Degrowth, das Schrumpfen. „Ein Plan B zum grünen Wachstum“, wie er sagt. Der zu weniger Quantität führt, aber dadurch zu mehr Lebensqualität und zu mehr Gerechtigkeit.
Mehr Qualität als Quantität
Parrique befürwortet Low-Tech, weil er der Ansicht ist, dass die CO2-Neutralität nicht durch technologische Innovation erreicht werden kann. In seinem Vortrag am Freitagnachmittag in Luxemburg vor Journalisten, bevor er vor dem großen Publikum auftrat, erklärt er auf durchaus unterhaltsame, gar witzige Art und Weise seine Theorie, der aller Staub der vermeintlichen Trockenheit abfällt. Dass die Fragen, um die es geht, Fragen von Leben und Tod für künftige Generationen sind, fällt dabei kaum auf. Er gibt in der Einleitung zu „Ralentir ou périr“ zu, dass es üblich sei, den „extremen Ernst der Lage“ zu betonen. „Aber warum Zeit verschwenden? Jeder weiß, dass es ein Problem gibt, das es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Der Umweltkollaps, mit dem wir nun konfrontiert sind, bringt jeden Tag neue Katastrophen mit sich, und nur wenige würden es jetzt noch wagen, die überwältigende Verantwortung unserer Spezies zu bestreiten.“ Er spricht von einer allgemeinen Schuld, für die sich jeder Einzelne zu schämen hätte und die nur gemeinsam gesühnt werden könnte.
„Wirklich die ganze Menschheit?“, fragt Parrique. Schließlich besaßen im Jahr 2021 die zehn Prozent reichsten Haushalte der Welt 76 Prozent des Gesamtvermögens. Der neue Degrowth-Star spricht von der Planbarkeit der Wirtschaft, von deren sozialem Aspekt und vom „budget carbone“. Zwar ist es um die wachstumskritische Bewegung in jüngster Zeit etwas ruhiger geworden, aber sie ist nie verstummt. Parrique ist nicht der Erste, der mit den Dogmen der Wachstumsökonomie aufräumt, mit der des BIPs, das nicht den Wohlstand, sondern die Produktion einer Volkswirtschaft misst. Bei einem deutlichen Wachstum wächst nicht zuletzt auch die Armut, wenn die Erträge wie üblich ungleich verteilt sind, weiß Parrique. Er zieht vier Kriterien heran: „democracy“, „justice“, „well-being“ und „sustainability“. Und er widerlegt die Thesen seiner Gegner, dass eine Wachstumsbegrenzung nur zu mehr Armut und Ungleichheit führen würde und Verzicht vor allem innovationsfeindlich oder gar totalitär sei. Ihm geht es um eine nachhaltige und sozial gerechte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Der „Nohaltegkeetsrot“, der sich in einer Schlüsselrolle bei der Förderung von politischen Maßnahmen sieht, hat zu seiner 20-Jahr-Feier den Podcast „One Planet, 20 Futures“ mit 20 Interviews gestartet. Ein Highlight war sicherlich die Debatte im hauptstädtischen Athénée, bei der sich Timothée und seine Gesprächspartner Serge Allegrezza (Statec), François Mousel (PwC), Aline Muller (Liser) und Christian Schulz (Uni Luxemburg) mit der Frage auseinandersetzen sollten: „Le pays doit-il organiser sa décroissance?“ Ein Thema, das gerade unter der aktuellen Regierung brisant ist.

 De Maart
De Maart

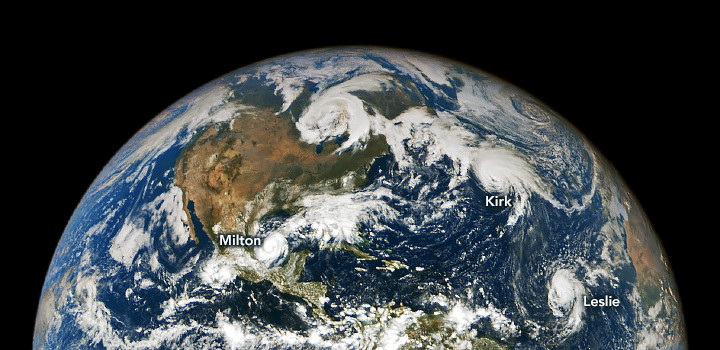







Zur Aktuellen Rentendiskussion ,wuerde ideologisch gefaerbtes null Wachstum ,oder schlimmer noch Schrumpfwachstum wie die Faust aufs Auge passen .Mit diesem Hirngespinst waere die Armut weltweit nie halbiert worden ,und an die Verteilungskaempfe die dann ausbrechen wuerde wage Ich nicht mal zu denken . wir hatten das grosse Glueck dass bis jetzt jede Regierung den Dogmen des Wachstums verpflichtet war .