Mobbing ist in unserer Gesellschaft ein weit verbreitetes Phänomen. Oft wird es mit toxischen Arbeitskulturen, autoritären Chefs oder modernen Managementmethoden in Verbindung gebracht. Doch nicht jede als belastend empfundene Führung ist gleich Mobbing im klassischen Sinne. Doch allein die Tatsache, dass Menschen diese Parallelen ziehen, ist bezeichnend. Ein tiefes Unwohlsein breitet sich in vielen Betrieben und Verwaltungen aus – auch in Luxemburg, etwa in Kommunen wie Contern und Sandweiler.
Es geht um mehr als nur schlechte Führung oder strukturelle Probleme in Unternehmen. Es geht um einen schwelenden gesellschaftlichen Konflikt, der den Graben zwischen „uns hier unten“ und „denen da oben“ stetig vertieft. Diese „oben“ – ob Politiker, Manager oder andere Entscheidungsträger – präsentieren ihre Maßnahmen oft in wohlklingenden Worten, während sich darunter bei vielen Bürgern und Arbeitnehmern Frustration und Enttäuschung aufstauen.
Scheinbeteiligung und Misstrauen
Ein zentraler Punkt dieser Unzufriedenheit ist das Gefühl, dass Mitspracherecht zwar proklamiert, aber tatsächlich eher selten wirklich gelebt wird. Es gibt Beteiligungsprozesse, Workshops und Diskussionsrunden, doch wenn Entscheidungen letztlich schon feststehen oder lediglich aus Prinzip Veränderungen eingeführt werden – nicht, um echte Verbesserungen zu erzielen –, fühlt sich das für viele wie eine Farce an.
Genau hier liegt der Ursprung des tiefen Misstrauens, das sich gegenüber den Hierarchien entwickelt hat. Diese Entwicklung ist nicht auf Kommunalverwaltungen beschränkt, sondern durchzieht zahlreiche Branchen. Menschen erleben immer wieder, dass ihre Meinungen zwar angehört, aber nicht ernst genommen werden. Das Resultat ist eine wachsende Entfremdung zwischen Entscheidungsträgern und der arbeitenden Bevölkerung.
Das Management-Paradigma der Misstrauenskultur
Viele moderne Managementlehren gehen davon aus, dass nur eine kleine Elite wirklich engagiert ist, während ein Großteil der Belegschaften als eher träge oder ineffizient angesehen wird und es die Aufgabe der Führung sei, die „leistungsstarken“ Individuen herauszufiltern und besonders zu fördern. In diesem Denken liegt ein gefährlicher Irrtum: Es wird ignoriert, dass gerade diese selektive Förderung einzelner sogenannter Leistungsträger die soziale Kluft weiter verstärkt. Dieses Prinzip der Elitenbildung wird oft als modernes Talentmanagement oder Leadership verkauft, führt jedoch in der Praxis zu einer immer tieferen Spaltung der Belegschaften.
Statt Zusammenarbeit und Zusammenhalt zu fördern, entstehen dadurch Konkurrenzdenken, Unsicherheit und Abgrenzung. Wer sich nicht in die Riege der „High Performer“ einreiht, fühlt sich austauschbar, übergangen und nicht respektiert. Dieses Gefühl setzt sich in der Gesellschaft fort: Wer sich von der Politik nicht vertreten fühlt, von der Führungsebene nicht ernst genommen oder in Entscheidungsprozesse nur pro forma einbezogen sieht, verliert das Vertrauen ins System.
Das hat auch politische Folgen. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Stimme nicht zählt, suchen sie nach Alternativen – und oft sind es radikale Kräfte, die diese Unzufriedenheit gezielt aufgreifen. Dass die Gesellschaft immer weiter nach rechts rückt, hängt auch mit dieser tiefen Frustration zusammen.
Gefahr für den sozialen Zusammenhalt
All diese Entwicklungen sind nicht nur ein Problem einzelner Unternehmen oder Verwaltungen – sie bedrohen den sozialen Zusammenhalt und letztlich auch die Demokratie. Eine Gesellschaft kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn große Teile der Bevölkerung sich systematisch ausgeschlossen fühlen.

Work-Life-Balance bedeutet nicht nur flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice. Es geht auch um Anerkennung, Respekt und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Menschen brauchen das Gefühl, dass ihre Arbeit geschätzt wird, dass sie gehört werden und dass sie mitgestalten können. Wenn sie stattdessen erleben, dass Veränderungen über ihre Köpfe hinweg entschieden werden und ihre Leistung nur dann zählt, wenn sie sich ins vorgegebene Schema fügen, entstehen Frustration und Resignation.
Manager und Politiker sind auch nur Angestellte
Oft wird vergessen, dass auch Führungskräfte und Politiker keine unantastbaren Eliten sind, sondern letztlich ebenfalls Angestellte, abhängig von Wahlen, Verträgen oder Aktionären. Sie sitzen nicht in einem Elfenbeinturm, sondern sind Teil derselben Gesellschaft. Doch mit mehr Verantwortung kommt auch die Pflicht, den Dialog mit den Menschen zu suchen, anstatt sie mit Managementvokabular abzuspeisen.
Es braucht ein Umdenken. Moderne Führung darf nicht auf Elitenbildung und symbolischer Beteiligung basieren, sondern muss auf Vertrauen und echter Teilhabe beruhen. Andernfalls wird die Kluft zwischen „oben“ und „unten“ weiterwachsen – mit gefährlichen Folgen für die Gesellschaft als Ganzes.

 De Maart
De Maart
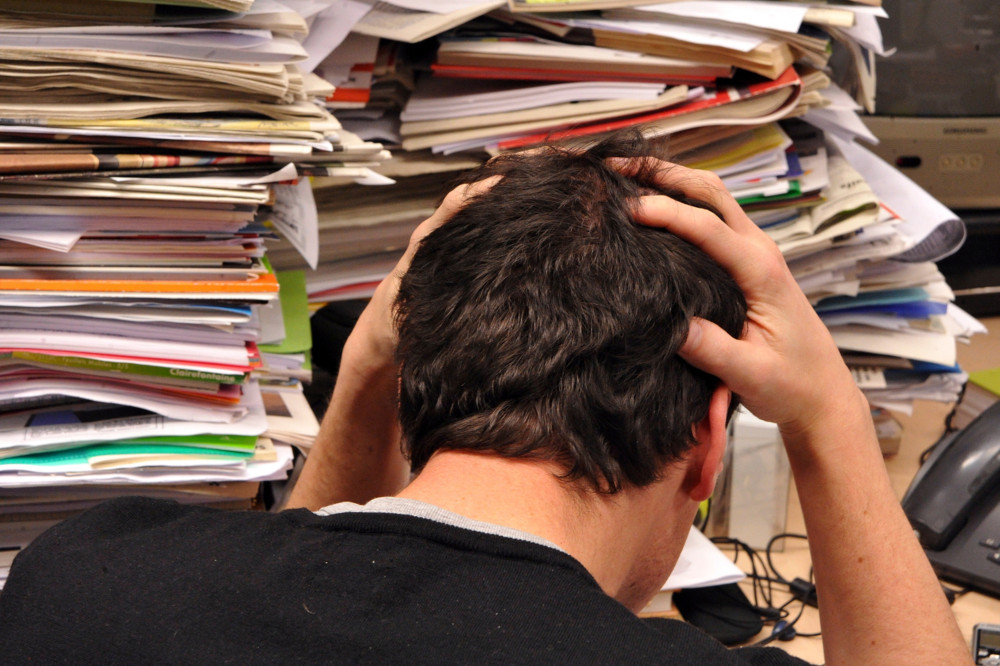






@ Mobbing.
Und wenn die Opfer wissen, wer die Täter sind ?
Handfeste Beweise sammeln :
von Arbeitsrechtverletzungen ; Fälschung von Texten ; Unbezahlten Überstunden ;
Mobbing .
Dies in Leserbriefen veröffentlichen, Berichte von Personalvertretern u. Arbeitnehmern, Zeugenaussagen vorlegen .
Und die Politik, Gewerkschaft, ITM sehen zu, ohne einzugreifen.
Was dann ?
Folgen für die Opfer : Krankheit - PTBS = Posttraumatische Belastungsstörung.
Das Wichtigste bei Mobbingopfern ist dass jemand ihnen sagt, wer die Täter sind. Das ist nämlich der Hauptvorteil jeder Tätergruppe. Die Täter sammeln Beweise, und wenn man dann gegen sie vorgeht, hat man zwar selber keine Beweise, sondern nur das Gefühl gemobbt zu werden. Damit hier jeder mal weiss wie das abläuft.