Nicht nur Petrus, auch Mithras meint es gut mit den teils prominenten Besuchern des Pressetermins auf dem Gelände des ehemaligen Trierer Polizeipräsidiums. Zuvor stundenlanger Regen – jetzt strahlen der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling und Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit der Sonne um die Wette, als sie von den glänzenden Funden berichten, die Archäologen vor Ort gemacht haben. Sie graben die Überreste eines Mithräums aus, einer Kultstätte für den römischen Lichtgott, Mithras. Aus Trierer Sicht eine Art Amtskollege von Petrus, dessen Brunnenfigur auf dem Hauptmarkt an Karneval und zum Altstadtfest mit Blumen geschmückt wird, auf dass sonniges Wetter die Festivitäten begleiten möge.
Den Fund des Mithräums nennt Triers Chefarchäologe Joachim Hupe „unerwartet“, dass sich im Schutt der Kultstätte gleich auch noch ein gut erhaltenes Relief des Cautes gefunden hat, gar eine „Sensation“.
Fackelträger des Lichtgottes
Cautes war gemeinsam mit Cautopates Begleiter des Lichtgottes. Beide Fackelträger, die die aufgehende und die untergehende Sonne symbolisieren. Der Mithras-Kult war vom zweiten bis zum vierten Jahrhundert im Römischen Imperium weit verbreitet und genoss besonders bei Soldaten und Kaufleuten große Popularität. Rund 135 seiner Kultstätten sind archäologisch nachgewiesen. Schwerpunkte: Britannien, obergermanischer Limes und der Balkan-Raum. Aus Trier war bislang ein Mithräum bekannt. Es liegt im Tempelbezirk im Altbachtal, keine hundert Meter vom aktuellen Fundort entfernt.

Mithras-Kultstätten sind leicht zu identifizieren. Unterirdisch angelegt, folgen sie einem einheitlichen Schema: langrechteckiges Gebäude mit Mittelgang, beidseitig eingefasst von Sitzbänken für Kultanhänger. Am Ende des Ganges befand sich eine Nische mit dem Kultrelief „Stiertötung des Mithras“, flankiert von den beiden Fackelträgern.
Von Mithras und Cautopathes fehlt noch jede Spur. Die Grabungsleiterinnen Stefanie Holzem und Natascha Mathyschok haben aber Hoffnung, noch fündig zu werden: „Die Grabungen stehen ganz am Anfang.“ Die fehlenden Herrschaften könnten durchaus noch auftauchen.
Jawohl: Herrschaften. Denn dem mystischen Mithraskult zu frönen, war reine Männersache. Frauen waren aus den exklusiven Gemeinschaften ausgeschlossen. Als antike „Machos“ standen die Anhänger des heidnischen Lichtgottes in Konkurrenz zum Christentum, das sich schließlich als römische Staatsreligion etablierte. Auch mit der Folge, dass christliche Eiferer die Kultstätten von Andersgläubigen zerstörten. So wohl auch in Trier, aber nicht mit der Gründlichkeit wie an anderen Orten, wo von Reliefs nur noch kleine Bruchstücke übrig blieben.

Das Mithräum auf dem Gelände des vor einige Monaten abgerissenen früheren Trierer Polizeipräsidiums dürfte in der Mitte des zweiten Jahrhunderts entstanden sein. Darauf lässt die Stilistik der aus Jurakalkstein – vermutlich aus einem Steinbruch bei Metz – gefertigten Cautes-Figur schließen. Sein Standort: äußerst prominent. Hupe: „Hier und in der näheren Umgebung ist seit dem früheren ersten Jahrhundert ein nobles Villenviertel entstanden, reich ausgestattet mit Wandmalereien und Bodenmosaiken.“ Und in Richtung Südosten schloss sich der gallisch-römische Kultbezirk im Altbachtal an – eine Tempelansammlung der Superlative und nördlich der Alpen einzigartig. Bei Ausgrabungen von 1924 bis 1932, die rund fünf Hektar und damit nur etwa ein Siebtel des Gesamtareals umfassten, kamen mehr als 70 Kultbauten sowie ein Theater ans Tageslicht.
Das Villenviertel grenzte unmittelbar an den Tempelbezirk. Das nun entdeckte Mithräum lässt vermuten, dass der Übergang fließend war und keine Ummauerung Villen und Tempel trennte.

Noch 16 Monate hat das Archäologenteam Zeit, bis weit in die Vergangenheit des römischen Trier zu graben. Der Reiz des aktuellen Grabungsareals: Es erstreckt sich auf den Betriebshof (2.500 Quadratmeter) des einstigen Präsidiums (Gesamtfläche: 9.600 Quadratmeter). Dort liegen die Römer-Relikte gleich unter der Erdoberfläche, während weiter nördlich neuzeitliche Bauprojekte (im Zweiten Weltkrieg zerstörte Werksgebäude und Villa des Fabrikanten und Weingroßhändlers Josef Schaab sowie von 1971 bis 2073 der Bau des Präsidiums) weitgehend archäologische Wüste hinterlassen haben.
Wenn voraussichtlich im Herbst 2024 die archäologischen Arbeiten abgeschlossen sind, ist das Feld frei für den Bau der neuen Hauptwache der Berufsfeuerwehr Trier.
Dieser Artikel erschien zuerst im Trierischen Volksfreund.

 De Maart
De Maart



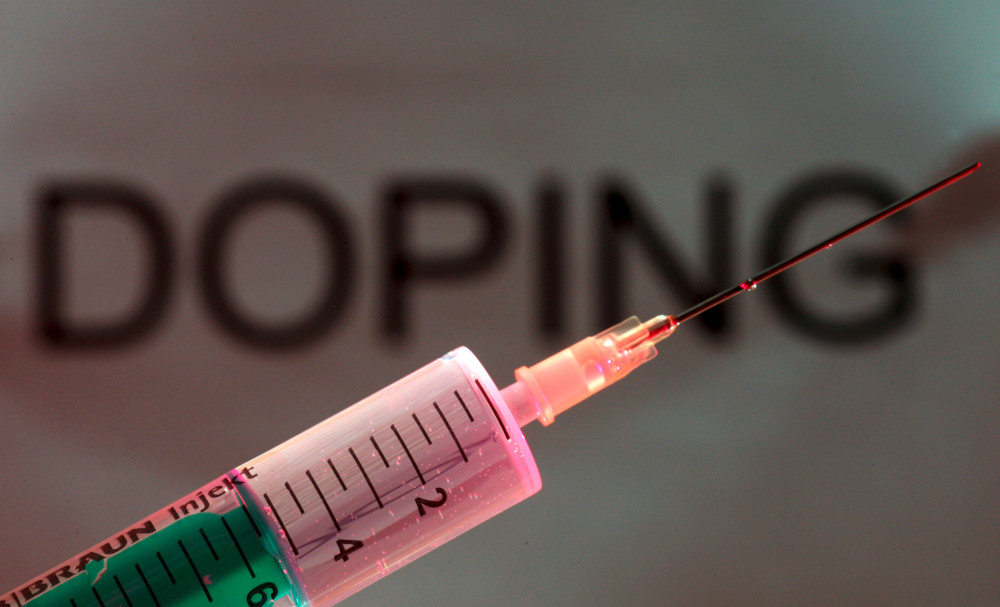



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können