Wie war das noch mal mit der Krim?
Die Krim ist eine Halbinsel im nördlichen Schwarzen Meer. Sie ist politisch de jure eine autonome Teilrepublik der Ukraine. In ihrer bewegten Geschichte erlebte die Krim unzählige Herrschaftswechsel, schreibt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpBBW).
Zarin Katharina die Große hatte die strategisch bedeutsame Halbinsel im Schwarzen Meer 1783 „von nun an und für alle Zeiten“ annektieren lassen. Im frühen 19. Jahrhundert wurde Sewastopol, die jetzt größte Stadt auf der Krim, zum Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte ausgebaut. 1921 wurde die Krim eine eigenständige sozialistische Sowjetrepublik, 1945 erklärte sie Stalin zum Teil der russischen Sowjetrepublik. 1954 macht der aus der Ukraine stammende Kremlchef Nikita Chruschtschow die mehrheitlich von Russen bewohnte Krim zu einem Teil der Ukrainischen Sowjetrepublik.
Seit dem Zerfall der UdSSR 1991 gehört die Krim zur unabhängigen Ukraine. Bei einem Referendum zur Unabhängigkeit der Ukraine stimmten 54 Prozent der Wähler auf der Krim mit „Ja“ – „ein Referendum über die Unabhängigkeit der Krim wurde dennoch angestrebt, jedoch mit erheblichem politischen Druck aus Kiew verhindert“, schreibt die LpBBW. Als Kompromiss sei der Krim 1992 der Status einer „Autonomen Republik“ innerhalb der Ukraine zugestanden worden.
Streitpunkt Sewastopol
Ein Streitpunkt zwischen Russland und der Ukraine war laut LpBBW seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion insbesondere Sewastopol, der Heimathafen der Schwarzmeerflotte. 1993 erklärte die Duma Sewastopol 1993 demnach zur „russischen Stadt auf fremdem Territorium“. Erst ein Vertrag von 1997 regelte die Aufteilung der Flotte und den Verbleib der russischen Marine auf der Krim. „2010 wurde diese Vereinbarung bis 2042 verlängert, als Gegenleistung erhält die Ukraine einen Preisrabatt auf russische Gaslieferungen“, schreibt die LpBBW.
Mehrere Eskalationsstufen führten Ende 2013, Anfang 2014 zum Krieg in der Ostukraine. Ende November 2013 kam es in Kiew zu Protesten, nachdem der ukrainische Präsident Wiktor Janukowitsch unter russischem Druck die Unterschrift unter das Assoziierungsabkommen mit der EU verweigert hatte. Die Proteste schaukelten sich hoch und eskalierten vollends im Februar, als Sicherheitskräfte auf die Demonstranten schossen und rund 100 Menschen töteten.
Daraufhin lehnten die Demonstranten einen vom Westen vermittelten Kompromiss zur Rückkehr zur parlamentarischen Verfassung von 2004 ab – sie forderten Janukowitschs sofortigen Rücktritt, der am 22. Februar das Land fluchtartig verlassen musste. Das Parlament in Kiew wählte eine neue Regierung und einen Übergangspräsidenten. Fünf Tage später umstellten bewaffnete Männer das Regionalparlament auf der Krim.
In einer irregulären Abstimmung beschlossen die Abgeordneten ein Unabhängigkeitsreferendum. Mit der Hilfe russischer Soldaten ohne Hoheitsabzeichen annektierte der Kreml schließlich die Halbinsel. Mitte April stürmten prorussische Demonstranten im Süden und Osten der Ukraine die regionalen Verwaltungen. Es war der Beginn des Krieges in der Ostukraine, den auch das zweite Minsker Abkommen aus dem Jahr 2015 nicht beenden konnte.

2018 weihte Wladimir Putin eine Brücke vom russischen Festland auf die Krim ein. Die Fertigstellung des Baus stehe in einer Reihe mit den größten russischen Erfolgsgeschichten, sagte Putin, der selbst am Steuer eines Lkws den Eröffnungskonvoi über die Brücke anführte. Die neue Verbindung ist mit 19 Kilometern die längste Brücke Russlands und Europas. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit können seit Ende 2019 auch Züge über die Brücke fahren.
Der Westen sieht in Russlands Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim einen Völkerrechtsbruch.
Was ist das Normandie-Format?
Die Bezeichnung „Normandie-Format“ steht für ein Treffen auf Regierungsebene zwischen Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine. Sie geht auf eine erste Zusammenkunft in dieser Konstellation am 6. Juni 2014 am Rande der Gedenkfeiern zur Landung der Alliierten in der Normandie zurück, schreibt das deutsche Auswärtige Amt. Merkel und Hollande hatten die Gedenkfeier für eine Vermittlungsoffensive genutzt.
Es war die erste Begegnung der Staatschefs Russlands und der Ukraine seit Beginn des Konflikts – wenige Monate zuvor hatte Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. „So traf es sich gut, dass bei den Gedenkfeiern neben dem Gastgeber, Staatspräsident François Hollande, und Bundeskanzlerin Angela Merkel auch die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, anwesend waren“, schreibt die Deutsche Welle. „Dass es gelang, in der aufgeladenen Situation die Präsidenten Russlands und der Ukraine an einen Tisch zu bekommen, galt bereits als Erfolg, auch wenn es keine konkreten Ergebnisse Richtung Konfliktlösung gab, aber das hatte auch niemand erwartet.“
Nach dem Minsker Abkommen gab es noch zwei weitere Treffen in dem Viererformat – 2016 in Berlin und 2019 in Paris. Am 26. Januar traf sich das Normandie-Quartett dann zum ersten Mal seit Jahren wieder, erneut in Paris.

Was ist das „Minsk-II-Abkommen“?
Auf den Sturz einer gewählten prorussischen Regierung in Kiew 2014 reagierte Russland mit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Zudem unterstützte es prorussische Separatisten im Osten des Landes, gegen die Kiew seit 2014 militärisch vorgeht. Fünf Monate nach Beginn der Kämpfe, bei denen 2.600 Menschen gestorben waren, wurde in Minsk (Belarus) ein erster Waffenstillstand mit einem Friedensplan für die Region um die Städte Luhansk und Donezk unterzeichnet – das Minsker Protokoll. Es entstand unter der Mitwirkung von Deutschland, Frankreich, Russland, der Ukraine und der OSZE und sollte den Konflikt beenden. Das Minsker Protokoll schrieb Gefangenenaustausche, die Lieferung von humanitären Hilfsgütern und den Rückzug schwerer Waffen vor. Unterzeichnet wurde es am 5. September 2015 – bereits am 28. September flammten die Kämpfe am Flughafen von Donezk wieder auf, die zu Beginn des Jahres 2015 immer schwerer wurden.
Am 12. Februar 2015 sollten die Regeln des Minsker Protokolls deshalb in einem Abkommen festgehalten werden – dem „Minsker Abkommen“ oder „Minsk II“. Neben den Verhandlern François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroschenko und Wladimir Putin waren auch die Führer der beiden ostukrainischen Separatistengebiete anwesend. Das Minsker Protokoll wurde von zwölf auf 13 Punkte erweitert und konkretisiert.
Verstöße auf beiden Seiten
Im Zuge des Friedensplans wurden mehrfach Hunderte Gefangene ausgetauscht. Doch täglich stellen Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auch Verstöße auf beiden Seiten fest. Nur in Teilen umgesetzt ist etwa der vereinbarte Abzug schwerer Waffen von der Frontlinie. Darüber hinaus setzen beide Seiten trotz Flugverbots Aufklärungsdrohnen ein.
Entgegen den Vereinbarungen ist zudem die komplette Wiederherstellung der sozioökonomischen Beziehungen einschließlich der Zahlung von Renten nicht erfolgt. Seit 2017 unterliegen die abtrünnigen Gebiete einer kompletten Wirtschaftsblockade durch Kiew, von der nur humanitäre Hilfsgüter ausgenommen sind.
Auch die für die abtrünnige ostukrainische Region vorgesehene Autonomie wurde bislang nicht verwirklicht und nicht in die ukrainische Verfassung aufgenommen. Die Autonomie sähe für die abtrünnigen Gebiete im Donbass etwa eine eigene Polizei und Gerichtsbarkeit sowie sprachliche Selbstbestimmung und eine Amnestie für die Separatistenkämpfer vor.
Streitpunkt Grenzabschnitt
Kiew besteht darauf, dass es die Kontrolle über den an die Separatisten verloren gegangenen, etwa 400 Kilometer langen Grenzabschnitt zu Russland erhält – und zwar bevor im Donbass Wahlen abgehalten werden. Der Friedensplan sieht aber eigentlich erst Wahlen und danach eine schrittweise Rückgabe der Kontrolle über den Grenzabschnitt vor. Eine Kiewer Bedingung für Wahlen ist auch der vorherige komplette Abzug aller ausländischen Kämpfer, die die Separatisten unterstützen, sowie die Entwaffnung der Aufständischen.
Im Dezember 2019 wurden in Paris über den Friedensplan von 2015 hinausgehende Vereinbarungen ausgehandelt. Beschlossen wurde etwa, mit der schrittweisen militärischen Entflechtung entlang der Front fortzufahren. Das aber passiert nur langsam bis gar nicht. Beide Seiten lasten sich gegenseitig das bisherige Scheitern der Eröffnung von zwei neuen Übergangspunkten zwischen Regierungsgebiet und Separatistenregion an.
Russland betont noch heute, bei den Verhandlungen Vermittler und keine Vertragspartei zu sein. Die russische Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatistengebiete wird von westlichen Staaten als Ende des Minsker Prozesses gewertet. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete Minsk als nicht aktuell, wollte aber nicht das komplette Ende verkünden. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zögerte zunächst noch, den Friedensplan für komplett gescheitert zu erklären.

Wie funktioniert die NATO?
Die NATO – kurz für „North Atlantic Treaty Organization“, also „Nordatlantikpakt-Organisation“ – ist ein Zusammenschluss von 30 Staaten. Das Militärbündnis wurde am 4. April 1949 von zwölf Ländern gegründet – zu Beginn des Kalten Kriegs – und stellte lange Zeit das Gegenstück des kapitalistischen Westens zum Warschauer Pakt des Ostblocks dar.
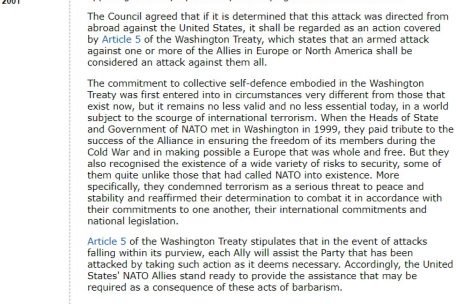
Die NATO versteht sich als „politischer und militärische Allianz“, die ihren Mitgliedern „Freiheit und Sicherheit“ durch politische und militärische Mittel garantiert. „Die NATO fördert demokratische Werte und ermöglicht es ihren Mitgliedern, sich in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen zu beraten und zusammenzuarbeiten, um Probleme zu lösen, Vertrauen aufzubauen und langfristig Konflikte zu vermeiden“, heißt es auf der Website der Organisation zur politischen Dimension des Bündnisses. Sie sei der „friedlichen Beilegung von Streitigkeiten verpflichtet“. Wenn die diplomatischen Bemühungen scheiterten, verfüge sie jedoch über „die militärischen Mittel, um Operationen zur Krisenbewältigung“ durchzuführen.
Diese „Operationen“ werden im Rahmen eines UNO-Mandats oder der kollektiven Verteidigungsklausel des NATO-Vertrags durchgeführt. Im Artikel 5 heißt es dort: „Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird.“ Im Falle eines Angriffs muss jeder dem Angegriffenen Beistand leisten – das umfasst die „Anwendung von Waffengewalt“ – um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. Der NATO-„Bündnisfall“ wurde bis jetzt erst ein Mal ausgerufen – nach den Anschlägen vom 11. September 2001.
Vertreter der Mitgliedstaaten der NATO treten laut der Webseite der Organisation täglich im Hauptquartier in Brüssel zusammen und treffen Entscheidungen über Sicherheitsthemen. Eine solche Entscheidung muss immer einstimmig von allen 30 Mitgliedstaaten angenommen werden.

Die 30 NATO-Mitgliedstaaten mit Beitrittsjahr
1949: Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten
1952: Griechenland, Türkei
1955: Deutschland
1982: Spanien
1999: Tschechien, Ungarn, Polen
2004: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien
2009: Albanien, Kroatien
2017: Montenegro
2020: Nordmazedonien

 De Maart
De Maart









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können