Im großen Zusammenspiel der Dinge mag diese Meldung vom vergangenen Sonntag eher klein und unbedeutend daherkommen, an ihr lässt sich jedoch sehr gut ablesen, wie viel kulturelles Kapital Israel im andauernden Israel-Palästina-Konflikt in den vergangenen Monaten verspielt hat: Radiohead, seit knapp drei Jahrzehnten eine der berühmtesten und einflussreichsten britischen Bands, hat ihre Haltung zu Konzerten in Israel geändert. Auf die Frage, ob Radiohead dort auftreten würden, antwortete Frontmann Thom Yorke in einem Interview mit der Sunday Times: „Auf keinen Fall. Ich möchte mich nicht einmal 5.000 Meilen in der Nähe des Netanjahu-Regimes aufhalten.“ Warum das bemerkens- und berichtenswert ist? Weil Radiohead bislang zu den bekanntesten Bands zählten, die sich gegen einen kulturellen Boykott Israels aussprachen.
Auf ihrer bislang letzten Tour vor sieben Jahren (die aktuelle startet nun im Herbst) gaben Radiohead ein Konzert in Tel Aviv. Dafür erntete die Band scharfe Kritik von vielen prominenten Stimmen aus der britischen Kulturszene, die im Sinne der BDS-Bewegung („Boycott, Divestment and Sanctions“) zu einem kulturellen und akademischen Boykott des Staates aufriefen. Damals verteidigte Yorke die Entscheidung noch mit folgenden Worten: „In einem Land aufzutreten ist nicht dasselbe wie die Regierung zu unterstützen. Wir treten seit über 20 Jahren in Israel auf, unter verschiedenen Regierungen, von denen einige liberaler waren als andere. Genauso wie in Amerika. Wir unterstützen Netanjahu genauso wenig wie Trump, aber wir treten trotzdem in Amerika auf.“
Was hat sich seitdem geändert? Die Haltung zum Staatsoberhaupt offensichtlich nicht, Netanjahu-Kritiker waren Yorke und Kollegen immer und sind es geblieben. Was sich geändert hat, sind die Zeiten. Israel ist (nicht unverschuldet) schon seit kurz nach dem 7. Oktober und den ersten Angriffen auf Gaza dabei, den weltweiten PR-Kampf zu verlieren. Der Druck, sich gegen Israel und für Palästina zu positionieren, ist vor allem in der internationalen Kunst- und Kulturszene immens gestiegen. Hinzu kommt der allgemeine Druck zur Positionierung in Zeiten, die einerseits oft die Grenze zum Moralismus überschreiten, andererseits durch ihre Social-Media-Algorithmen die größtmögliche Polarisierung belohnen.
Dabei müsste man sich nüchterner viel eher die Frage nach der Wirkmacht eines kulturellen Boykotts im Jahr 2025 stellen. Als Paradebeispiel für den Erfolg eines solchen wird immer wieder das Ende des Apartheid-Regimes in Südafrika herangezogen, das seit Mitte der Achtziger von massiven Protesten und Boykotten der größten Popstars dieser Zeit begleitet wurde (inklusive eigener Supergroup „Artists United Against Apartheid“ mit u.a. Bruce Springsteen, Bob Dylan, Peter Gabriel, Miles Davis und Bono). Aber auch das waren andere Zeiten. Popstars solchen Kalibers (Größe und Strahlkraft über Jahre) gibt es heute kaum mehr und wenn doch, dann positionieren sie sich – siehe Taylor Swift – aus kapitalistischem Kalkül selten so eindeutig.
Der Fall Radiohead steht nun im Kontext vor allem britischer Künstler wie den nordirischen Rappern Kneecap und den englischen Punks Bob Vylan, die im vergangenen Jahr mehr durch ihre die Grenze zur Hassrede tangierenden pro-palästinensischen Protestaktionen bekannt wurden als durch ihre Musik. Es stellt sich die Frage: Können Musiker und Künstler in der Gegenwart noch einmal eine ähnliche gesamtgesellschaftliche Wirkmacht entwickeln wie zu Südafrikas Apartheid-Zeiten – oder verlieren wir uns in Radikalisierungsspiralen einzelner Gruppen? Abwarten, was Oasis und Adele dazu zu sagen haben.

 De Maart
De Maart







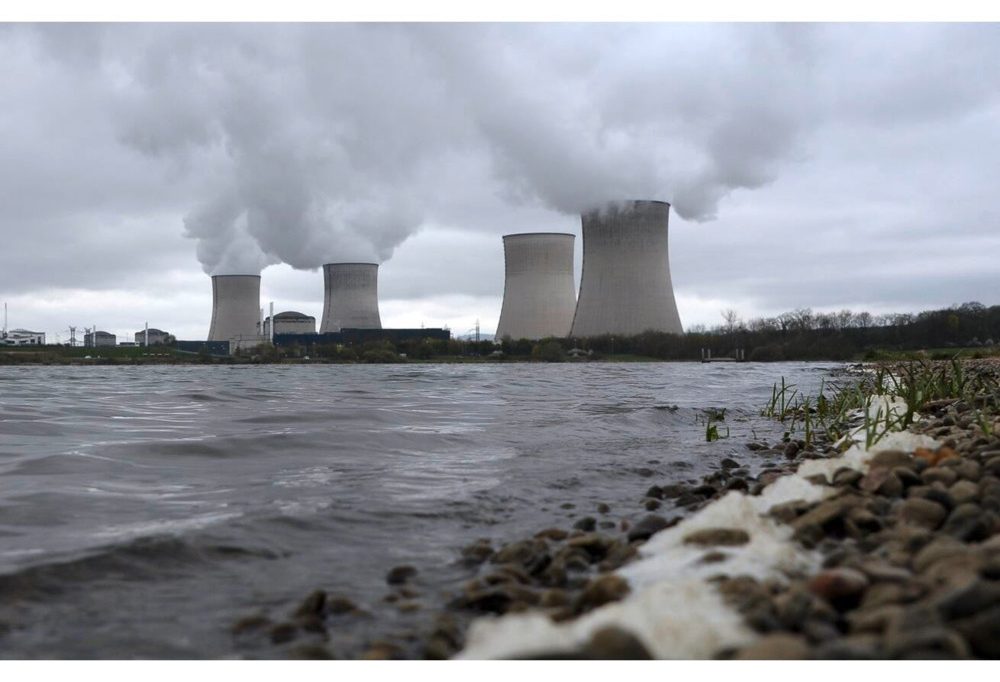

Die Hamas sind auch Palestinenser oder? Der Demonstrant mit dem Schild könnte auch ein grünes Stirnband und eine Maske tragen. Also bitte gleiches Recht für alle. Israel führt Krieg und der ist immer scheußlich.Aber es hat noch keine Busse mit Kindern in die Luft gesprengt. Die Araber können noch nicht einmal friedlich unter sich leben. Schiiten,Sunniten usw. Armselig sowas.
"den weltweiten PR-Kampf zu verlieren", laut westlichen Medien ist das schlimmste was in Gaza passiert ist dass Israel den PR-Kampf verloren hat. Nicht die Kriegsverbrechen, nicht die Vertreibungen, nicht gewollte Hungersnot, nicht das zerstören der zivilen Infrastrukturen. Im Umkehrschluss heißt das auch dass das beste was den Palestinensern wiederfahren ist, ist die Tatsache dass Israel den PR-Kampf verloren hat. Ein sehr gutes Beispiel westlicher Medien, westlicher Werte und was es für den Westen bedeutet ein Palestinenser zu sein. Nämlich gar nichts.