Prato in der Toskana, Juni 2022: Audrey Millet ist gerade mit der Recherche über die örtliche Textilindustrie beschäftigt, als sie auf der Straße von Abdoul angesprochen wird. Er stellt sich ihr als Schneider vor und sagt, er komme aus der Elfenbeinküste – und erzählt ihr seine Geschichte. Die Autorin war unter anderem mit ihrem „Schwarzbuch der Mode“ (2021) bekannt geworden. Die Geschichte von „L’Odyssée d’Abdoul“, wie Millet später ihr neues Buch nennen wird, beginnt 2015, als Abdoul sich eine Nähmaschine kaufen will, um sich als Schneider selbstständig zu machen.
Abdoul hatte nie vor, nach Europa auszuwandern. „Ich wollte in meiner Heimat bleiben und als Schneider arbeiten“, erzählt der 40-Jährige, der gemeinsam mit Audrey Millet auf Einladung luxemburgischer NGOs – u.a. ASTI und Fairtrade Lëtzebuerg – ins Großherzogtum gekommen ist, um von seinen Erlebnissen zu berichten und das Buch vorzustellen. Aufgewachsen ist er in Abidjan, der Hauptstadt des westafrikanischen Landes. In die Schule konnte er nicht gehen. „Meine Eltern hatten nicht das Geld dafür. Schließlich habe ich noch zwei Brüder und vier Schwestern.“
Für die Ausbildung und das Material brauchte er Geld, und in Abidjan gab es nicht genug Arbeit. Abdoul begegnete einem Mann namens Ousmane, der ihm vorschlug, in Burkina Faso zu arbeiten. „Ich versuchte also mein Glück“, erzählt Abdoul in unserem Interview. Für 60 Euro kaufte er sich ein Ticket von Abidjan nach Ouagadougou. Rimbo Transport Voyageurs heißt das Busunternehmen, auch „Roi de la route“ genannt. Die Firma hat ein Monopol – und ist Teil eines internationalen Netzwerks von Menschenhändlern.
Ich habe schreckliche Dinge gesehen: wie Menschen misshandelt und getötet werden, wie Kinder sich prostituieren und Frauen vergewaltigt werden
Im Vorhof zur Hölle
Am Ziel angekommen, das nur eine erste Durchgangsstation einer noch viel längeren Reise sein sollte, begann die Ausbeutung. „Der Patron war nicht ehrlich und vertrauenswürdig mit der Bezahlung. In der Schneiderei stellten wir traditionelle Kleidung her. Wir schliefen und aßen in der Firma. Die Arbeitsbedingungen waren schlecht.“ Unwissentlich hatte Abdoul den Weg in die Sklaverei beschritten. Er nahm den Bus nach Niamey, die Kapitale von Niger. Doch auch dort gab es keine Arbeit für Abdoul. „Geh nach Agadez“, riet man ihm. Dort gebe es Arbeit für jeden.
Also zog er weiter in die Stadt, die als „Tor zur Sahara“ bezeichnet wird, manche nennen sie den Vorhof zur Hölle. „Die schlimmste Erfahrung in meinem Leben“, sagt Abdoul. „Ich habe schreckliche Dinge gesehen: wie Menschen misshandelt und getötet werden, wie Kinder sich prostituieren und Frauen vergewaltigt werden.“

Abdoul war in die Fänge der nigerianischen Mafia geraten, die „Black Axe“-Bruderschaft, auch als „Neo Black Movement of Africa“ bekannt, die Drogen-, Menschen-, Waffenhandel, Dating-Betrug und Prostitution betreibt und Schleusungen organisiert. „Sie sind in ganz Afrika aktiv, aber auch in Italien“, weiß Audrey Millet, „und sind wie eine Sekte.“ Einst wurde die „Black Axe“ als studentische Bewegung in Benin gegründet, die ideologisch dem Panafrikanismus nahestand. Ihr gehörte auch der spätere Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka an. Sie fungiert heute nicht zuletzt als Schlepper für Migranten in Richtung Europa.
Du gehorchst ihnen, denn du hast keine Wahl. Man raubte mir meine Identität, meine Würde. Ich schwebte zwischen Leben und Tod.
Die Wüste sei wie ein Friedhof für die Afrikaner, sagt Abdoul. Er reiste, eingepfercht in einem Pick-up und geschlagen von den Schleppern, durch die Sahara. „Du gehorchst ihnen, denn du hast keine Wahl. Man raubte mir meine Identität, meine Würde. Ich schwebte zwischen Leben und Tod.“ Er erreichte Gatrone, eine Stadt im Süden Libyens. „Dort werden die Migranten aussortiert“, sagt Millet. „Sie werden wie Vieh behandelt. Es ist wie ein Markt.“ Frauen werden für 300 Euro verkauft.
Abdoul hatte Glück, weil er einen Beruf hatte. Er sagte, er sei Schneider. Die Migranten wurden als „Ibeid“ bezeichnet, als Sklaven. Abdoul kam in eine Fabrik, in der Gebetsteppiche hergestellt wurden. Er traf dort auf Hassan, ein Ivorer wie er. Ihm war Abdoul wie ein Sklave ausgeliefert und musste sieben Tage die Woche jeden Tag 14 Stunden für ihn schuften. Eine Möglichkeit zur Flucht bestand nicht, um ihn herum war nur Wüste. Sabha war wie ein „Konzentrationslager“, wie Abdoul sagt, von der Größe einer Stadt.
Schiffbrüchig im Mare Nostrum
Später brachte man ihn nach Gargaresh, einer Oase in der Nähe von Tripolis und nicht weit vom Mittelmeer. „Dabei wollte ich doch nie nach Europa“, betont Abdoul einmal mehr. Obwohl er krank war, wurde er zusammen mit 20 bis 25 anderen Personen in ein kleines Schlauchboot gesetzt. Er war verletzt, sein Fuß tat ihm weh. Vor allem aber hatte er Angst. Sie waren mitten auf dem Meer. Die Passagiere urinierten ins Boot, einige mussten sich übergeben. Ein Mann starb. Die anderen wollten ihn über Bord werfen, doch Abdoul hinderte sie daran.
Die Reise dauerte anderthalb Tage, an denen die Gruppe im Mare Nostrum, wie die Römer das Mittelmeer einst bezeichneten, trieb. Alle glaubten, sie würden sterben, bis am Morgen des nächsten Tages ein anderes Boot auftauchte. An Bord befanden sich fünf Personen, davon eine Frau. Es waren vier Italiener und ein Nigerianer. Auch sie nutzten die Gelegenheit, das armselige Häufchen von Schiffbrüchigen auszubeuten. Sie brachten sie an Land und steckten sie in einen Flixbus, der die Migranten direkt nach Prato brachte.

Die Stadt in der Toskana, die nur 20 Kilometer von Florenz entfernt liegt, ist seit Jahrzehnten für ihre Textilindustrie bekannt, besonders im Bereich der sogenannten Fast Fashion. Die alte Hochburg der italienischen Mode hat ihre beste Zeit längst hinter sich. Im Zuge der Finanzkrise beschleunigte sich ihr Niedergang. Hinzu kam ein Skandal um Schwarzgeld von etwa einer Milliarde Euro, das jährlich aus der Toskana nach China floss.
Im vergangenen April führten die Ermittler der italienischen Finanzpolizei eine Razzia in einer der Fabriken durch, in der Gürtel und Taschen von Giorgio Armani hergestellt wurden. Ein anderes Mal fand man Kleider von Christian Dior. Die als „Sweatshops“ bekannten Betriebe waren in den 80er und 90er Jahren entstanden, als die ersten Chinesen nach Prato kamen und die maroden Textilfabriken aufkauften und die Produktion in ihre Hand nahmen. Seither ist Prato in chinesischer Hand. Wie Le Monde diplomatique berichtet, sind heute rund 30.000 der knapp 200.000 Einwanderer Pratos Chinesen. Tausende chinesische Firmen sind in Prato gemeldet, die mit Abstand meisten von ihnen in der Textilbranche.
Luxusmode made in Chinatown
Die meisten Chinesen in Prato stammen aus der Hafenstadt Wenzhou. Sie waren nach Italien geschleust worden und hatten ihre Überfahrt mit dem ersten Lohn bezahlt, den sie in Prato verdienten. Auf ihren Modeartikeln steht „Made in Italy“. „Ich wurde von einem der Besitzer angesprochen und gefragt, ob ich eine Arbeit suchte“, erzählt Abdoul. Als ich sagte, dass ich Schneider sei, antwortete er, dass sich das gut treffe. Ich könne gleich mitkommen. Von außen sah die Firma nicht wie eine Fabrik aus. Als ich drin war, waren da nur Chinesen. Alle sprachen nur Chinesisch. Ich machte alles, nähte Kleider und machte Etiketten dran.“
So entstand in Prato eine Art von Chinatown mit Fabriken, aber auch mit Restaurants, Spielhallen und Teesalons. Im 19. Jahrhundert hatte man bereits verstanden, die Preise in der Textilindustrie zu senken, indem man andere, günstigere Materialien nahm. „Dann versuchte man, die Löhne der Arbeitskräfte zu drücken“, sagt Audrey Millet. Abdoul arbeitete zwei Jahre in einer der Fabriken. Er konnte seine Aufenthaltsgenehmigung immer wieder verlängern, bis er ein längerfristiges Bleiberecht bekam.

Die Odyssee von Abdoul, die in Abidjan begann, in Prato endete und den heute 40-jährigen Ivorer wieder nach Hause führte, war durch ein Zusammenspiel eines ganzen Netzwerks von Schlepperbanden möglich, die aus dem Menschenhandel ein lukratives Geschäft gemacht haben, von der nigerianischen bis zur sizilianischen Mafia, der Cosa Nostra, aber auch den chinesischen Triaden. „In Palermo hat man Wohnungen gefunden, die als Folterstätten genutzt wurden“, weiß Audrey. „Frauen und Mädchen werden zur Prostitution gezwungen.“ Sie erinnert an die Arbeit der Rechtsmedizinerin Cristina Cattaneo, die etwa 800 Menschen identifizierte, die im Mittelmeer ums Leben gekommen waren, unter anderem von jenem Schiffsuntergang vor Lampedusa, bei dem 366 Menschen starben.
Spur nach Luxemburg
Einige große Modeketten machen sich neben der Ausbeutung der Arbeitskräfte auch der Steuerhinterziehung schuldig – und nutzen dafür den luxemburgischen Finanzplatz. Audrey Millet greift in „L’Odyssée d’Abdoul“ unter anderem das Dossier um Dolce & Gabbana auf: 2004 und 2005 gründete das Luxusunternehmen eine Reihe von Gesellschaften, darunter Gado Srl in Luxemburg. Die Modeschöpfer wurden 2014 dafür wegen Steuerhinterziehung zu 18 Monaten Haft und einer Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt. Der Oberste Gerichtshof Italiens revidierte das Urteil 2015 und sah von der Gefängnisstrafe ab. Ein weiteres Beispiel für vergleichbares Vorgehen ist die Gruppe Kering mit Filiale in Luxemburg, die mehrere Luxusmarken (u.a. Gucci) vertritt.
Sie spricht auch über den Rassismus der Menschenhändler, die zum Beispiel die Bangladescher und Pakistaner mehr respektieren als die Afrikaner. „Aber sie respektieren nicht einmal ihre eigenen Leute aus Wenzhou“, sagt sie. „Es gibt sogar eine Hierarchie bei den Löhnen. Pakistaner kriegen etwa 50 Euro am Tag, Afrikaner nur 30. Gearbeitet wird den ganzen Tag von sieben bis 20 Uhr.“ Sieben Tage an der Woche, sei hinzugefügt. „Aber dann musst du morgens pünktlich um sieben Uhr beginnen und abends nicht vor acht aufhören“, sagt Abdoul, „und wenn du zwei oder drei Minuten aussetzt, wird dir das abgezogen.“
Als am 1. Dezember 2013 „Teresa Moda“, eine der Textilfabriken in dem Industriegebiet Macrolotto im Süden von Prato abbrannte, starben sieben Menschen. Zwölf Kilometer außerhalb von Prato wird Mode von Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Valentino und anderen Marken weiter hergestellt. Auch hier arbeiten Chinesen und andere Migranten. Alles ist natürlich „Made in Italy“.
Zum Buch
Abdouls Geschichte mag der Ausgangspunkt von „L’Odyssée d’Abdoul“ sein, doch Audrey Millet geht in ihrem Sachbuch weiter: Sie beleuchtet das komplexe System, das Schicksale wie jenes von Abdoul ermöglicht.
Schlepper auf Facebook
Neben den bereits erwähnten Themen – Menschenhandel, Versklavung, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Mafia im Modesektor – schreibt Millet beispielsweise über die Aktivitäten von Schleppern auf Facebook, Teil des Meta-Konzerns von Marc Zuckerberg. Auf der Plattform werden in Gruppen von teilweise 12.000 Mitgliedern Transfers nach Europa angeboten. Auf den Werbebildern seien Yachten zu sehen, dabei enden die Schutzsuchenden auf unsicheren Schlauchbooten. „Que fait Meta contre ces passeurs? Rien“, so Millet, die jederzeit auf der Seite der Migrierenden steht und 2024 den Preis „Mare Nostrum“ erhielt.
Unter einer Decke
In dem Sinne führt sie auch die europäische Politik vor. Sie erinnert an den Pakt zwischen Silvio Berlusconi (Forza Italia) und Muammar al Gaddafi im Jahr 2008: Der Pakt verpflichtet Italien, Libyen über 20 Jahre hinweg 3,9 Milliarden Euro auszuzahlen, „tout en gardant l’oeil sur le pétrole libyen“. Berlusconi und Gaddafi sind inzwischen verstorben, das Abkommen besteht fort – und finanziert die Errichtung von Haftlagern in Libyen, das die Genfer Konvention (internationale Verträge zum Schutz der Zivilbevölkerung und von Kriegsgefangenen) unterzeichnet hat. Im Mai 2024 gab es nach Millet insgesamt 42 solcher Internierungslager, in denen Menschen meist grundlos und ohne juristischen Beistand festgehalten werden. Libyen habe kein Interesse daran, die günstigen Arbeitskräfte nach Europa auszuweisen. Das geschehe nur selten, um die Panik vor Migration in Europa aufrechtzuerhalten – zum Wohlwollen rechter Parteien, welche das dadurch ausgelöste Unbehagen instrumentalisieren. Ein weiteres Beispiel hierfür liefert Millet prompt, wenn sie über den Organhandel in Italien schreibt: ein europäischer Knotenpunkt für das Geschäft mit den Körperteilen.
Organhandel im Sinne der Rechten
Die Leidtragenden sind erneut die Migrierenden. Millet verweist auf mehrere Ermittlungen zum Thema, nach denen u.a. ägyptische Gangs mit Beziehungen nach Italien Schutzsuchende töten, um ihre Organe für bis zu 12.600 Euro zu verkaufen. Die nigerianische Mafia sei ebenfalls aktiv auf dem Markt. Unter ihren Opfern befänden sich unbegleitete Minderjährige, die nach ihrer Ankunft in Lampedusa spurlos verschwinden: „En 2009, le ministre de l’Intérieur italien, Roberto Maroni, établissait un lien entre la disparition de 400 mineurs arrivés sur l’île de Lampedusa l’année précédente et le trafic d’organes.“ Die Heranwachsenden, die dem Organhandel zum Opfer fallen, sollen gar ein Drittel der Minderjährigen mit Fluchthintergrund ausmachen, die Italiens Küsten erreichen, heißt es an anderer Stelle. Ab 2018 deckte das FBI in Zusammenarbeit mit italienischen Autoritäten zudem auf: In Italien existieren Kliniken, in denen den Zugewanderten – unabhängig ihres Alters oder ihrer Zustimmung – Organe entnommen werden, um sie an amerikanische Krankenhäuser weiterzuverkaufen. Dabei handelt es sich u.a. um eine Kooperation mit der nigerianischen Mafia. Ein Umstand, der Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Frattelli d’Italia) damals veranlasste, ihre politische Forderung nach Militärpräsenz in den betroffenen Regionen Italiens zu erhöhen und die Verantwortung für die Verbrechen allein der Mafia aus Nigeria zuzuschreiben. „Meloni omet de mentionner l’implication des mafias italiennes et les manquements de l’Etat dans le Sud de l’Italie depuis presque deux cents ans“, kontextualisiert Millet dies. Der Diskurs sei ideal, um Menschen auf der Flucht zu stigmatisieren und die rechtsextreme Wählerschaft zu umgarnen, ohne jedoch konkrete Lösungen vorzuweisen.
Realer Thriller
So liest sich Millets Buch wie ein Polit-Thriller, der teilweise zu grausam scheint, um wahr zu sein. Am Ende geht es nicht nur um Politik, sondern darüber hinaus um unser Gesellschaftssystem. Seite für Seite entlarvt sie die Schattenseiten des Kapitalismus: In einer Welt, in der Gewinn und Macht das höchste Gut sind, verkommen Menschen zur Ware. Millet geht hart mit der Politik aus aller Welt ins Gericht, hält aber vor allem der Konsumgesellschaft und kritischen Stimmen gegen Migrierende den Spiegel vors Gesicht: Wer sind wir, die für Markennamen die Qualen schutzbedürftiger Menschen in Kauf nehmen? Woran glauben wir, wenn die Ausweisung von Asylbewerbenden uns die einzige Lösung scheint? Und was sagt es über rechte bis rechtsextreme Parteien aus, wenn sie u.a. das Ausnehmen und den Tod unschuldiger Kinder für Panikmache gegen die Opfer ausnutzen? Caroline Abu Sa’Da, Direktorin von SOS Méditerranée Suisse, bringt es in einem Zitat auf dem Buchdeckel auf den Punkt: „L’Odyssée d’Abdoul se lit les larmes aux yeux et la rage au ventre.“
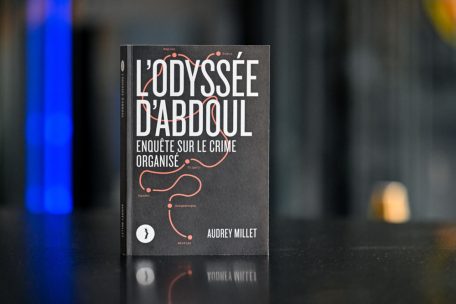
Bekleidungsexporte
Die zehn wichtigsten Exportländer für Bekleidung weltweit nach Exportwert im Jahr 2023 in Milliarden US-Dollar. China war mit einem Exportvolumen von mehr als 164,7 Milliarden US-Dollar der mit Abstand wichtigste Exporteur und lag auch an der Spitze der Exportländer für Textilien vor Indien, Deutschland, der Türkei und den USA sowie Italien. Die Arbeitsbedingungen in den Bekleidungsfabriken vor allem in China und Bangladesch sind oft prekär und von niedrigen Löhnen, langen Arbeitszeiten sowie niedrigen Sicherheitsstandards geprägt. (Quelle: Statista)
1. China: 164,74
2. Bangladesch: 47,49
3. Vietnam: 31,04
4. Italien: 30,27
5. Deutschland: 29,7
6. Türkei: 18,73
7. Niederlande: 17,57
8. Frankreich: 16,85
9. Indien: 15,37
10. Spanien: 15,34

 De Maart
De Maart







Im Namen der Mode... wie mancher, wenn nicht gar der meiste Reichtum entsteht, ist an Skrupellosigkeit nicht zu überbieten! Bei Reportagen der großen Marken werden helle Schneidersäle, gut gekleidete, französische Schneiderinnen und ein um die Models tänzelnder Modeschöpfer, an den Roben hier und da zupfend, gezeigt und der Verbraucher glaubt das, was ihm vorgegaukelt wird. Dass so ganz nebenbei Organhandel betrieben wird, wissen sicherlich die wenigsten. Wie grausam!
Interessant dass an sich hochwertige und meist recht teure kleider made in Italy von schlecht bezahlten arbeitern hergestellt werden.
Da sind die profitmargen erheblich hoeher als beim sogenannten ramsch made in Bangladesh.