Die Musiker von Pearl Jam, 1990 in Seattle gegründet, waren die Erben der Bands Green River und Mother Love Bone. Der ehemalige Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, Jack Irons, vermittelte den befreundeten Musikern damals einen Surfer, Hobbymusiker und Sänger namens Eddie Vedder aus San Diego, auf dessen Texte er aufmerksam geworden war. Wenig später war Vedder in Seattle, gab die Anregung, die Band, die bis dahin den Namen des Basketball-Spielers Mookie Blaylock getragen hatte, in Pearl Jam – nach der familieninternen Bezeichnung für die Peyote-Marmelade von Vedders Großmutter – umzubenennen.
Nachdem erste Auftritte gebucht waren, wurde die Plattenfirma Epic auf die Band um den charismatischen Sänger aufmerksam und nahm sie unter Vertrag. An Mookie Blaylock erinnerte nur noch dessen Rückennummer 10, nach der das Debütalbum benannt wurde. Der Surfer mit der Matte sollte fortan zusammen mit dem anderen großen Verfechter von Flanellhemden, Strickjacken und zerrissenen Jeans, Kurt Cobain, zur großen Identifikationsfigur der Jugend werden.
Seit über 20 Jahren sind die Musiker von Pearl Jam die einzigen Übriggebliebenen der damaligen Seattle-Szene. Trotz unzähliger Nebenprojekte sämtlicher Bandmitglieder haben sie die Truppe bis heute zusammengehalten. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains und Mudhoney sind längst Geschichte, obwohl sich alle außer Nirvana auch nach 2000 noch an dem ein oder anderen halbherzigen Comeback versuchten. Als die einzigen wahren Überlebenden einer vergangenen Ära können Vedder & Co. nur noch an sich selbst gemessen werden.
Vielschichtig und durchaus mutig
Natürlich freut man sich bei einer Band, die man fast drei Jahrzehnte lang – mal mehr, mal weniger treu – begleitet hat, über jedes Lebenszeichen und hofft bei jedem neuen Album, dass man noch mal so gepackt wird wie bei „Ten“, „Vitalogy“ oder etwa auch „Binaural“. Sieben Jahre sind seit der letzten Studioproduktion „Lightning Bolt“ verstrichen, und die hatte irgendwie nicht so recht gezündet.
Das neue Album ist wieder eines der besseren Werke der fünf Männer aus Seattle geworden. Es klingt frisch, für Pearl-Jam-Verhältnisse sogar phasenweise modern, ohne dass man in puncto Sounddesign völlig dem Zeitgeist verfallen wäre. Der neue Produzent Josh Evans, der Brendan O’Brien am Mischpult abgelöst hat, tut der Band hörbar gut. Bereits die erste Single-Auskoppelung zeigt das: „Dance of the Clairvoyants“ ist ein von Synthesizern getragenes Stück, das vom Groove her ein bisschen an die Red Hot Chili Peppers erinnert, der Gitarrensound von Bloc Party oder Placebo, wenn nicht gar von den X Ambassadors inspiriert zu sein scheint. Wenn Eddie Vedder dann mit seinem gewaltigen Organ loslegt, wird daraus ein 100-prozentiger Pearl-Jam-Song.
Das Album ist gut, aber nicht überragend. Es ist mit 57 Minuten Spiellänge vielleicht 10-15 Minuten zu lang geraten. Denn nach mehrmaligem Hören stellt man fest, dass ungefähr die Hälfte der Stücke qualitativ hochwertig sind oder sich zumindest im Ohr festsetzen, während auf ein paar Lückenfüller durchaus hätte verzichtet werden können. Natürlich liegt die Messlatte bei einer Institution wie Pearl Jam immer besonders hoch, und im Grunde ist es unfair, von solchen Musikern immer etwas Geniales zu erwarten, einer soliden Arbeit mit einem schulterzuckenden „Boff“ wenig Beachtung zu schenken, während man einem Nobody bei einer vergleichbaren Produktion das Album seines Lebens bescheinigt hätte.
Originelle Arrangements und so mancher Zaubermoment
Die beiden Dampfmacher an den Gitarren Stone Gossard und Mike McCready haben sich besonders viel Mühe gegeben, ihre Instrumente in nahezu jedem Song aufregend klingen zu lassen und die Stücke originell für zwei Gitarren zu arrangieren. Auch Matt Camerons polyrhythmisches Schlagzeugspiel kam lange Zeit nicht mehr so wuchtig rüber. Nicht bei den Uptempo-Nummern, sondern bei den etwas schleppenderen wie „Quick Escape“, das die Kings of Leon wohl genau so eingespielt hätten, wenn sie die Idee dazu gehabt hätten, kommt es in Kombination mit McCreadys Gitarrensoli und ein bisschen Elektronik besonders gut zum Tragen.
Auch die von Vedder mit trotziger Schwermut vorgetragene Ballade „Alright“, das akustische „Comes Then Goes“ als Hommage an Chris Cornell sowie der Midtempo-Song „Seven O’Clock“, der sich gegen Ende in eine U2-Stadion-Mitgröl-Nummer verwandelt (ein bisschen Pathos muss sein!), sind durchaus beeindruckend und klingen so, als hätte es sie schon immer gegeben. So wie Vedders unermüdlichen Einsatz für die Menschenrechte und das Klima, den wir gerne in Kauf nehmen, trotz des ziemlich kitschigen Covers mit dem schmelzenden Polareis. (Gil Max)
Bewertung: 7/10
Anspieltipps: Dance of the Clairvoyants, Quick Escape, Alright, Comes Then Goes
Die zehn restlichen Studioalben in der Übersicht
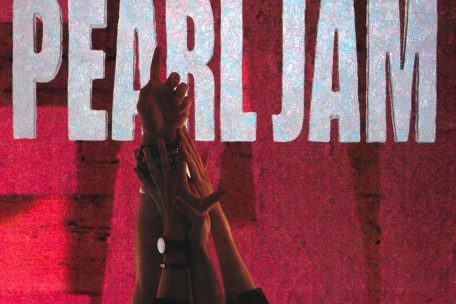
Bereits die erste Single „Alive“ zeigt, wo’s langgeht. Während die Gitarren in aggressiver Verzerrung kreischen, singt Eddie Vedder kraftvoll, düster und mit einer gehörigen Ladung Wut im Brustkasten davon, wie seine Mutter ihrem 13-jährigen Sprössling einst beichtete, sein Vater sei in Wirklichkeit sein Stiefvater und der leibliche jüngst verstorben. Das sitzt! Texte mit sensiblen Inhalten, die Auseinandersetzung mit Depressionen und Selbstmord gar ist man im Hardrock-Milieu, vor allem bei den Vertretern der „Hairmetal“-Fraktion nicht gewohnt. Das Album ist die Initialzündung des Grunge; „Nevermind“ erscheint erst einen Monat später.

Auf „Ten“ folgt der große kommerzielle Erfolg, der bald zur Last wird. Bereits in der 1. Woche gehen vom Nachfolge-Album fast eine Million Exemplare über den Ladentisch. Der Seattle-Hype hat seinen Höhepunkt erreicht. Die Band Pearl Jam pflegt weiter ihre Melange aus Gitarrenrock, Punk und Heavy-Metal-Elementen. Die Stücke sind wieder Ein-Wort-Bezeichnungen wie „Go“, „Animal“, „Dissident“, doch sie sind brüchiger, kürzer, rotziger geworden. Der Anti-NRA-Song „Glorified G“, in dem das G sowohl für Gun als auch für God steht, ist der wichtigste und mutigste.
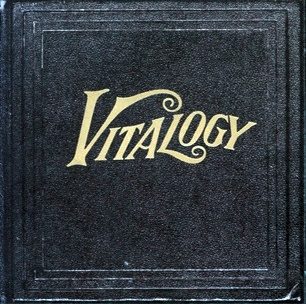
Dies ist das Album der großen individuellen Experimente, manche nennen es sogar das „Weiße Album“ von Pearl Jam. Es ist voller widerborstiger Texte und auch die Musik ist ungewohnt sperrig und phasenweise sehr punkig, wie die wilde Liebeserklärung an die Vinylplatte „Spin the Black Circle“, mit der die Band den Grammy in der Kategorie „Best Hardrock Performance“ einheimst. „Corduroy“ und natürlich „Better Man“, über Gewalt in der Ehe, sind bis heute aus ihrem Live-Repertoire kaum wegzudenken. „Ein raues und schwieriges Werk“, befindet der Rolling Stone. Pearl Jam wird nun als erfolgreichste Band der Alternative-Rockszene gehandelt.

Nachdem sie mit „Grunge-Großvater“ Neil Young auf dessen Album „Mirrorball“ zusammengearbeitet hat, überrascht die Band auf ihrem neuen Werk durch optimistische, streckenweise sehr ruhige, ausgeglichene Klänge mit Country-Einflüssen und akustischen Parts, während das Jaulen der Gitarren weit in den Hintergrund getreten ist. Viele Fans können mit den übersinnlichen, mystischen Elementen der Songs nicht viel anfangen und so hinkt das Album im Verkauf recht deutlich gegenüber den anderen. „Großartig“, kommentiert Vedder, „so können wir ein bisschen normaler sein“.
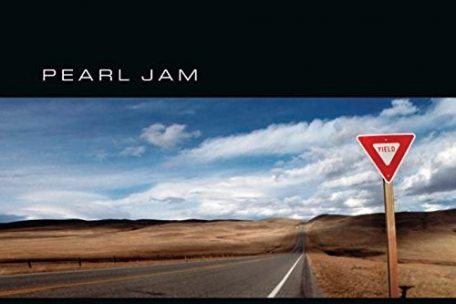
Nachdem die Musiker von Pearl Jam das jahrelang abgelehnt haben, geben sie plötzlich wieder Interviews. Auf die Frage, warum die Band überlebt habe, antwortet Vedder böse: „Zum Beispiel, weil wir uns nicht umbringen!“ Musikalisch haben sie wieder prägnantere Stücke mit der bewährten Mischung aus aggressivem Gitarren-Rock und depressivem Weltschmerz im Angebot. Kostprobe: „Do the Evolution“, der Rundumschlag gegen Kriegstreiber und Herren der Schöpfung.

Soundgarden-Drummer Matt Cameron ist, nachdem er bereits in der Gründungsphase der Band mitgewirkt hatte, wieder eingestiegen und damit sind die Akzente noch deutlicher in Richtung Rock verschoben. Am stärksten ist das desillusionierte „Nothing as It Seems“ mit Mike McCreadys Killer-Solo. „Grievance“, in dem die Band bereits früh die Internet-Sucht der Menschen thematisiert, das eingängige „Light Years“ und „Soon Forget“, in dem Vedder erstmals zu seinem Lieblingsinstrument, der Ukulele, greift und uns die alte „Geld allein macht nicht glücklich“-Geschichte erzählt, sind weitere Highlights.

Es geht auf diesem Album nicht nur um das selbstbewusste Überleben der Band – zehn Jahre nach Grunge – sondern vor allem um die Verarbeitung der tragischen Ereignisse während ihres Auftritts im dänischen Roskilde, bei dem im Sommer 2000 neun Fans in einem Massengedränge vor der Bühne zu Tode kamen. „Love Boat Captain“ ist den Opfern von Roskilde gewidmet.

Eine Platte, die beim Erscheinen wegen ihrer Kompromisslosigkeit und Power ziemlich gefeiert wird, von der Vedder sagt: „Ich mag es, dass sie aggressiv ist, und ich bin froh, dass wir nicht weicher geworden sind“, von der allerdings auch über die Jahre erstaunlich wenig hängen geblieben ist. Die meisten Songs sind dann doch lediglich eine Mischung aus den bekannten Versatzstücken. Einzige Ausnahme: das abschließende „Inside Job“ mit ungewohnten Klavierklängen und der Losung „I’ll not lose my faith“.

Die Band Pearl Jam spielt zum ersten Mal seit langer Zeit nicht nur live, sondern auch im Studio richtig befreit, ja fast beschwingt auf. Dennoch kann das Album nicht mit Vedders kurz zuvor erschienenem „Into the Wild“-Soundtrack mithalten, ist mit 37 Minuten Spielzeit das kürzeste der Bandgeschichte und driftet bei den härteren Sachen ein bisschen in beliebigen Riff- oder Classic-Rock ab.

Ein richtig schlechtes Pearl-Jam-Album gibt es nicht und wird es wohl auch nie geben, denn dafür ist die Band einfach zu gut. Doch dieses ist wohl das schwächste. Der sonderbare kompressionsartige Sound will einfach nicht zur Bodenständigkeit der Musiker passen, während die folkigen Naturstorys leicht klischeehafte Lagerfeuer-Romantik beschwören.

 De Maart
De Maart







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können