Die Kamera zoomt ran. Über den Platz, über die Straße, über die Tramschienen. Auf eine Gruppe von drei Personen, auf ihre Hände, auf die Zigarettenschachtel. Die Polizistin, die diese Kamera bedient, dreht sich in ihrem Schreibtischstuhl. Hinter ihr, in der Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei, stehen zwei Innenminister. Der Saarländer Reinhold Jost (SPD) und sein luxemburgischer Amtskollege Léon Gloden (CSV). Gloden ist auf Arbeitsbesuch in Saarbrücken – und verfolgt interessiert die Vorstellung der technischen Möglichkeiten der saarländischen Überwachungskameras.

Im Saarland gibt es diese Art von hochmoderner Live-Videoüberwachung mit mehreren Kameras seit 2020 an zwei sogenannten „Hotspots“: dem Saarbrücker Rathaus und dem Saarbrücker Hauptbahnhof. In der luxemburgischen Hauptstadt sind aktuell insgesamt rund 300 Kameras im Einsatz, vom Bahnhofsviertel über die place Hamilius und den Stadtpark bis zum Kirchberg. Kürzlich wurde im Gemeinderat bekannt, dass die Überwachung mit 67 weiteren Kameras auf Bonneweg ausgedehnt werden soll.
Neue Rolle für die Menschenrechtskommission
Wo und unter welchen Umständen hierzulande Kameras zur öffentlichen Videoüberwachung aufgehängt werden dürfen, regelt seit 2021 das sogenannte „Visupol-Gesetz“. Dieses Gesetz will Innenminister Gloden nun reformieren. Einen Vorschlag dafür hat er kürzlich der zuständigen Chamber-Kommission vorgestellt. In den Augen des Ministers dauern die Abläufe für die Genehmigungen von Kamerasystemen zu lange. Gloden wünscht sich schnellere und einfachere Prozeduren.

„Das Visupol-Gesetz war 2021 eine wichtige Neuerung, weil wir endlich einen gesetzlichen Rahmen definiert haben, den es vorher nicht gab“, sagt Meris Sehovic („déi gréng“), Mitglied des Innenausschusses. Seine beiden Parteikollegen François Bausch und Henri Kox hatten das Gesetz einst durch die Institutionen gebracht. Darin werden verschiedene Leitplanken definiert: mögliche Orte, an denen die Polizei Kameras installieren darf, aber auch verschiedene Bedingungen, wie ein Nachweis der Notwendigkeit und eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit durch Gutachten von verschiedenen Instanzen wie der Staatsanwaltschaft und dem betreffenden Gemeinderat.
Für diese Gutachten will Gloden im neuen Gesetz erstmals konkrete Fristen einführen: drei Monate für die Polizei, um spezifische Infos zu Standort und Sichtfeld der Kamera und Anzahl betroffener Personen zu übermitteln, einen Monat für Staatsanwaltschaft, Gemeinderat und die Menschenrechtskommission (CCDH). Letzterer kommt im Gesetzesentwurf eine neue Rolle zu. Sie soll zu jeder Prüfprozedur ein Gutachten mit Fokus auf den Schutz der Freiheitsrechte vorlegen.
Der Grünen-Abgeordnete Sehovic begrüßt die beschleunigten Verfahren, mahnt aber an: „Die Definition von Fristen ist das eine. Polizei und Justiz haben sich bislang nicht aus Spaß an der Freude Zeit gelassen, sondern aus Mangel an Ressourcen.“ Mehr finanzielle und personelle Ressourcen wünscht sich auch die CCDH – angesichts ihrer neuen Aufgabe. Mehr Personal, „nicht nur für die Kommission, sondern auch für die Polizei“, sagt Max Mousel, Jurist bei der CCDH. Die Kommission hat sich bereits vorab mit einer Liste von Bedingungen an das Innenministerium gewandt. Darin fordert der CCDH Zugang zu allen notwendigen Dokumenten, Informationen und Statistiken, eine schriftliche Veröffentlichung ihrer Gutachten sowie eine gesicherte Begründung des Ministers, sollte er den Empfehlungen der Kommission nicht nachkommen. „Wir wollen verhindern, dass wir eine Alibi-Kommission sind“, so Mousel.
Mehr Kameras an Umsteigeknoten und in Parks
Neben den Fristen und der neuen Rolle für die CCDH sieht Glodens Gesetzesentwurf noch weitere Neuerungen vor. Eine davon ist das Initiativrecht für den Bürgermeister einer Gemeinde, der in Zukunft bei der Polizei eine Analyse beantragen können soll, ob an bestimmten Orten eine Videoüberwachung möglich sei. Für den Escher Schöffen Sehovic stellt dieses neue Recht ein Angebot dar, „das gar nicht gebraucht wird“. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sei primär die Aufgabe des Staates, so Sehovic. „Ich sehe keinen Mehrwert in der Stärkung der kommunalen Mitsprache.“

Die potenziell weitestreichende Gesetzesänderung findet sich jedoch im neuen Schlusssatz des ersten Absatzes. Hier werden Verkehrsknotenpunkte („pôles d’échange“) und öffentliche Parks automatisch als gefährliche Orte mit besonderem Risiko für Straftaten definiert. Wenn dort in Zukunft Kameras installiert werden sollen, muss nicht mehr vorab nachgewiesen werden, dass es keine anderen Mittel zur Verhinderung und Verfolgung von Straftaten gibt als die Überwachung mit einer Kamera. Sehovic sieht das kritisch: „Die Generalisierung der Risikoannahme ist nicht zielführend. Eingriffe in Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte brauchen immer eine Prüfung.“ Er warte in dieser Sache gespannt auf die Gutachten von Staatsrat und CCDH. Letztere wolle sich in den kommenden Monaten mit einer eigenen Analyse zu Wort melden, verspricht Jurist Mousel.
Hinzu kommt: Die genaue Definition der Verkehrsknotenpunkte ist schwammig. Im Kommentar des neuen Visupol-Gesetzesentwurfs wird auf einen älteren (ungestimmten) Gesetzentwurf zur Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr verwiesen, der die „pôles d’échange“ definiert als „lieux de transit à forte concentration de personnes, identifiés comme zones à risque accru de commission de crimes et délits“. Zum einen könnte das auf fast alle Zug- und Busbahnhöfe des Landes zutreffen, zum anderen liegt hier die Gefahr eines „runaway feedback loop“: Verkehrsknotenpunkte werden als gefährliche Orte definiert, weil man sie als Orte identifiziert, an denen verstärkt Straftaten begangen werden. Dort, wo Kameras installiert sind, könnten also in Zukunft noch mehr Kameras angebracht werden, weil mehr Straftaten aufgezeichnet werden als dort, wo es keine Überwachung gibt.
Was den Einsatz von KI-Systemen anbelangt, bleibt Glodens Entwurf bei der Formulierung des ursprünglichen Textes: „Die Bildaufnahme kann den Einsatz von Fokussierungstechniken und automatischer Situationserkennung beinhalten. Der Einsatz von Techniken zur Gesichtserkennung ist ausgeschlossen.“ Damit folgt Luxemburg EU-Recht. Im vergangenen August ist der AI Act in Kraft getreten, das weltweit erste Gesetz zur Regulierung von KI. Der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum wird darin grundsätzlich verboten. Eine Ausnahme hatten die Mitgliedstaaten jedoch gegenüber dem Parlament durchgesetzt: Polizei und andere Sicherheitsbehörden dürfen eine solche Gesichtserkennung im öffentlichen Raum nutzen, um bestimmte Straftaten wie Menschenhandel oder Terrorismus verfolgen zu können. Für CCDH-Jurist Max Mousel stellt sich im luxemburgischen Kontext hingegen die Frage, ob dieses Gesichtserkennungsverbot nur für das Live-Bild der Kameras gelte oder auch für eine Analyse der Bilder im Nachhinein.

 De Maart
De Maart







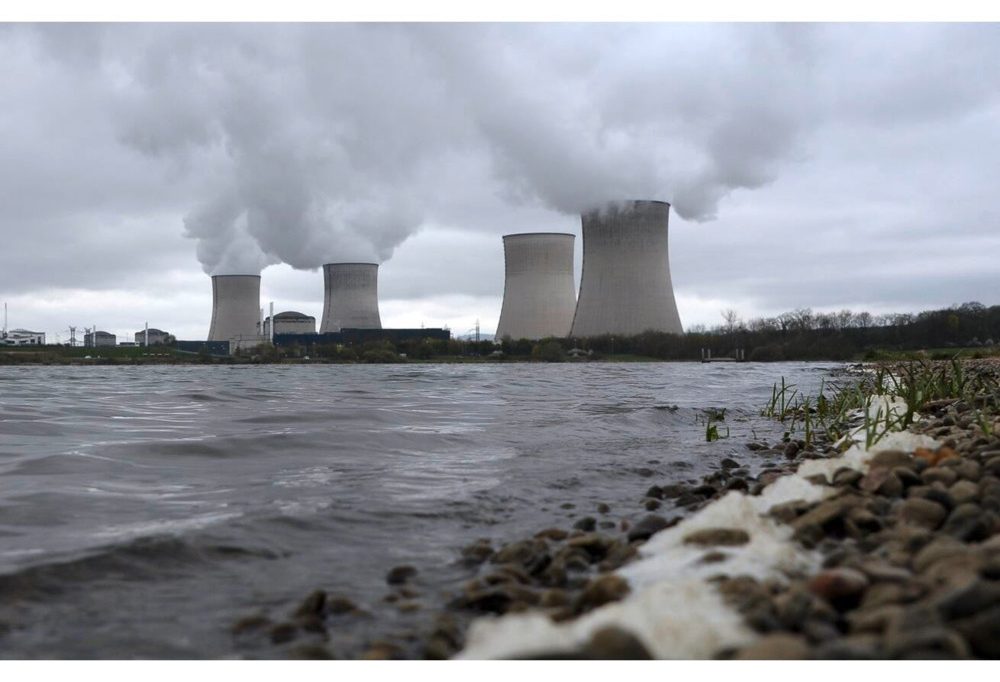

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können