Marie-Antoinette Majerus ist gerade erst sieben Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg ausbricht. Als Kind bekommt sie sowohl die Nazipropaganda als auch die Verheimlichungen der Eltern mit. Die Ardennenoffensive erlebt sie hautnah – und kommt nur knapp mit ihrem Leben davon.
Den Krieg als Dorfkind erleben
Im Mai 1940 erlebt Marie-Antoinette Majerus die Auswirkungen des Krieges in Luxemburg hautnah. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht am 10. Mai 1940 flüchten etwa 45.000 Zivilist*innen aus dem Süden von Luxemburg in den Norden. Im abgelegenen Dorf Welscheid erhoffen sich zahlreiche Geflohene etwas Sicherheit. Im Haus der Familie Majerus sowie bei fast allen anderen Dorfbewohner*innen finden die Unbekannten Unterschlupf.
Die Serie
In der Rubrik „E Bléck duerch d’Lëns“ liefern die Historiker*innen André Marques, Julie Depotter und Jérôme Courtoy einen facettenreichen Blick auf verschiedene zeitgeschichtliche Themen.
Trotz der rationierten Lebensmittelkarten und des wenigen Geldes leidet die Familie Majerus während der Besatzung keinen Hunger. Das eigene Vieh versorgt die Familie mit frischer Milch und der darauf abgesetzten Rahm. Wenn es mal keine Butter für das Brot gibt, tröstet die Großmutter die Kinder mit einer „einfachen Gebeeseschmier“ mit hauseigener Marmelade. Die Bäuer*innen versuchen jedoch auch den strengen Nahrungs-Einschränkungen zu entgehen: Statt einem werden heimlich zwei Schweine geschlachtet oder man schummelt bei der Lebensmittel-Abgabe. So gelingt es manchen Einwohnern, sich solidarisch mit in Not geratenen Menschen zu zeigen und etwas von ihrem eigenen Hab und Gut abzugeben.

Die meisten Dorfbewohner*innen seien laut Marie-Antoinette „gutt Lëtzebuergesch“ gewesen. Die wenigen Kollaborateur*innen zeigen sich jedoch offen als „preussig“, verstecken also ihre pro-deutsche Einstellung nicht. Dementsprechend müssen die Bewohner*innen vorsichtig mit ihrer Opposition zum NS-Regime umgehen, um unnötige Aufmerksamkeit und mögliche Denunziationen zu verhindern.
Auch vor den eigenen Kindern müssen sich die Erwachsenen in Acht nehmen: Der jüngeren Generation wird so wenig wie möglich erzählt. „D’Kanner hu laang Oueren […] a soen ëmmer d’Wouerecht, dofir ass net vill geschwat ginn, well wann se näischt woussten, hunn se näischt erzielt“, erinnert sich Marie-Antoinette. Das heimliche Hören des englischen Radiosenders wird zum organisatorischen Spagat: Die Familie Majerus muss dies sowohl vor den Kindern als auch vor den Nachbarn vertuschen.
NS-Indoktrination im Schulunterricht
In der Schule sind Marie-Antoinette und ihre Schulkamerad*innen dem Drill des Dorflehrers, der die NS-Abzeichen trägt, ausgesetzt. Die Kinder beginnen den Schultag mit dem Deutschlandlied und müssen den Führer grüßen. Marie-Antoinette erinnert sich, dass „déi grouss Kanner aus dem 7. an 8. Schouljoer eis bäibruecht hunn, ,Deutschland Deutschland unter alles‘ ze sangen“. Der restliche Unterricht ist stark nationalsozialistisch ausgerichtet, während die französische Sprache in allen Lebensbereichen verboten wird. Dies hat auch Auswirkungen auf die Vornamen der Familie Majerus, die eingedeutscht werden. Deren Kinder heißen nun Maria, Antonia, Konstantia und Theresia.
Ganz anders läuft es im Nachbarsdorf Kehmen ab. Hier entschloss sich die Lehrerin, den Kindern weiterhin Französisch beizubringen – die deutschen Lehrbücher werden stattdessen hinten im Klassenzimmer verstaut.
Mit der Einführung des Reichsarbeitsdienstes (RAD) werden die jungen Luxemburger der Jahrgänge 1920 und 1927 eingezogen. Um dem RAD zu entgehen, verstecken sich fast alle jungen Männer aus Welscheid in den herumliegenden Wäldern. In den Feelener Hecken harren sie in einem Bunker aus. Da dieser gut angelegt ist, werden die Jongen bis Kriegsende nicht entdeckt. Jeden Abend organisieren zahlreiche Einwohner die Essensverpflegung der Refraktäre. Wenn die Kinder fragen, wo „Monnie Ars“ jeden Abend mit einem großen Rucksack verschwindet, antworten Marie-Antoinettes Eltern, er gehe zur oder komme von der Jagd und habe einen Hasen im Rucksack.
„Vu lauter Angcht hues de keng Keelt gespuert“
Am 9. September 1944 wird Luxemburg durch die Alliierten befreit. Mit der Ankunft der US-Amerikaner im Ösling läuft Marie-Antoinette mit ihren Dorffreundinnen Anne und Ketty Brochmann am 11. September zu Fuß nach Ettelbrück. Sie wollen die Befreier mit ihren eigenen Augen sehen, denn „mir hunn déi Amerikaner nëmme kannt vum Héierenzielen – et gouf keng Televisioun“.
Die Freude ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn bereits Mitte Dezember 1944 überfallen die Deutschen erneut das Ösling. Mit der Ardennenoffensive verschlimmert sich das Leben der Bewohner*innen der Gemeinde Burscheid schlagartig: Sie befinden sich inmitten der Schusslinie. Die plötzliche Rückkehr der deutschen Wehrmacht löst große Verwirrung aus, während der starke Artilleriebeschuss in Welscheid eine Flucht unausweichlich macht. Die Bewohner suchen vorübergehend Schutz in ihren Kellern, doch nur die wenigsten besitzen ein geschütztes unterirdisches Versteck. In der Lagerkammer der Familie Majerus glauben sich die Schutzsuchenden einigermaßen in Sicherheit – doch auch dieser hält dem starken Beschuss nicht lange stand. Die Kälte und der Hunger machen den Zivilist*innen stark zu schaffen, doch vor allem dominieren die allgegenwärtige Verwirrung und Angst: Es geht nur noch ums Überleben. Von den Erwachsenen lernen die Kinder schnell, wie sie sich bei vorbeifliegenden Flugzeugen zu benehmen sollen: sofort flach auf den Boden schmeißen oder hinter einer Hecke verstecken.
„Mir koumen net fort, et wosst keen, wouhi mer solle lafen!“
Der andauernde und mehrtägige Artilleriebeschuss hinterlässt vollkommene Zerstörung. Mehrere Male versucht die Familie Majerus zu fliehen: Sie laufen ziellos in Richtung Feulen ehe sie umkehren müssen, da das Dorf kaum sicherer ist als ihr eigenes. Am 30.12.1944 fliehen sie ein letztes Mal, gemeinsam mit den Nachbarsfamilien Brochmann und Olsem. Ohne Zeit zum Packen begeben sie sich auf die lebensgefährliche Flucht durch das Warktal nach Ettelbrück und müssen Kälte und Hunger bewältigen.

„Si hunn einfach do op eis geschoss, si hate gemengt, et wiere preisseg Zaldoten. Mir konnte guer net gleewen, dass d’Amerikaner op eis geschoss hunn“ beschreibt Marie-Antoinette Majerus die Flucht. Der Beschuss intensiviert sich dermaßen, dass die Flüchtlinge eingekesselt werden und nicht mehr weiterlaufen können. Die gesprengten Warkbrücken erschweren das Überqueren des Flusses und somit die Flucht. So bleibt den Familien nichts anderes übrig als hinter einem Hügel im halb zugefrorenen Wassergraben auszuharren.
Um Marie-Antoinettes jüngste Schwester vor der eisigen Kälte zu bewahren, liegt der Vater schützend über ihr – und bleibt dabei mit den Vorderarmen am Eis festgefroren. Auch dem zehnjährigen Jos Brochmann bleibt der Fuß im gefrorenen Wasser stecken. Er kann nur mit Mühe wieder befreit werden. Marie-Antoinette harrt Rücken an Rücken mit der 14-jährige Anne Brochmann aus – Letztere wird jedoch von einem Splitter getroffen und stirbt noch vor Ort. Sie ist eine von sechs Personen, die diesen Angriff nicht überleben. Die Toten müssen bei der weiteren Flucht leider zurückgelassen werden. In Warken finden die Überlebenden endlich Zuflucht und treffen weitere Geflüchtete aus Welscheid wieder.
Mitte Januar 1945 darf die Familie Majerus nach Welscheid zurückkehren. Um den Anblick der Leichen der Angehörigen zu vermeiden, laufen sie stattdessen über das Dorf Bürden zurück. Die Leichen werden kurze Zeit später von der Dorfjugend zurückgebracht und zu Grabe gelegt.
Nach dem Krieg legen Marie-Antoinette und ihr Ehemann Jos Brochmann großen Wert darauf, die Kriegserlebnisse aus ihrer Kindheit weiterzugeben, um künftige Generationen aufzuklären.
Lesen Sie auch:
E Bléck duerch d’Lëns / „Eine wahre Weltuntergangsstimmung“ – Fluchtgeschichten aus der Gemeinde Burscheid

 De Maart
De Maart


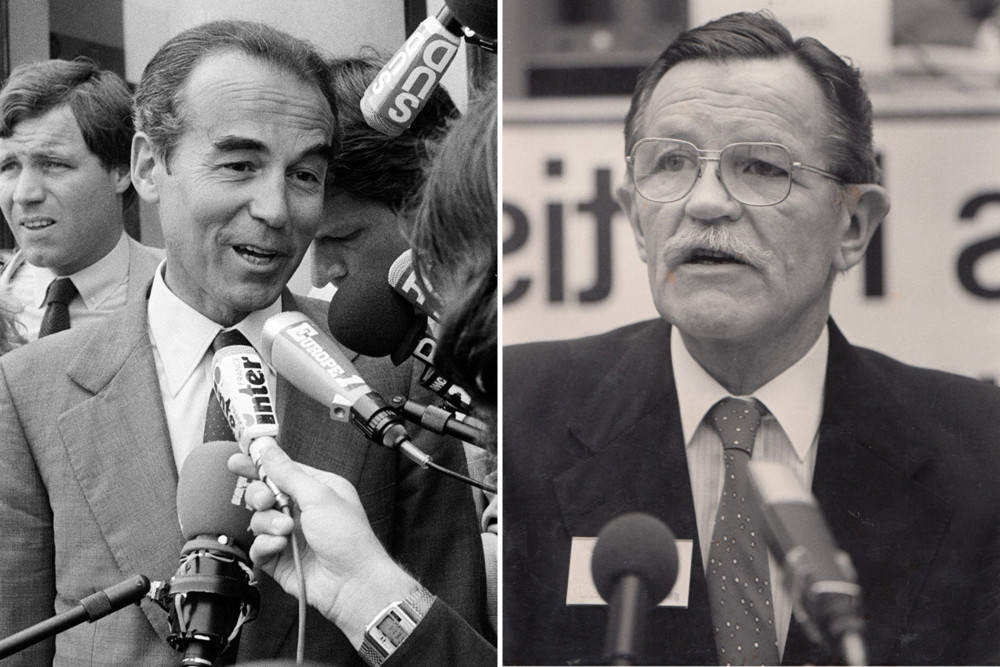




Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können