Die Betroffenen seien damit nicht einverstanden, argumentiert Dublin; die Iren sollten doch erst einmal vor der eigenen Türe kehren, kontern die Briten. Gerade erst hat ein Gericht in Derry die Anklage gegen jenen Soldaten zugelassen, der im Januar 1972 beim „Bloody Sunday“ zwei unbewaffnete Zivilisten erschossen hatte.
Wogegen wendet sich Dublin konkret?
Nach langer Debatte erließ das britische Parlament im Herbst ein neues Gesetz: Von kommendem Mai an soll es keine weiteren gerichtlichen Untersuchungen jener Bluttaten mehr geben, die Nordirland in den Bürgerkriegsjahren zwischen 1969 und 1998 erschütterten. Viele Morde, Bombenattentate und schwerste Körperverletzungen sind ohnehin längst kriminalpolizeilich ausermittelt, bei anderen stießen die Fahnder auf eine Mauer des Schweigens, und zwar sowohl bei den Paramilitärs beider Seiten als auch beim britischen Geheimdienst MI5.
Diesen Fällen gilt die Aufmerksamkeit der vom Gesetz neu eingeführten Kommission ICRIR. Deren offizieller Name führt „Versöhnung und Informationsgewinnung“ (reconciliation and information recovery) im Titel, womit ihre Aufgabe umrissen ist: Statt weiterer Strafverfolgung soll das Gremium unter Leitung des früheren nordirischen Höchstrichters Declan Morgan die Nordiren zusammenführen und vor allem jenen Menschen helfen, die seit Jahrzehnten im Unklaren über den Verbleib ihrer Angehörigen schweben.
Die Fälle dieser „Verschwundenen“ (disappeared) hat vor allem dem Ansehen der katholischen Terrortruppe IRA schwer geschadet. Der prominenteste Fall war Jean McConville, eine 38-jährige Witwe und Mutter von zehn Kindern, die 1972 als angebliche Informantin der britischen Armee von der IRA entführt und ermordet wurde. Erst 31 Jahre später konnten ihre sterblichen Überreste lokalisiert und begraben werden. Drei andere IRA-Opfer bleiben verschwunden.
Und worin liegt das Problem?
Um neues Licht in den Verbleib der Verschwundenen und die anderen rund 1000 unaufgeklärten Kriminalfälle der Bürgerkriegsphase zu bringen, sieht das britische Gesetz eine „bedingte Amnestie“ für Straftäter vor. Im Gegenzug sollen diese der Kommission Informationen zur Verfügung stellen, die „korrekt nach bestem Wissen und Gewissen“ sein müssen. Diese Schwelle halten viele Fachleute für viel zu niedrig. So spricht Amnesty International davon, das Gesetzeswerk lasse „Mörder davonkommen“.
Kommissionschef Morgan verteidigt sein Gremium: Man werde „mit der gleichen Sorgfalt“ vorgehen wie gerichtliche Untersuchungen. Hingegen hält Dublin das Gesetz für unvereinbar mit dem Karfreitagsabkommen von 1998, das den Bürgerkrieg beendete. Ihm bleibe „keine andere Wahl“ als der Gang nach Straßburg, beteuert Premier Leo Varadkar.
Wie reagieren die Briten?
Auf konservativer Seite ist man empört. Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris nannte Dublins Vorgehen „töricht“. Die irischen Behörden hätten „keine gemeinschaftliche, dauerhafte Anstrengung“ unternommen, um Mörder und Terroristen vor Gericht zu bringen. Er werde das neue Gesetz „robust verteidigen“, beteuerte auch Premier Rishi Sunak.
Der britische Hinweis auf die lasche Strafverfolgung in der Republik trifft einen empfindlichen Nerv. Der irischen Gesetzeslage zufolge hätte eigentlich „jede Tötung, jede Schießerei, jede Terrorbombe“ im Norden der grünen Insel durch die südirische Polizei verfolgt werden müssen, berichtet der frühere Innen- und Justizminister Michael McDowell. „Das haben wir nicht gemacht.“
Labour-Chef Keir Starmer, ein früherer Leiter der englischen Staatsanwaltschaft, hat bereits angekündigt, im Fall eines Wahlsieges werde seine Regierung das Gesetz annullieren. Allerdings sieht man auch bei der Opposition die Notwendigkeit, die Gesetzeslage neu zu regeln.
Wie reagieren die Nordiren selbst?
In der tief zerstrittenen Belfaster Politik hat das Vorhaben der britischen Konservativen eine Art von Wunder bewirkt: Alle Parteien lehnten das Gesetzeswerk ab. In der Bevölkerung spielt die Angelegenheit keine große Rolle. Viele Menschen seien der Meinung, berichtet die Rentnerin Geraldine Rea aus Derry, „dass vor allem britische Geheimdienst-Leute geschützt werden sollen“.
Tatsächlich richten sich die jetzt noch anhängigen Verfahren weit überdurchschnittlich gegen frühere Soldaten und andere Angehörige der britischen Sicherheitsbehörden. Das hat mit der deutlich besseren Aktenlage zu tun; Unterlagen über das Treiben paramilitärischer Gruppen gibt es naturgemäß deutlich seltener.
Spannend dürfte im kommenden Jahr ein Prozess vor dem Krongericht von Belfast werden. Dorthin hat jetzt das Magistratsgericht von Derry den seit Jahren anhängigen Fall eines Ex-Fallschirmjägers überwiesen, der aus Gründen des Datenschutzes nur als „Soldat F“ bekannt ist. Am berüchtigten „Blutsonntag“ vom 30. Januar 1972 soll er, so die Anklage, zwei unbewaffnete Demonstranten getötet sowie fünf weitere verletzt haben. Insgesamt starben damals im Kugelhagel der Elite-Einheit 14 Menschen, darunter acht Teenager; fünf der Opfer wurden auf der Flucht von hinten erschossen.

 De Maart
De Maart



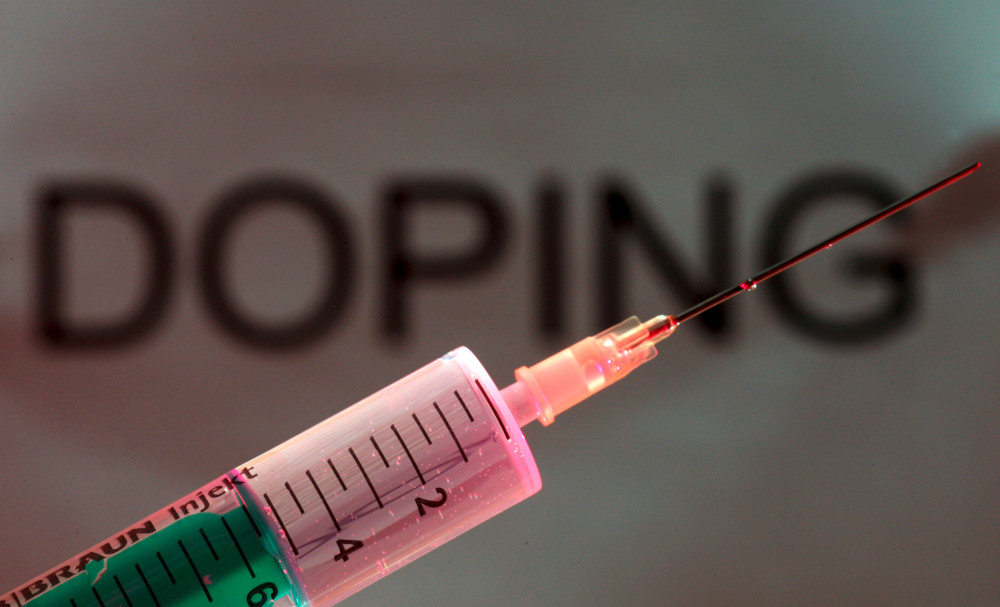



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können