Es war kein Rückblick auf die vergangenen drei Monate und auch keinen Ausblick auf die kommenden drei Monate, den Guy Wagner Ende September vor Vertretern der Finanzwelt hielt – sondern ein viel langfristigerer Blick auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Gefeiert wurde bei der Veranstaltung der 20. Geburtstag des Fonds „BL Global Flexible EUR“.
Mehr als zwei Jahrzehnte als Beobachter der Finanzmärkte haben seine Sichtweise verändert: „Es sind die Nebentendenzen, die wichtiger sind“, betont der langjährige „Chief Investment Officer“ (CIO). Statt sich auf kurzfristige Quartalsprognosen zu konzentrieren, bevorzugt er einen intensiveren Blick auf langfristige Faktoren, die das Geschehen an den Märkten beeinflussen. Er nennt die Demografie, immer weniger freie Marktwirtschaft, steigende Staatsschulden und Veränderungen in der Weltpolitik.
Freie Marktwirtschaft im Rückwärtsgang
Was den ersten Punkt, die demografische Entwicklung betrifft, so sei man in den westlichen Staaten „mittlerweile längst bei dem angekommen, was vor 20 Jahren noch Zukunftsmusik war“, hebt er hervor. Europa habe den Höhepunkt seiner erwerbstätigen Bevölkerung bereits im Jahr 2010 überschritten. „Seitdem geht es mit ihrer Zahl bergab.“
Gleichzeitig lasse die Politik der Wirtschaft immer weniger freien Lauf, beobachtet Wagner. Der Staat versuche zunehmend zu steuern und zu lenken. Er spricht von „übermäßiger Regulierung“ mit in der Folge „stetig steigenden Staatsausgaben“. Das alles im Dienste politischer Prioritäten. Guy Wagner redet von einer zunehmend „zentral geplanten Wirtschaft“ in den westlichen Staaten.
„Seit 1997 explodieren die Schulden“
Eine direkte Konsequenz dieser beiden Trends und der betreffenden politischen Entscheidungen sei dann die aktuell „sehr hohe Verschuldung“ der Industriestaaten. „Bereits seit 1997 explodieren die Schulden.“ Besonders problematisch: Diese Schulden tragen kaum zur Schaffung neuen Wachstums bei, kosten die Staaten aber in Form von Zinszahlungen immer mehr Geld.
Immer mehr stellen sich dann auch die Fragen der Kosten dieser Schulden, hebt er weiter hervor: Ob die Schulden finanzierbar sind, hänge vornehmlich mit der Höhe der Leitzinsen zusammen – doch die sind 2022, erstmals seit Jahren, wieder gestiegen. Für die USA bedeute dies, dass der Anteil der Steuereinnahmen, die für Zinszahlungen gebraucht werden, sich zwischen 2022 und 2024 von 8 auf 16 Prozent verdoppelt hat. In den kommenden Jahren bis 2027 müssen zudem sehr viele Schulden refinanziert werden. Das bedeutet, dass der Staat viele neue Kredite aufnehmen muss, um auslaufende, alte Schulden zurückzuzahlen. Doch: „Wer wird die neuen US-Schulden kaufen? Sicherlich nicht China.“
Machtverschiebung nach Osten
Angekommen ist er damit bei den Veränderungen in der Weltpolitik: „Immer mehr Länder wollen aus der vom US-Dollar dominierten Welt aussteigen“, hebt er hervor. Und das in einer Zeit, in der das wirtschaftliche Gewicht der Schwellenländer, in Kaufkraft ausgedrückt, bereits „seit 2008 gewichtiger als die fortgeschrittenen Volkswirtschaften“ ist. „China ist längst zu einer Wirtschaftsmacht geworden. Es verkauft fast doppelt so viele Autos wie Deutschland“, verdeutlicht er die Dimension dieser Verschiebung.
Guy Wagner ist überzeugt, dass die Weltwirtschaft derzeit auf der Suche nach einem neuen Gleichgewicht ist.
Während die Inflationsrate in den traditionellen Industriestaaten bei über zwei Prozent tendenziell höher liegt als in den Vorjahren, zeige die Konjunktur in den westlichen Staaten nur noch sehr geringe Schwankungen. Die traditionellen Zyklen mit Phasen schnellen Wachstums, gefolgt von Rezessionen, scheinen der Vergangenheit anzugehören, beobachtet er. „Die Schwankungen sind weg. Es ist keine Krise gekommen.“
Alternde Gesellschaft bestimmt die Politik
Gründe dafür sieht er mehrere: So etwa, dass die westlichen Volkswirtschaften mehr und mehr von Dienstleistungen getrieben sind, für die es eine eher stabile Nachfrage gibt. In den USA beispielsweise bezögen sich rund 20 Prozent der Ausgaben auf Gesundheitsausgaben. Tendenz steigend mit einer weiter älter werdenden Bevölkerung. Die zyklischeren Sektoren, die Produktion von Waren, seien in andere Länder ausgelagert worden.

Hinzu kommt, dass es, politisch gesehen, „keine Toleranz für Rezessionen mehr gibt“, sagt er. Eine alternde Bevölkerung mit Rentenansprüchen wünsche sich Stabilität in der Wirtschaft und an der Börse – kein schnelles „Auf und Ab“. Entstanden sei somit eine stabilere Wirtschaftsstruktur mit jedoch gedämpften Wachstumsraten. Die Börsen derweil seien heute nicht mehr da, um Firmen zu finanzieren, sondern um Renten zu finanzieren. „Dafür will die Politik auch keine fallenden Kurse in Kauf nehmen.“
Die USA unter Donald Trump versuchen gegenzusteuern. Das Ziel: Das Wachstumsmodell soll nicht mehr nur durch starken Konsum, sondern durch die Produktion der heimischen Industrie angetrieben werden.
Schwacher US-Dollar erwünscht
„Niedrigere Zinsen, Einnahmen durch Zölle – das ergibt alles Sinn und bringt den USA Geld“, analysiert Wagner. „Es ist nicht immer richtig, wenn Medien sich über Trump und seine Politik lustig machen. Mehr Produktion und niedrigere Zinsen helfen beim Finanzieren der Schulden. Und da Europa keine Gegenzölle einführt, ist die USA reiner Gewinner dieser Strategie.“
Und die USA brauche in den nächsten paar Jahren sehr viel Geld, erinnert er an den anstehenden Bedarf zur Refinanzierung des Schuldenberges. „Die Schulden sind hoch. Das Defizit ist hoch. Viel Geld muss zurückgezahlt werden. Das Senken der Staatsausgaben ist schwierig. Auch in den USA.“ Helfen, um die bestehenden Handelsdefizite auszugleichen, würde dabei auch ein schwächerer US-Dollar.
China: Der umgekehrte Weg
China ist dabei in genau der gegenteiligen Lage, so Wagner weiter. „Das Land ist eine Industriemacht geworden“ und müsse nun den Wechsel hin zu mehr Konsum fördern. In diesem Sinne müsse die chinesische Währung, die wie viele asiatische Währungen stark unterbewertet sei, deutlich zulegen.

Aus diesen fundamentalen Verschiebungen leitet Wagner eine Strategie zum Investieren für seinen Fonds ab: Angesichts der Schuldenlage und unterfinanzierten Pensionsfonds sei es interessanter, auf Aktien statt auf Anleihen (Schuldscheine; Anm. d. Red.) zu setzen. Qualitativ hochwertige Firmen würden an den Börsen knapper, während die G7-Staaten immer mehr Schulden auf den Markt bringen.
Zudem sei es interessanter, „mehr in Asien zu investieren, und weniger in den USA“, ist er überzeugt. „Der Investor muss nach Osten gehen, mehr und mehr.“ Er warnt vor eklatanten Ungleichgewichten: Nordamerika stehe für rund 70 Prozent des Gewichts der weltweiten Aktienmärkte, aber nur für 20 Prozent der reellen Wirtschaft. „Das scheint mir übertrieben.“ Und drei Firmen stehen allein für 20 Prozent der S&P500. „Das ist enorm.“ Das Unternehmen Nvidia allein sei teurer als der gesamte deutsche Aktienmarkt. „Das ergibt keinen Sinn.“
Das pessimistische Szenario ist immer überzeugender als das optimistische. Das optimistische ist aber meist das realistischste.
Trotz der aktuellen Höchststände bleibt Wagner derweil bei Gold zuversichtlich. Mit sinkendem Vertrauen in die Weltpolitik, einem schwächer werdenden Dollar, kaufenden Zentralbanken und höheren Inflationsraten blieben die Argumente bestehen, sagt er. Zudem sei der Preisanstieg, wenn man die Inflation mit einrechne, nicht so enorm, wie die Grafiken suggerierten. Es gebe keine spekulative Übertreibung. Wagner ist überzeugt, dass der Preis noch weiter steigen kann – der Preisanstieg liege weit hinter dem Wachstum der Geldmenge.
Zum Abschluss der Rede teilte er eine psychologische Lektion, die er in den letzten 20 Jahren gelernt hat: „Das pessimistische Szenario ist immer überzeugender als das optimistische. Das optimistische ist aber meist das realistischste.“
Das könnte Sie auch interessieren:
Auf Globalisierung folgt Deglobalisierung: Interview mit Thieß Petersen von der Bertelsmann-Stiftung

 De Maart
De Maart







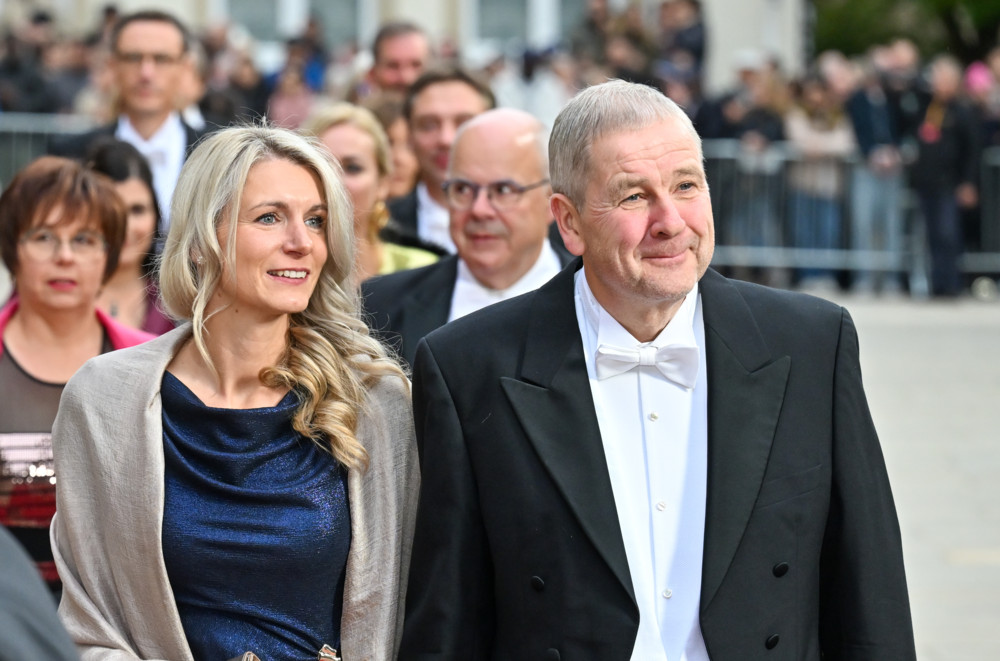

Die tektonische Umwälzung der Weltwirtschaft hervorgerufen durch einen megalomanen Hanswurst in Amerika soll also jetzt einen Kampf zwischen konsumgetrieben und produktionsorientiert Teilen der Weltwirtschaft bewirken?
Hört sich alles sehr theoretisch an, ob die Realität auch so ist, darf man wohl fragen, bevor man jetzt Investitionen umorientieren soll?