„Sie selbst zumindest habe sich den Text in den Jahren, die sie schreibend verbracht habe, nie als Rettung, sondern vielmehr als Ausdruck einer irren, gellenden Lebendigkeit gedacht, einer Gegenwart, von der sie selbst ja ganz durchschossen sei“, so die Ich-Erzählerin auf den ersten Seiten von „Die Holländerinnen“.
Der vor Kurzem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Roman von Dorothee Elmiger erzählt von einer Schriftstellerin, die mit einer Theatergruppe auf Recherchetour in den Dschungel von Panama aufbricht, auf den Spuren zweier holländischer Touristinnen, die dort 2014 unter ungeklärten Umständen verschwunden sind – ein realer Fall, der Stoff für Spekulationen und Finten liefert.
160 Seiten in der Möglichkeitsform
So denkt man zuerst an die Entführungen von Tourist:innen in den 1980er- und 1990er-Jahren durch revolutionäre Gruppierungen in Peru, wie „Cendero Luminoso“ (Leuchtender Pfad) oder „Tupac Amaru“.
Doch beginnt die Erzählung in einem Hörsaal. Dort soll die namenlose Erzählerin, eine erfolgreiche Schriftstellerin – „Man stellt sie vor als bedeutende Erzählerin, als eine der wichtigsten Stimmen dieser Zeit (…)“ – von ihrem Schreiben erzählen. Und sie beginnt in der Möglichkeitsform, dem Konjunktiv, und wird diese Form auf 158 Seiten durchhalten.
Eine klassische Poetikvorlesung zu halten, fällt ihr nicht leicht, denn seit den zwei Wochen im Urwald ist sie durchdrungen von den unheimlichen Erlebnissen; seitdem folge ihr Denken und Schreiben keinem roten Faden mehr. Stattdessen wolle sie von der Erschütterung erzählen, die ihr im Urwald widerfuhr. Elmiger tut dies, fragmentarisch, in Episoden und indem sie immer neue Pfade innerhalb der eigentlichen Erzählung einschlägt.
Beständige Reflexion des eigenen Schreibens

Wie schon in „Aus der Zuckerfabrik“ (2020), einer Art reflektierendem Recherchebericht mit assoziativen Fäden, ist auch ihr Roman „Die Holländerinnen“ gespickt mit literarischen Reminiszenzen. Elmiger verarbeitet zahlreiche Zitate, wie einst gesammelten Karteikarten entnommen, spinnt Gedankengänge, scheinbar zufällige Betrachtungen, Fäden weiter und verwebt sie zu einem großen, vielschichtigen Ganzen, einem beunruhigenden Brueghel’schen Gemälde, einer Erzählung mit tiefen Abgründen.
Schon zu Beginn reflektiert die Erzählerin die Schwierigkeit des eigenen Schreibens: „Tag für Tag, sagt sie, habe sie sich in den letzten Wochen vor ihren Laptop gesetzt und an diesem Vortrag gearbeitet, aber über Nacht sei ihr stets bedeutungslos geworden, was sie tags zuvor aufgeschrieben habe, und einer gespensterhaften Penelope gleich habe sie das am Vortag Gewobene immer wieder aufgetrennt.“ Später wird sie über das Gefühl schreiben, „abzudriften, haltlos geworden zu sein“.
Wie ein Flickenteppich
Einem Flickenteppich gleich webt Elmiger so ihre magische Erzählung, verweist auf Brueghel, auf Arendt und immer wieder auf Walter Benjamin und Theodor W. Adorno. Dass ihr Roman trotz der zahlreichen Bezüge und Verweise nicht akademisch überladen wirkt, liegt nicht zuletzt an der ihr eigenen Erzählkunst. Sie schafft es in Windeseile, die Leser soghaft in ihre Erzählung hineinzuziehen.
Mittels ihrer Figuren spinnt sie Fäden, etwa indem sie den Theatermacher, dem die Ich-Erzählerin durch den Urwald als Chronistin folgt, über sein Vorhaben sprechen lässt. Er plane im Sinne einer Theatermaschine ein gigantisches Projekt, das er sich in Referenz u.a. auf Herzog als eine Art „tropische Passion“ vorstelle. Einmal habe er [der Theatermacher] eine Passage aus Walter Benjamins Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows zitiert, in der es heiße, die Figur des Erzählers sei „uns etwas bereits Entferntes und weiter noch sich Entfernendes“, um dann zu fragen, ob man sich in diesem Sinne nicht auch die Holländerinnen als Erzählende denken könne, die weit vor ihnen gehend sich fortlaufend entfernten, deren Spuren sich im Dickicht des Urwaldes verlören.
Theater als Mittel zur Bekämpfung unserer Geister
Die Rolle der Erzählerin sei eine Art Mitschrift, die im Grunde ALLES enthalte, um aus diesem Text später eine Art Drehbuch zu schaffen, so erklärt ihr der Theatermacher anfangs ihre Aufgabe. „Das Theater sei so gesehen immer ein Zombietheater, das von den Untoten handele, es sei Ritual, Geisteraustreibung: Im Theater versuchten wir uns zu befreien von unseren Vorvätern, unseren Müttern, von Hitler, Inzest, falschen Mythen.“
Insgesamt, sagt sie, sei sie während dieser Reise zwischen den Wendekreisen immer wieder zu einer Feststellung zurückgekehrt, die sich auch bei Merleau-Ponty finde: Es sei „dem Sichtbaren eigentümlich“, schreibe dieser, „im strengsten Sinne des Wortes durch ein Unsichtbares gedoppelt zu sein, das es als ein gewissermaßen Abwesendes gegenwärtig macht“.
Seit dem Beginn ihrer Reise spürt die Erzählerin ein diffuses Unbehagen: „Das Gefühl, etwas sei aus dem Lot geraten, das Gebiet werde von einer Art atmosphärischen Störung beherrscht.“ Oft habe sie Bachmann zitiert: „Es ist Krieg. Und du bist der Krieg. Du selber. – Ich nicht. – Wir alle sind es, auch du.“
Reise ins Nirgendwo
Man müsse alles, was nun folge, erklärt sie, im Kontext der Holländerinnen betrachten, „den Terror der Nächte, die schonungslosen Tage, vor dem Hintergrund dieser Geschichte verstehen, die der Theatermacher für sein Stück noch mal hervorgeholt und ans Licht geschleift habe, weil er darin, so seine Erklärung, etwas in Bilder gefasst oder in diesen Bildern enthüllt finde, das er aber nicht sagen könne, das sich grundsätzlich nicht sagen lasse“.
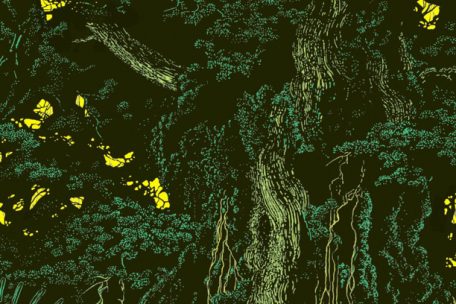
Über die Kunstfigur der Autorin Trapenard verweist die Ich-Erzählerin auch auf die kontroversen Rezeptionen literarischer Werke: „Trapenard habe ‚La pitié’ als ihren ‚letzten Text’ bezeichnet, mit dem sie ihre literarische Laufbahn beschließe, ja zwingend beschließen müsse, und während das Buch in der Hauptsache als ‚absolut dringliches Werk’, als ‚bestechende Geschichte einer Ernüchterung’ und als ‚wichtigstes Dokument unserer Zeit’ gelobt worden sei, hätten es andere als ‚pathetische Demutsgeste’, als ‚peinliche Befindlichkeitsliteratur’ kritisiert: Trapenards Geständnis, so habe es Peter Steinbrückl in der Süddeutschen Zeitung beschrieben, sei eine Alibiübung, die niemandem diene als der Autorin selbst.“ Mitunter rechtfertigt die Erzählerin ihr fiktives literarisches Schreibprojekt mit den Vorstellungen des Theatermachers. Es sei sein Credo gewesen, dass „immer alles mit reingehöre, dass es darum gehe, die Verstrickungen, Verbindungen, das Synchrone und scheinbar Zufällige zu sehen, weil sie alle, wie er gerne gesagt habe, nichts anderes seien als dies – Beziehung, Verhältnis, Zufall (…).“
Und so erzählt Elmiger in einem literarisch eigenwilligen Stil, konsequent die indirekte Rede einhaltend von ihrer Spurensuche im tropischen Regenwald, schlägt immer neue Seitenpfade ein und (er-)schafft neben potenziellen Szenarien („So könnte es gewesen sein“) auch eine ganz eigene Erzählweise, die einen hineinzieht in dunkle tropische Welten, beängstigt und ja, regelrecht berauscht. Den Roman mit dem diesjährigen Deutschen Buchpreis auszuzeichnen, ist eine plausible Entscheidung.

 De Maart
De Maart







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können