Wer nach Istanbul kommt, lernt schnell „Hüzün“ kennen. Damit ist eine tiefe Melancholie gemeint, ein fester Bestandteil der türkischen Kultur, eine kollektive Stimmung des Scheiterns und des Verlusts, das häufig mit der Metropole am Bosporus in Verbindung gebracht wird. Es sei „das Gefühl, mit dem sich im letzten Jahrhundert Istanbul und seine Bewohner auf intensive Weise infiziert haben“, schreibt der türkische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk in seinem Buch „Istanbul – Erinnerung an eine Stadt“.
Während Pamuk, 1952 zur Welt gekommen, in einer wohlhabenden Familie im Viertel Nişantaşi im Stadtteil Şişli aufwuchs, stammt der zwei Jahre später geborene Recep Tayyip Erdoğan aus bescheidenen Verhältnissen in dem weiter nördlich gelegenen, von Armut und von islamischer Frömmigkeit geprägten Viertel Kasimpaşa im Bezirk Beyoğlu, ebenfalls im europäischen Teil Istanbuls. Die meisten Frauen trugen zumindest Kopftücher, die Männer saßen mit Gebetsketten entweder vor oder in den Cafés. Erdoğans Vater war Seemann, und der Sohn musste seinen Beitrag zum Lebensunterhalt der Familie leisten, indem er auf der Straße Wasser, Sesamkringel und Süßigkeiten feilbot. Einmal sei er als „Taugenichts aus Kasimpaşa“ bezeichnet worden, heißt es. Doch das habe ihn nicht gestört.
Seine Herkunft hat Erdoğan nie verleugnet. Er habe sie sogar für seine Selbstinszenierung benutzt, schreibt seine Biografin Cigdem Akyol: „Einer aus dem Volk für das Volk. Als er später Bürgermeister von Istanbul war, kümmerte er sich persönlich um die Modernisierung des Viertels. Heute ist Erdoğans ehemalige Grundschule ein religiöses Gymnasium. Die Straßen sind gepflastert, es gibt mehrstöckige Häuser, Stromausfälle sind selten geworden – und die Müllabfuhr holt den Unrat ab.“ Schon im Alter von 19 Jahren schloss sich Erdoğan der damals neu gegründeten Nationalen Heilspartei (MSP) an, aus der 1983 die islamistische Refah Partisi (Wohlfahrtspartei) hervorging. Sein Ziehvater war der MSP-Gründer Necmettin Erbakan, 1996 bis 1997 türkischer Ministerpräsident. Er erkannte in Erdoğan den begabten Redner mit politischem Instinkt. Dieser lernte, „sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, politische Konkurrenten zu entmachten, Taktiken und Strategien auszuhandeln“, schreibt Akyol. Es waren Erdoğans politische Lehrjahre.
Seinen Durchbruch erlebte er mit der Wahl zum Oberbürgermeister von Istanbul im Jahr 1994. Die städtische Müllabfuhr wurde neu organisiert, Grünflächen errichtet, die Korruption bekämpft. Zugleich verschwanden leicht bekleidete Frauen von den Plakatwänden, ebenso wurde der Ausschank von Alkohol in den Betrieben der Stadt verboten. Erdoğan setzte auf eine scharfe islamistische Rhetorik, was in der laizistisch geprägten Republik dazu beitrug, dass er wegen Volksverhetzung verurteilt und die Wohlfahrtspartei verboten wurde. Er wurde für einige Monate inhaftiert. Die Richter untersagten ihm außerdem weitere politische Aktivitäten. Erdoğan rief mit den gemäßigten Kräften der Wohlfahrtspartei die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) ins Leben, die sich als „konservativ-demokratische“ Volkspartei bezeichnet und mit der er 2002 die Parlamentswahlen gewann.
Erdoğan hatte nicht nur mit der Gründung der AKP das Parteiensystem verändert, sondern auch neue Klassenverhältnisse geschaffen, indem er die historische Spaltung zwischen „weißen Türken“ und „schwarzen Türken“ aufweichte. Als Erstere wird die kemalistische Elite genannt, die das Land jahrzehntelang regierte, sich dem Säkularismus verpflichtet sah und seit der Gründung der Republik 1923 Militär, Justiz und Medien beherrschte. Dagegen galten die „schwarze Türken“ als arm, religiös, konservativ und wenig gebildet. Erdoğan galt als einer von ihnen. Während sich die bisher etablierten Parteien zerstritten, gewann seine AKP seit 2002 alle folgenden Parlamentswahlen – unter anderem mit dem Versprechen, die Wirtschaft voranzutreiben, die Menschenrechte zu wahren und die Türkei an die Europäische Union heranzuführen.
Abkehr von laizistischen Werten
Die AKP gewann den Machtkampf mit der laizistischen Militärführung. Trotz des Widerstands der Generäle wurde ihr Kandidat Abdullah Gül 2007 vom Parlament zum Staatspräsidenten gewählt. 2010 initiierte die Partei ein Referendum zur Verfassungsänderung. Sie profitierte nicht nur von Erdoğans Popularität, sondern auch von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung seit 2003, die vielen Türken mehr Wohlstand, den Ausbau sozialer Rechte sowie die Verbesserung des Gesundheitswesens und der städtischen Infrastruktur und der Verkehrsnetze brachte. Darüber hinaus wurde ein staatlicher Fernsehkanal in kurdischer Sprache gestartet. Selbst mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) wurden Verhandlungen aufgenommen – die allerdings zu keinem Ergebnis führten, wonach die Gewalt zwischen der türkischen Armee und den PKK-Milizen im Sommer 2015 erneut eskalierte.
Seit Erdoğans Machtantritt verabschiedete sich die Türkei mehr und mehr von den laizistischen Werten des auf den Republikgründer Kemal Atatürk zurückgehenden Kemalismus. Seine dargestellte Religiosität wurde sogar ein Garant seiner Popularität. Das Kopftuch, auch getragen von seiner Frau Emine sowie seinen Töchtern und Schwiegertöchtern, wurde selbst in der Politik Normalität. Seit 2013 dürfen Abgeordnete im Parlament offizielle ein Kopftuch tragen, immer mehr religiöse Schulen wurden eröffnet, allein in den Jahren 2005 bis 2015 entstanden 8.985 neue Moscheen.
Kritiker des Präsidenten warnten früh davor, dass Erdoğan nur vorgab, ein Reformer zu sein. 2023 jährt sich nicht nur die Gründung der Türkischen Republik durch Mustafa Kemal Atatürk zum hundertsten Mal und der Amtsantritt Erdoğans als Ministerpräsident vor 20 Jahren, sondern auch die Proteste im Gezi-Park, Ende Mai 2013. Der Gezi-Park wurde zum Symbol des Widerstands. Der Park wurde am 15. Juni 2013 gewaltsam geräumt. Der AKP gelang es, die Kommunalwahlen am 30. März 2014 zu gewinnen, und einige Monate später, am 30. März 2014, wurde Erdoğan mit absoluter Mehrheit zum Staatspräsidenten gewählt.
Gülen-Bewegung zur Terrororganisation erklärt
Unterstützt wurde er lange Zeit von dem seit 1999 in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen. Seine Bewegung „Hizmet“ (Dienst) nahm einen großen Einfluss auf die Bildungsarbeit. Die Allianz hielt, solange der gemeinsame Feind, die Kemalisten und säkularen Militärs, nicht geschlagen war. Doch Gülen kritisierte Erdoğan erstmals 2010, worauf sich das Verhältnis zunehmend verschlechterte. Zur Eskalation kam es durch die Ermittlungen in einem Korruptionsskandal, in dessen Verlauf die Polizei verdächtige Ministersöhne, Beamte und regierungsnahe Geschäftsleute festnahm. Die Regierung, Erdoğan war damals noch Ministerpräsident, warf Gülen vor, hinter den Ermittlungen zu stecken. Die Gülen-Bewegung wurde zur Terrororganisation erklärt, ihre führenden Köpfe, darunter Gülen selbst, auf die Liste der meistgesuchten Terroristen gesetzt. Auch für den gescheiterten Putschversuch 2016, der eine der größten Säuberungswellen in der Geschichte des Landes zur Folge hatte, machte die Regierung Gülen verantwortlich. Die Revolte sei „ein Segen Gottes“, so Erdoğan, damit „unsere Streitkräfte, die vollkommen rein sein müssen, gesäubert werden.“ Mehr als 100.000 Staatsbedienstete sollen entlassen worden sein.

Die AKP-Regierung ließ mit dem Referendum am 16. April 2017 das politische System der Türkei umwandeln und Erdoğans Machtposition weiter stärken: Es entstand ein Präsidialsystem, das 2018 mit den gleichzeitig stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen eingeführt wurde. Die AKP konnte bei den darauffolgenden Kommunalwahlen ihre Macht wieder ausbauen, allerdings verlor sie die Oberbürgermeisterposten in Istanbul und Ankara. Die Amtsträger Ekrem Immamoğlu und Mansur Yavaş gehören der Republikanischen Volkspartei (CHP) an. Die säkulare Mitte-links-Partei versteht sich als Garant der „unabhängigen, republikanischen und laizistischen Türkei“ und steht nach eigenem Bekunden für Menschenrechte, Gewaltenteilung und die Rechtsstaatlichkeit. Außerdem verspricht sie demokratische und soziale Reformen sowie eine nachhaltige Wirtschaft. Ihr Spitzenkandidat Kemal Kiliçdaroğlu vor den morgen stattfindenden Wahlen liegt laut Umfragen knapp vor Amtsinhaber Erdoğan. Die CHP, 1919 gegründet, war zuletzt 1995 in einer Koalitionsregierung. Ihre Stammwählerschaft besteht vor allem aus städtischen, säkularen und gebildeten Bevölkerungsschichten sowie der Minderheit der Aleviten.

Unter ihrem Parteichef Bülent Ecevit positionierte sich die kemalistische CHP als „demokratische Linke“. Sie positionierte sich 2017 deutlich gegen die Verfassungsänderung. Damals startete Kiliçdaroğlu von Ankara aus seinen „Marsch für Gerechtigkeit“, der er mit einer Massenkundgebung in Istanbul abschloss. Bei den Parlamentswahlen trat die CHP in einem Bündnis mit der „Guten Partei“ (IP) und der „Partei der Glückseligkeit“ (SP) an. Die Allianz erhielt 33,9 Prozent der gültigen Stimmen. Bei den Kommunalwahlen konnte sie sich aber immerhin erstmals seit 1978 wieder der 30-Prozent-Marke nähern. Morgen tritt sie in der „Allianz der Nation“ zusammen mit fünf weiteren Oppositionsparteien an, während Erdoğan zusammen mit zwei islamistischen Splitterparteien, der „Neuen Wohlfahrtspartei“ (YRP) und die „Partei der freien Sache“, die etwa die Rücknahme eines Gesetzes fordert, das Frauen vor häuslicher Gewalt schützt, eine „Volksallianz“ bildet.
Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnet sich ab
Obwohl Kiliçdaroğlu in den vergangenen Wochen die Meinungsumfragen anführte, wird mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Erdoğan gerechnet. Der Herausforderer spricht offen von einer „ausgebluteten Demokratie“. Im Gegenzug versucht Erdoğan, aus jedem kleinen Fehler seines Kontrahenten Kapital zu schlagen: Als Kiliçdaroğlu beim Fastenbrechen vor gut sechs Wochen mit seinen Schuhen auf einen Gebetsteppich trat, riefen die der Regierung nahestehenden Zeitungen und Fernsehsender „Skandal“. Und Erdoğan polterte: „Wer die Gebetsrichtung und die Kaaba nicht kennt, der hat auch keine Augen für den Gebetsteppich.“ Dem fehle es an Kenntnissen über den Islam. Bislang war die Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe entscheidend für die Abgabe der Stimme: Säkulare und Aleviten machten ihr Kreuz bei der CHP, fromme Muslime bei der AKP und säkulare Kurden bei der „Demokratischen Partei der Völker“ (HDP). Dann gibt es noch die rechtsextreme „Partei der nationalistischen Bewegung“ (MHP). Weitere Parteien sind hinzugekommen, die „Zukunftspartei“ (GP) etwa oder die „Demokratie- und Fortschrittspartei“ (DEVA) für fromme Muslime, beide angeführt von früheren Weggefährten Erdoğans. Hinzu kommt die „Glückseligkeitspartei“ (SP). Nicht zu vergessen sind die „Grüne Linkspartei“ und die „Türkische Arbeiterpartei“ (TIP), aber auch das „Bündnis Arbeit und Freiheit“. Das Parteienspektrum ist jedenfalls weiter zersplittert. Die Sperrklausel, die bei zehn Prozent lag, um ins Parlament einzuziehen, wurde auf sieben Prozent herabgesetzt. Dennoch ist den meisten Parteien der Einzug nur über die Listen von Wahlbündnissen möglich.
Mit entscheidend für den Urnengang, zu dem etwa 60 Millionen Türkinnen und Türken aufgerufen sind, ist die Frage, wem am ehesten zugetraut wird, die Wirtschaftskrise zu beenden und die dramatische Inflation in den Griff zu bekommen sowie den Wiederaufbau nach dem Erdbeben zu bewerkstelligen. Weitere Herausforderungen: fehlende Gewaltenteilung und Pressefreiheit, die Flüchtlingskrise und die Korruption. Ein Zünglein an der Waage könnten nicht zuletzt viele im Ausland lebende Türken spielen: Davon etwa die 1,5 Millionen in Deutschland, die bei den vergangenen Wahlen mehrheitlich Erdoğan ihre Stimme gaben. Erstmals scheint seine Abwahl realistisch.
Aber was macht der Amtsinhaber, wenn er verliert? Versucht er Neuwahlen zu erzwingen? Oder seine Gegner vor Gericht bringen und in einem politischen Verfahren verurteilen. Istanbuls Bürgermeister Imamoğlu bekam das schon zu spüren. Zuletzt warf Erdoğan mit Wahlgeschenken um sich, etwa mit der Erhöhung des Mindestlohns im öffentlichen Dienst um 45 Prozent. Von dem Rückzug des Kandidaten Muharrem Ince, der damit auf eine Kampagne gegen ihn wegen vermeintlicher Sex-Fotos reagierte, könnte hingegen Kiliçdaroğlu profitieren. Denn Ince ist ein erklärter Gegner von Erdoğan. Seine Stimmen könnten dem Herausforderer nutzen.

 De Maart
De Maart

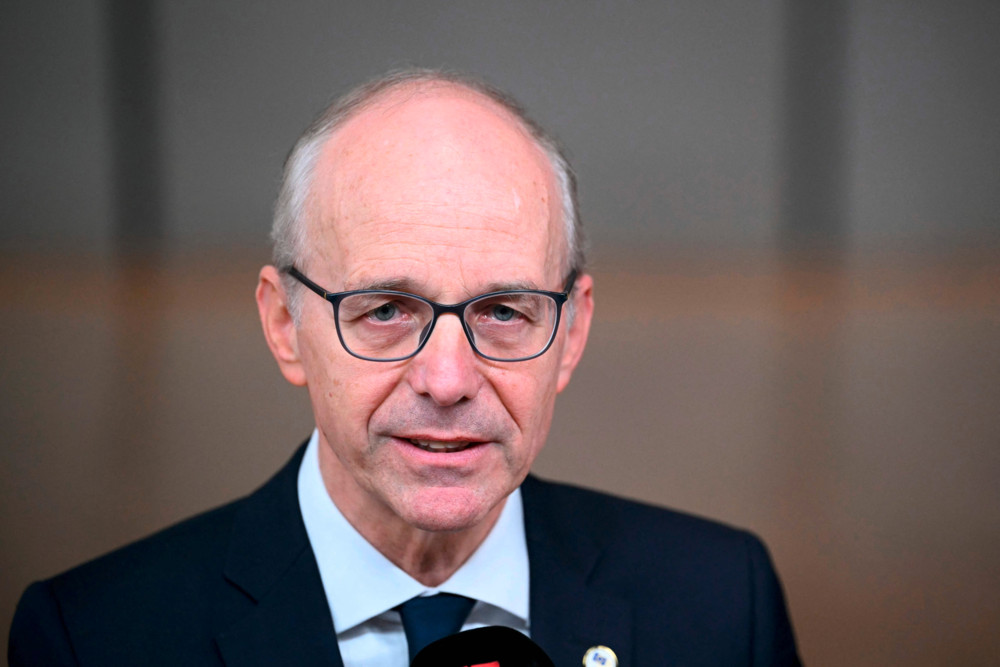

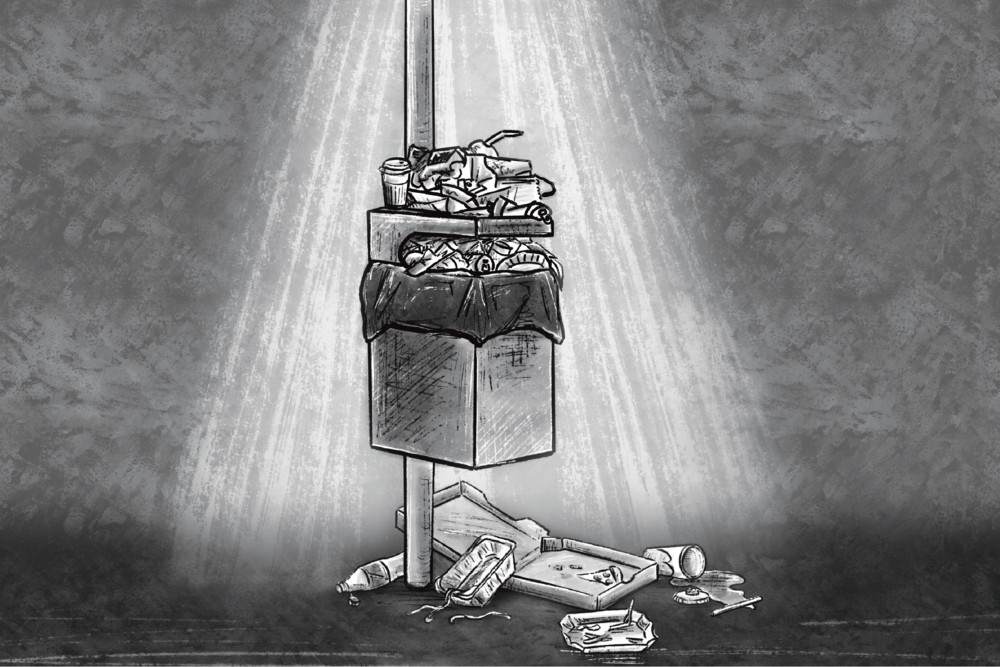



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können