Die junge Serbin Kristina Djukic war beliebt, erfolgreich – und gutaussehend. 700.000 Abonnenten zählte ihr YouTube-Kanal „K1KA“. Selbstbewusst und stets fröhlich wirkte die 21-jährige Belgraderin mit dem blonden Haar und den ebenmäßigen Gesichtszügen, die bereits mit 14 Jahren als „Gamerin“ in Serbiens Webwelten für Furore sorgte. Aber trotzdem ereilte die populäre Influencerin ein unerwartet früher Tod.
„Kristina, wo bist Du jetzt?“, lautete der Text des Schlagers, der bei ihrer Beerdigung in dieser Woche auf dem Belgrader Lesce-Friedhof ertönte. In einem weißen Sarg wurde „Kika“ auf dem verschneiten Gottesacker zu Grabe getragen. Über „Bosheit und Hass“, den ihre Tochter zu Lebzeiten erfahren hatte, klagte am Grab mit tränenerstickter Stimme ihre von Weinkrämpfen geschüttelte Mutter. Die YouTuberin habe sich getötet, weil sie „im Internet misshandelt“ worden sei, so die Zeitung Blic. Ihr Tod habe eine „Lawine von Fragen“ ausgelöst: „Die digitale Gewalt wird zum Trend unter den Jugendlichen.“
Überschwemmt von Hassbotschaften
Schon vor drei Jahren hatte die Web-Ikone in einem Interview berichtet, dass sie sich wegen der zahlreichen Drohungen kaum mehr aus dem Haus traue. Von vielen Teenagern wurde sie zwar bewundert. Doch gleichzeitig wurde ihr Instagram-Profil nach eigener Aussage von Hassbotschaften überschwemmt. Manche forderten sie selbst zum Selbstmord auf. Zuschriften wie „Du bist flach wie ein Brett, lass Dich aufpolstern“, „Du hast keine Oberlippe, wie willst Du einen Jungen küssen“ oder „Du bist ein Silikon-Baby so wie alle“ hätten sie „verletzt“, bekannte die sonst so aufgeräumte „Kika“ noch zu Lebzeiten.
„Cyber-Bullying“ nennt sich das Phänomen des Web-Mobbings meist durch Gleichaltrige, denen sich Jugendliche nicht nur in den Balkanstaaten vermehrt ausgesetzt sehen. Jede Hassbotschaft, auch im Web sei für die Opfer eine „Tortur“, so der Psychologe Radomir Colakovic. Gerade Jugendliche und junge Frauen, deren Persönlichkeitsbildung „noch nicht abgeschlossen“ sei, reagierten bei entwürdigenden Äußerungen zu ihrem Aussehen sehr empfindlich: „Die Erfahrung zeigt, dass die Opfer an das zu glauben beginnen, was die Täter suggerieren – dass sie wirklich dumm, hässlich oder zu dick seien.“
Die Erfahrung zeigt, dass die Opfer an das zu glauben beginnen, was die Täter suggerieren – dass sie wirklich dumm, hässlich oder zu dick seien
Junge Menschen verfügten noch nicht über „ausgereifte Verteidigungstechniken“ und eine „Strategie zur Überwindung des Stress“, erklärt im Blic Ivana Stesevic Karlicic, Direktorin der Psychiatrischen Klinik in Belgrad, warum diese besonders oft zu Opfern digitaler Gewalt werden: „Gleichaltrige sind in diesem Lebensabschnitt eine wichtige Stütze bei Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Aber sie können auch zum Ursprung von deren Destabilisierung werden.“
Tragische „Bullycide“-Fälle, bei denen die Opfer von Cybergewalt ihrem Leben ein Ende setzen, sind in den Balkanstaaten zwar eher selten zu beklagen. Doch die während der Corona-Pandemie noch verschärfte Verrohung des Umgangstons in den sozialen Webwelten macht zunehmend auch Erwachsenen zu schaffen.
Im bosnischen Banja Luka sah sich ein junger, homosexueller Stadtrat von der oppositionellen PDP-Partei zu Monatsbeginn zum Rücktritt genötigt, nachdem private Sex-Aufnahmen vermutlich von der politischen Konkurrenz im Netz lanciert worden waren. Sie sei wegen ihres farbigen US-Ehemanns zum Opfer von Cyber-Gewalt geworden, berichtete unlängst die serbische Popsängerin Tijana Bogicevic: „Bei uns ist alles ein Tabu-Thema, egal ob man homosexuell, schwarz ist oder zum Psychotherapeuten geht. Wir sind einfach scheinheilig.“
„Furchtbar“ seien die anonymen Kommentare über ihren Mann auf YouTube, Instagram und Webportalen gewesen, so die Sängerin: „Ich habe dann entschieden, nichts mehr ins Netz zu stellen. Die Hassbotschaften und Beleidigungen – ich brauche das nicht. Mein Leben findet nicht in den sozialen Netzwerken statt, sondern ist privat.“

 De Maart
De Maart

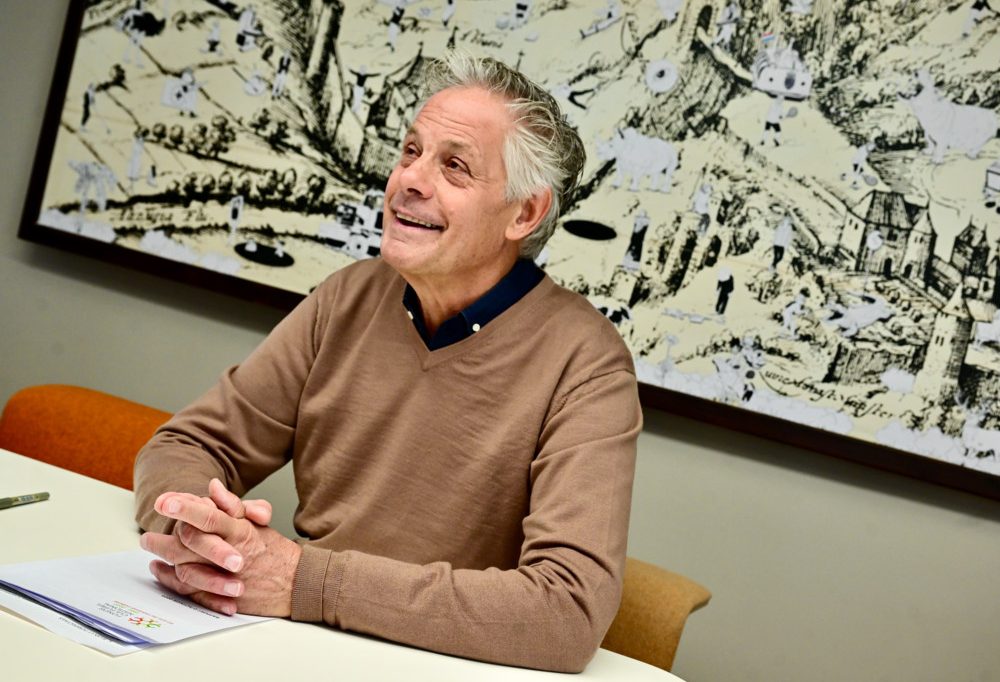





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können