Tageblatt: Welche Geschichte steckt hinter der EU-Richtlinie für angemessene Mindestlöhne?
Torsten Müller: Wenn ich die Bedeutung der Richtlinie erkläre und warum sie so wichtig ist, dann gehe ich immer bis zur Finanzkrise zurück. Damals war die Politik, die von den europäischen Institutionen und auch der Kommission vertreten wurde, genau das Gegenteil. Damals im Rahmen der Austeritätspolitik ging es um das Einfrieren von Mindestlöhnen und die Dezentralisierung von Tarifsystemen, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Das hatte aber insbesondere in den südlichen Ländern, die ganz besonders betroffen waren von den Austeritätsmaßnahmen, dazu geführt, dass das ganze europäische Integrationsprojekt an Legitimität verloren hat. Die Kommission hat da gemerkt, dass sie ein bisschen zu weit gegangen ist mit diesen ganzen Maßnahmen, die auch ihren Zweck nicht erfüllt haben im Hinblick auf wirtschaftliche Erholung. Es hat dann angefangen mit der Säule sozialer Rechte, die Von-der-Leyen-Kommission hat in ihren ersten 100 Tagen die Mindestlohn-Richtlinie angekündigt.
Als Versuch, gegenzusteuern?
Ich denke, das ist auch so ein bisschen ein Ergebnis des Lernprozesses aufseiten der politischen Akteure. Dass sie gesagt haben: Wir müssen Europa auch positiv besetzen für die Beschäftigten und für die Bürger und eben nicht immer nur negativ wie in der Krise. Da war es wirklich so, dass die Leute irgendwann gedacht haben, was von Europa kommt, hat negative Auswirkungen für mich. Auch in der Wahrnehmung von Löhnen und Tarifpolitik hat ein Umdenkprozess stattgefunden. Angemessene Mindestlöhne und starke Tarifbindung werden nicht mehr als Problem gesehen, sondern als Teil der Lösung. Dass eben ein angemessener Lohn Nachfrage stärkt und somit auch Wachstum generiert. Ein Paradigmenwechsel. Die Von-der-Leyen-Kommission hat das gepusht und mit Nicolas Schmit als EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte war auch die richtige Person an der richtigen Stelle, weil das ist ja wirklich ein Herzensthema für ihn ist. Es gab eine günstige politische Gesamtkonstellation. Auch im Europäischen Parlament hatte man damals andere Mehrheiten. Im Ministerrat hatten wir noch nicht so viele Mitte-rechts- bzw. konservative Regierungen, die solchen Themen ja auch eher etwas skeptischer gegenüberstehen. Es hat sich damals ein Gelegenheitsfenster geöffnet. Und ich muss offen sagen: Ich glaube, unter den jetzigen politischen Gegebenheiten, im Parlament, im Rat oder eben auch auf nationaler Ebene, wäre so eine Richtlinie heute nicht mehr möglich.
Zur Person
Dr. Torsten Müller ist Senior Researcher beim Europäischen Gewerkschaftsinstitut (ETUI) in Brüssel für die Bereiche Tarifverhandlungen, (Mindest-)Löhne und Gewerkschaften in Europa.
EU-Richtlinien brauchen nationale gesetzliche Umsetzungen, um Wirkung zu zeigen. Wie läuft es bei den verschiedenen Mitgliedsstaaten?
Es gibt acht Länder, die noch nicht umgesetzt haben. Luxemburg gehört dazu. Andere Länder haben sehr minimalistisch umgesetzt, da wäre Deutschland ein Beispiel. Die haben eine rechtliche Analyse gemacht mit dem Ergebnis, das existierende Mindestlohngesetz und das Tarifvertragsgesetz seien kompatibel mit der Richtlinie, da brauche man nichts zu ändern. Und dann hat Deutschland eben nichts gemacht. Andere Länder, insbesondere in Osteuropa, haben Mindestlöhne erhöht. Es gibt in der Richtlinie diese Referenzwerte von 60 Prozent des Medianeinkommens und 50 Prozent des Durchschnittseinkommens. Bulgarien zum Beispiel hat 50 Prozent des Durchschnittslohns als Referenzwert für den Mindestlohn im Gesetz festgeschrieben. Die Slowakei ging sogar noch weiter, 60 Prozent des Durchschnittslohns. Die haben die Richtlinie genutzt, um die Situation zu verbessern, auch im tarifpolitischen Bereich. Die Slowakei hat bei der Umsetzung darauf geachtet, dass man insbesondere sektorale Tarifvereinbarungen fördert. Auch Tschechien. Das ist die eigentliche Zielsetzung. 80 Prozent Abdeckung mit Kollektivverträgen erreicht man ja nur über sektorale Tarifvereinbarungen letzten Endes. Also insgesamt ein sehr gemischtes Bild bei der Umsetzung. Aber ich denke vorwiegend in einigen osteuropäischen Staaten hat sie doch wirklich zu konkreten Verbesserungen geführt.
Ohne gute Umsetzung bleibt die Richtlinie wirkungslos.
Die nationale Umsetzung ist elementar, weil die Richtlinie nicht so viele verpflichtende Vorgaben macht. Sie bewegt sich auf dem Niveau von starken Empfehlungen für die nationalen Regierungen. Es hängt dann vom politischen Willen auf nationaler Ebene ab. Und wie man jetzt in Luxemburg sieht, ist er nicht überall so ausgeprägt, dass man das besonders ambitioniert umsetzt.
Hierzulande hat man sich entschieden, die gesetzliche Umsetzung der Richtlinie aufzuteilen in zwei Gesetze – einmal zu den Kollektivverträgen, einmal zum Mindestlohn. Ist das sinnvoll?
Die Richtlinie umfasst in der Tat zwei größere Bereiche: gesetzliche Mindestlöhne und Tarifpolitik. In Ländern, in denen der Mindestlohn in einem eigenen Gesetz geregelt ist und die Bedingungen der Tarifpolitik in einem anderen Gesetz, so wie in Deutschland, da ist es logisch, dass man dann eben diese beiden Gesetze ändert. Es muss aber trotzdem immer als Gesamtpaket betrachtet werden, so ist die Richtlinie konzipiert. Sie sagt: Über Tarifverträge lassen sich angemessene Mindestlöhne sehr gut erreichen. Wenn das nicht funktioniert, brauchen wir aber einen gesetzlichen Mindestlohn, der das garantiert. Insofern hängen die beiden Sachen zusammen. Ich halte es für keine gute Idee, dass man das aufspaltet.
Sie haben die Referenzwerte aus der Richtlinie für einen angemessenen Mindestlohn schon genannt. Die sind nun jedoch nicht verpflichtend, ein Land kann auch sein eigenes Modell zur Berechnung erstellen?
Die EU hat bestimmte Kompetenzbeschränkungen in Lohnfragen, sie kann keine Lohnhöhe vorschreiben. Sie kann also nicht den Mitgliedsstaaten sagen, euer Mindestlohn muss diese Höhe haben, er muss bei 50 Prozent des Durchschnittslohns oder 60 Prozent des Medianlohns liegen. Insofern hat die Richtlinie den Weg gewählt, zu sagen: Wenn ihr aber die Angemessenheit von euren Mindestlöhnen bewerten wollt, dann nehmt doch diese Kriterien, sie haben sich international als sehr günstig erwiesen für die Analyse und Bewertung der Angemessenheit. Es ist eine starke Empfehlung, aber natürlich nicht verpflichtend, das sieht man auch in der Umsetzung. Länder haben unterschiedliche Referenzwerte ins Gesetz geschrieben. Bulgarien hat die 50 Prozent genommen. Die Slowakei 60 Prozent des Durchschnittslohns. In Lettland hat man nur 46 Prozent genommen. Da konnten sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaften nicht einigen und die Regierung hat die Mitte zwischen den Forderungen gewählt.
Man sollte sich aber schon an den Werten orientieren?
Im Geiste der Richtlinie wäre es natürlich schon, wenn man diese Referenzwerte nimmt. Selbst Deutschland hat sich für seine Mindestlohnkommission die 60 Prozent des Medianlohns in die Geschäftsordnung geschrieben. D.h. es ist jetzt eines der Kriterien, die die Kommission in Zukunft bei ihren Empfehlungen zur Anpassung des Mindestlohns berücksichtigen muss.
In Luxemburg, so scheint es, ziert sich der Arbeitsminister sehr, eine konkrete Verpflichtung eingehen zu müssen in Sachen Mindestlohn. Erst wurde das Gesetz vom Staatsrat kassiert, weil gar kein konkreter Referenzwert genannt wurde. Jüngst hat er der Arbeitskommission dann eine Rechnung vorgelegt, die zeigen soll, dass Luxemburg die Anforderungen der Richtlinie schon längst erfüllt.
Die Bemühungen, sich das über solche Spielchen schönzurechnen, hat man bei einigen Regierungen gesehen, die der Mindestlohn-Richtlinie kritisch gegenüberstehen und keine ambitionierte Umsetzung wollen. Da ändert man dann plötzlich Kriterien: Ach guck, wir brauchen da ja gar nichts machen, wir erfüllen das schon. Das ist natürlich nicht im Sinne der Richtlinie, aber rein rechtlich kann man gegen so etwas wenig machen, weil es auch Sache der Nationalstaaten ist, die Definition des Medianlohns festzulegen. Auch das kann Europa nicht vorschreiben. Aber in Nachbarländern Luxemburgs, wie zum Beispiel Belgien und Deutschland, sind beim Medianlohn alle Sonderzahlungen mit drin und auch die Bezahlung der Bediensteten des öffentlichen Dienstes. Es gibt hier also schon starke Argumente für die Gewerkschaften und alle anderen Akteure, die sagen: So geht es nicht. Aus der Richtlinie selbst erwachsen keine rechtlichen Handhaben, dass man dagegen vorgehen könnte. Aber es ist natürlich wirklich ein Armutszeugnis. Und zeigt, dass die Regierung in Luxemburg momentan kein großes Interesse an einer ambitionierten Umsetzung hat.
Ist Luxemburg Teil eines allgemeinen europäischen Trends, eines Rückschritts in arbeitsrechtlicher Hinsicht?
In den vergangenen zwei, drei Jahren sind viele nationale Regierungen wieder skeptischer geworden. Es gibt eine Klage der dänischen Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof, dort wird verhandelt, ob die Richtlinie gegen die EU-Verträge verstößt. Es gibt einige Regierungen, Polen und Niederlande zum Beispiel, die abwarten mit der Umsetzung der Richtlinie, weil diese ja vielleicht annulliert werden könnte. Das ist so ein Spiel auf Zeit. Luxemburg geht noch einen Schritt weiter, weil tatsächlich eine Verschlechterung der bestehenden Bedingungen im Rahmen der Umsetzung angestrebt wird. Aber im Prinzip ist Luxemburg Teil eines größeren Trends. Als die Richtlinie 2022 verabschiedet wurde, haben 24 Regierungen dafür gestimmt, um mit angemessenen Mindestlöhnen und starker Tarifbindung Erwerbsarmut und Ungleichheit zu reduzieren. Das war ein politisches Bekenntnis. Nun, bei der Umsetzung, will man davon nichts mehr wissen. Das ist natürlich ein Rückschritt im Vergleich zu 2022.
Diese Hin und Her wirft aus der Sicht der europäischen Bürgerinnen und Bürger auch kein gutes Licht auf die Institutionen Europas. Eine vielversprechende Richtlinie, aber dann keine praktischen Folgen.
Ja, das ist ja immer das Problem, woran Europa krankt und was Europa auch vorgeworfen wird: Das ist nur so eine Redebude in Brüssel, die machen ja nichts. Das Problem ist, die machen schon einiges, aber damit diese Maßnahmen, die auf europäischer Ebene ergriffen werden, auch wirklich einen Effekt haben, braucht man die nationale Umsetzung. Und da sind es eben häufig die nationalen Regierungen, die bremsen. Das wird natürlich so nicht in der nationalen Öffentlichkeit kommuniziert. Da ist Brüssel der Sündenbock, wenn irgendwas schiefläuft. Wenn etwas gut läuft, dann schreibt man sich das selbst auf die Fahnen. Die Leute nehmen das oft gar nicht wahr, dass Europa da etwas Progressives macht, was für die Bürger und die Beschäftigten positive Auswirkungen hat. Da müsste man an der Kommunikation arbeiten.

 De Maart
De Maart

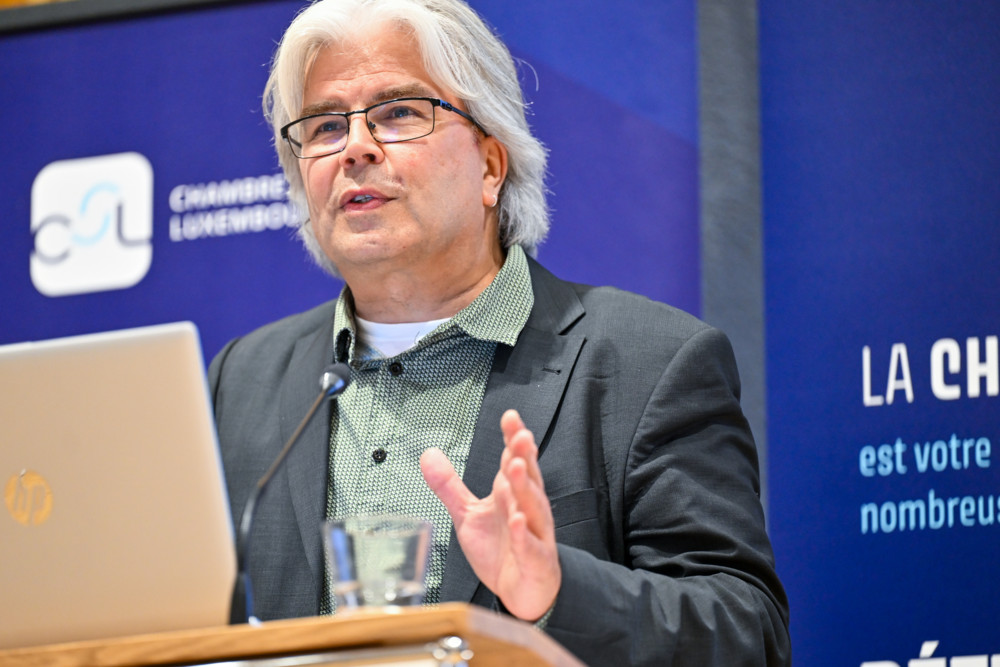







Von dieser Frieden Mischo Regierung kann man sich doch nicht erwarten dass die was mit dieser Richtlinie etwas anfangen wird, es sei den Mogelei à la Mischo...
Danke für diesen echt guten Artikel, die die derzeitige Anspannung auf der Linie Gewerkschaften-Regierung erläutert. Super Journalismus!
Leider konnten die Gewerkschaften mich alleine mit den Parolen nicht überzeugen. Jetzt kann man das Gesamtbild und Hintergrund verstehen und ich eine Meinung machen, ob die große Demo am 28.06 und der verbale Angriff auf die Regierung am 01.05 so ihre Berechtigungen haben (m..E. auf jeden Fall, ist ja doch eine Frechheit seitens der Regierung!).
Leider wurde "eine Verschlechterung der bestehenden Bedingungen im Rahmen der Umsetzung angestrebt wird." nicht genauer erklärt.
Ob Brüssel eine "Redebude" ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Verbessern sollte Brüssel aber die Kommunikation im Bereich "(schmerzhafte) Aufarbeitung der Nazigeschichte". Nur so kann meiner Meinung nach das eingedämmt werden, was eingedämmt werden muß. Und in dem Gebiet, in dem Herr MÜLLER einen "Armutszustand" feststellt, fällt es sicherlich auch leichter, eine bevölkerungsfreundlichere Politik zu realisieren. Tabulose Aufklärung ist notwendend notwendig. Dabei sollte Luxemburg mit gutem Beispiel vorangehen. "Il y a du pain sur la planche". MfG, Robert Hottua
"braucht man die nationale Umsetzung." Tja, unsere Obrigkeit hält nix davon.