Gerade erst Ende Februar windet sich Landwirtschaftsministerin Martine Hansen (CSV) wieder um eine klare Antwort herum. Individuelle Wünsche nach Kennzeichnung der Tiere könnten – unabhängig von der Motivation – nicht in Betracht gezogen werden. Das antwortet sie Ende Februar auf die parlamentarische Anfrage der „Déi gréng“-Abgeordneten Joëlle Welfring nach kleineren Ohrmarken für Zwergrassen.
Die Ohrmarken sind der „Personalausweis“ der Tiere, mit dem sie jederzeit rückverfolgbar sind. Das wiederum schreibt eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2004 vor. Die Einführung kleinerer Ohrmarken sei eine Abweichung. Das verhindere den Anspruch, dass die Ohrmarken für eine Tierart „die gleichen Charakteristika und das gleiche Aussehen haben, um die Verfolgbarkeit der Tiere zu gewährleisten“, heißt es in der Antwort weiter.
Deswegen sei es von größter Bedeutung, dass die Ohrmarken von den Informationssystemen der zuständigen Behörden und der Ohrmarkenlieferanten leicht verarbeitet werden können. Bei den kleineren geht das offensichtlich nicht, ist die Schlussfolgerung. Also: Nein. Halter und Züchter von kleinen Schafsrassen – Ouessantschafe werden beispielsweise nur 46 bis 49 Zentimeter Schulterhöhe groß – beklagen die Verletzungsgefahr mit den großen Ohrmarken.
Zwergrassen reißen sich die Ohren auf
Schafe sind Fluchttiere. Wenn sie sich erschrecken, rennen sie weg. „Da kommt ein Mensch in Stiefeln nicht hinterher”, sagt Kiko Steinmetzer (33), der seine „Ile de France”-Mastschafe ganzjährig auf Weiden hält. Der ehemalige Lehrer baut sich gerade in Schrassig eine Herde auf. Bislang hält er 56 Tiere inklusive Böcken und Lämmern. 250 sollen es mal werden, er will davon leben. „Ich wäre sogar bereit gewesen, die kleineren Ohrenschlaufenmarken selbst zu bezahlen“, sagt er.
Hecken, Zäune, andere Hindernisse: Es gibt viele Gelegenheiten für Tiere in Weidehaltung, sich die Ohren wegen der bislang zu großen Marken aufzureißen. Sie sind dann weder auf Shows noch auf dem Markt vorzeigbar, sprich: nicht kür- oder verkaufsfähig. Steinmetzer hat – wie die Hobbyzüchterin Karin Waringo – bei der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelverwaltungsbehörde (ALVA) nach kleineren Ohrmarken gefragt. Die ALVA ist die zentrale Stelle, die sie vergibt. Beide haben Böcke aus dem umliegenden Ausland gekauft und wissen: dort gibt es kleinere.

„Verschiedene Ohrmarken für ein und dieselbe Tierart“ seien eine „nicht zu rechtfertigende Ausgabe für den Staatshaushalt“, antwortet ihm die Verwaltung. Der private E-Mail-Verkehr liegt der Redaktion vor. Andere Züchter werden von der gleichen Stelle darauf verwiesen, dass innerhalb der Behörde gerade die Informatiksysteme zur Verfolgung der Tiere, der Sinn der Ohrmarken, umgestellt werden. Erst dann erlaube es die Technik, auf andere Ohrmarkenformate umzustellen.
Das Problem ist bekannt
Pikant an der Sache ist, dass die letzte parlamentarische Anfrage zu dem Thema schon die vierte und das Problem bekannt ist. Martine Hansen (CSV), heute Landwirtschaftsministerin, hat noch als Abgeordnete 2022 selbst eine parlamentarische Anfrage zu diesem Thema gestellt. Ihr Vorgänger im Amt, Claude Haagen (LSAP), wertet den Wunsch nach kleineren Ohrmarken nicht nur als „ästhetisches“ Problem ab, er winkt generell ab. „Die aktuell genutzte Größe werde den physiologischen Bedürfnissen aller Schaf- und Ziegenrassen gerecht“, wiederholt nicht nur er, sondern das Ministerium zuletzt 2025 wieder.
Hansen ist nach Romain Schneider und Claude Haagen die Dritte im Amt, die mit dem Problem konfrontiert ist. Offizielle Berufsverbände sehen keinen Handlungsbedarf, wissen aber von der Thematik über Facebook-Gruppen. „Ich verstehe das Problem“, sagt Lucien Koch (72). Er ist seit 35 Jahren Präsident des Luxemburger Schaf- und Ziegenschutzverbandes und seit fünf Jahren Präsident des Dachverbandes der Züchter, Halter und Schäfer.
Schaffleisch ist Nischenprodukt

Insgesamt gibt es drei Verbände mit geschätzt rund 350 Mitgliedern. Sie pflegen sowohl untereinander als auch neuerdings mit dem Ministerium einen regelmäßigen Austausch. Seine rund 110 Mitglieder des Verbandes haben keine Probleme mit den Ohrmarken, weswegen es für ihn keine Notwendigkeit gibt, kleinere Exemplare bei einem der Treffen am richtigen, menschlichen Ohr zu platzieren. „Wir werden auf offizieller Ebene als der Ansprechpartner gesehen“, sagt er auf Anfrage des Tageblatt. Den Betroffenen hilft das nicht.
Schaffleisch aus Weidehaltung ist beliebt und gerade dabei gibt es das Problem, dass die Tiere in den Maschen der Zäune wegen den gängigen Ohrmarken hängen bleiben. „Wir wollen den Ansprüchen der Konsumenten gerecht werden“, sagt Schafzüchter Steinmetzer. Hinzu kommt: Laut „sou-schmaacht-letzebuerg.lu“ gibt es im Land etwa 9.800 Schafe und 4.500 Ziegen, doch „spielen diese beiden Tierarten in der lokalen Fleischproduktion nur eine untergeordnete Rolle“, heißt es auf der Webseite. Die kleineren Ohrmarken sind bislang also (noch) ein Problem von Einzelkämpfern, die in einer Nische arbeiten.

 De Maart
De Maart






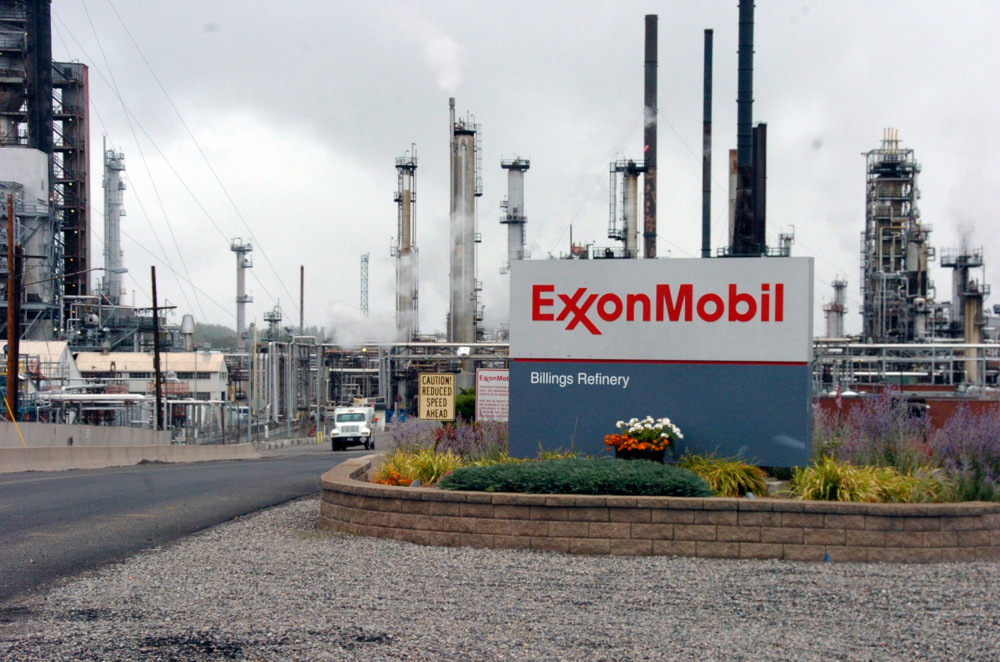


Komm mer lee'en d'Viirschreften mol rem ob d'Seit an schalten den gesonden Menschenverstand mol rem an !
Och Mme Minister !!
Ganz ohne Ohrmarken und Chip, genau wie unsere Minister und Abgeordnete.
Wie wär es denn, sowie bei Hunden, mit einem Chip?
Ist Schilda doch ein Teil von Lëtzeburg?
Die Haltung der Verbände ist mir vollkommen unverständlich und zeugt wieder einmal vom konservativen Geist, der hiezulande, in allem, was nicht unmittelbar mit Wirtschaft zu tun hat, herrrscht. Was spricht eigentlich gegen kleine Ohrmarken? Zunächst einmal, wie auch aus dem Artikel hervorgeht, landen die wenigsten Schafe tatsächlich auf dem Teller, und manschinenlesbar sind die kleinen Ohrmarken auch. Bezogen auf IT haben wir insgesamt eine Tendenz zur Verkleinerung: Wer würde, z.B., heute noch mit einem der ersten Handys rumlaufen, die bis zu fünfmal schwerer und grösser waren? Doch wenn's um sog. Nutztiere geht, ist das Tierwohl egal!
"Sie sind dann weder auf Shows noch auf dem Markt vorzeigbar, sprich: nicht kür- oder verkaufsfähig"
So so, und ich dachte, die Fürsorge wären wegen der Schmerzen...