Nachforschungen des Historikers zufolge trug die Gegend zuvor den Namen „op Dauwelter“, welcher auf eine Viehkrankheit, die sich durch unreines Wasser und Pflanzen verbreitete, zurückzuführen sei. Die Hänge von Belair waren von vielen kleine Quellen durchzogen. 1777 führte ein Feldweg zu den Bauernanwesen Daubenfelder Hof und Jungblutshof. Nach der Schleifung der Festung ab 1867 war der Wandel der landwirtschaftlich genutzten Region eingeläutet. Zwischen der Avenue du dix septembre und der Avenue Gaston Diderich ließen sich einige kleine Industrieunternehmen nieder.
Moderner Sakralbau
Der Hotelier Jean-Pierre Brasseur erfuhr 1880 auf Umwegen vom Vorhaben, an der place de l’Etoile einen Bahnhof zu errichten. Der Geschäftsmann witterte eine gute Affäre und erstand daraufhin mehrere Hektar Land, die er zur Anlage eines zukünftigen Wohnviertels nutzen wollte. Nahe der place de l’Etoile stellte er dem Fußballverein Spora ein Trainingsfeld zur Verfügung. An der Anhöhe zur Avenue Gaston Diderich bestand ein kleiner Weiher, der „Brasseurs-Weiher“. In frostigen Wintern fuhren die Leute Schlittschuh auf dem Weiher. Ein Teil des Eises verkaufte er an Brauereien, Molkereien und Gastgewerbe.
Doch nun zurück zur Avenue Gaston Diderich. Anhand von 15 Stationen stellte der Historiker die Entwicklung des Stadtviertels vor, beginnend bei der Christ-König-Kapelle der Jesuiten. Der sakrale Bau, einer der ersten modernen Bauwerke, reicht ins Jahr 1931 zurück, als die Jesuitenbrüder sich hier niederließen. Errichtet wurde das schlichte und unauffällige Gebäude vom Architekten Hubert Schumacher, der gegenüber des Ordens wohnte.
Unter seiner Federführung entstanden mehrere Wohnhäuser, deren Erkennungsmerkmal abgerundete Erker sind. Schumacher ist heute noch bekannt als Architekt der Villa Kutter, für die Vergrößerung der Kathedrale, den Wiederaufbau der Basilika in Echternach (in Zusammenarbeit mit Architekt Michel Heintz), den Bau des Staatsrats (in Zusammenarbeit mit Constant Gillardin) und der heutigen „Maison de l’orientation“ in der rue Notre-Dame.

Marketing für Belair
Der Bauunternehmer Nicolas Leclerc erstand das Grundstück an der Ecke Avenue Gaston Diderich/Avenue des Archiducs und baute hier eine prächtige Doppelvilla. Aus wirtschaftlichen Gründen heraus habe er den Namen „Belair“, nach dem Vorbild schicker Wohnviertel im Ausland, eingeführt. Dominikaner erstanden den ehemaligen Jungblutshof vom Bauern Jean Bellion und ließen sich 1904 hier nieder. Sie errichteten eine kleine Kapelle, die heute noch erhalten und denkmalgeschützt ist. Wie Historiker Robert Philippart schilderte, sei die Straße 1913 ans Kanalnetz angeschlossen worden. 1931 wurde sie auf die heutige Breite angelegt. Die „Daubenfelderstraße trägt ab 1906 den Namen „rue Belair“. Während des Krieges wurde sie in Prinz-Albert- Straße umbenannt. Erst 1947, nach dem Tode des Bürgermeisters Gaston Diderich, erhielt die Straße ihren heutigen Namen.
Viele erinnern sich sicher noch an die „Clinique Sacré Coeur“. Das Krankenhaus wurde 1956 eingeweiht und vom Architekten Jean Lammar entworfen. Es war dies nicht sein einziges Krankenhaus. Der Architekt war ebenfalls für die Planung der ehemaligen Privatklinik Dr. Bohler zuständig. In der Avenue Gaston Diderich entwarf er mehrere Häuser, die heute denkmalgeschützt sind
Ein Bauwerk, das wohl den meisten (ehemaligen) Einwohnern des Viertels Belair bekannt sein dürfte, ist die Belairer Schule. Sie wurde 1933 nach den Plänen von Stadtarchitekt Nicolas Petit errichtet und 1936 in Betrieb genommen. Der Bau bestand aus getrennten Flügel für Mädchen und Jungen. Ein Tor gilt als Einfahrt für Krankenwagen und Feuerwehr zum Hof. Das Schulgesetz von 1912 schrieb das Bauprogramm vor, mit Turnhalle, Zeichensaal und Gesangsklasse. Das Grundstück hatte bereits der Gemeinderat von Hollerich erstanden. 1920 wurde die Sektion Merl mitsamt der Gemeinde Hollerich der Hauptstadt einverleibt.

Von der Villa zum Labor
Gegenüber der Schule steht die Villa von Joseph Masserette, einem international hochgeschätzten Kleriker, Aumonier der Franziskaner-Schwestern und Pionier der Erforschung des Lebens von Pierre Ernest de Mansfeld. Er wurde in wissenschaftlichen Kreisen als Autor mehrerer Studien über den ehemaligen Luxemburger Adel hochgeschätzt.
Das Nachbarhaus („Kataster“) war ursprünglich die Villa von Nicolas Leclerc. Die prächtige Villa stand mehrfach in der Kritik ihrer Nachbarn und der Einwohner des Viertels. 1924 erstand ein gewisser Guillaume Kroll das Haus. Er baute es vollständig um und erweiterte es durch ein Labor. Hier lebte und forschte der international bekannte Erfinder der industriellen Herstellung der Hartmetalle Zirkonium und Titan. Beide Metalle werden heute in der Chirurgie, aber auch in der militärischen Produktion genutzt. Immer wieder befürchteten Anrainer und Interessenvereine eine Katastrophe im Labor, ihnen war die Forschungsanstalt ein Dorn im Auge. Isabelle Yegles, Historikerin vom staatlichen Bauamt, ging weiter auf die Geschichte des Gebäudes ein. Hier forschte nicht nur Guillaume Kroll: 1948 verlegte die Ackerbauverwaltung das tiermedizinische Labor, im Volksmund als „Veterinärslabo“ bezeichnet, in die ehemaligen Laborräumlichkeiten. Im selben Jahr zog auch das Katasteramt in die Villa ein. Erneut gab es Aufruhr im Wohnviertel, diesmal wegen des Gestanks, der aus dem tierärztlichen Labor in die Umgebung gelang. Die ursprüngliche Villa wurde um 1906 errichtet und in den 30er Jahren umgebaut.
Vom Velodrom zum Wohnviertel
Im weiteren Verlauf der mobilen Geschichtsstunde ging Stadthistoriker Robert Philippart auf das im Jahr 1921 errichtete Velodrom ein. Als 1952 Luxemburg zum Sitz der Montanunion wurde und man mit dem Zuzug zahlreicher Europabeamten rechnete, ließ das belgische Unternehmen die gesamte Fläche des Velodroms in ein neues Wohnviertel umwandeln. Etwas weiter auf der linken Seite der Avenue steht die Maison Belair aus dem Jahr 1923. Venus und Merkur zieren den Garten dieses Jugendstilhauses, welches mit den rechts und links errichten Bauten ein Ensemble bildet. Es handelt sich um die ehemalige Wohnung des Jugendstilarchitekten Mathias Martin. An ihn erinnern die Villa Clivio, Villa Pauly, Villa Pier im Bahnhofsviertel, die Villa Robur in der rue Albert Ier.
Auch als Historiker betätigte sich dieser hochinnovative Architekt, welcher 1921 ein „neues Bauartsystem“ als Patent eingereicht hatte. Martin hatte während seines Lebens 19 Erfindungen beim Patentamt eingereicht. Einige Schritte weiter, auf der gegenüberliegenden Seite, steht die ehemalige Lehreranstalt Saint-Jean, die 1936 nach den Plänen von Jean Makel errichtet wurde. 1959 wurde die Lehreranstalt umstrukturiert und ins „Institut pédagogique“ umgewandelt. Der heutige Parkplatz war damals für die Jungs als Basketballfeld angelegt worden. Seit 1987 bezieht die Stadt Luxemburg das ehemalige Saint-Jean.
Im Pfarrhaus gleich nebenan wohnte Joseph Gevelinger, Begründer der Pfarrei Belair und Initiator der Kirche St. Pie X. Diese wurde gleich am folgenden Tag der Heiligsprechung dieses Papstes zu seinen Ehren 1954 konsekriert. Joseph Gevelinger gehört in den 50er Jahren zu den ersten Autoren, die Gebete in luxemburgischer Sprache verfassten. Luxemburgisch gilt erst ab 1984 offiziell als liturgische Sprache, denn erst ab da ist das „Lëtzebuergesch“ per Gesetz als Landessprache definiert. Die Kirche von Belair wurde nach den Plänen des Architekten Laurent Schmit errichtet; die Fenster und Mosaiken sind Werke des Künstlers François Gillen, der Kreuzweg stammt von Ben Heyart. Seit der Eröffnung der Primärschule 1936 wurde die Errichtung einer Pfarrkirche gefordert. Der 70 m hohe Kirchturm steht in der Sichtachse zu den Türmen der Kathedrale. Am Fuß der Kirche steht das „Offizéieschkräiz, welches an drei österreichische Offiziere erinnert, die 1793 in der Festung Luxemburg an Typhus gestorben sind.


 De Maart
De Maart



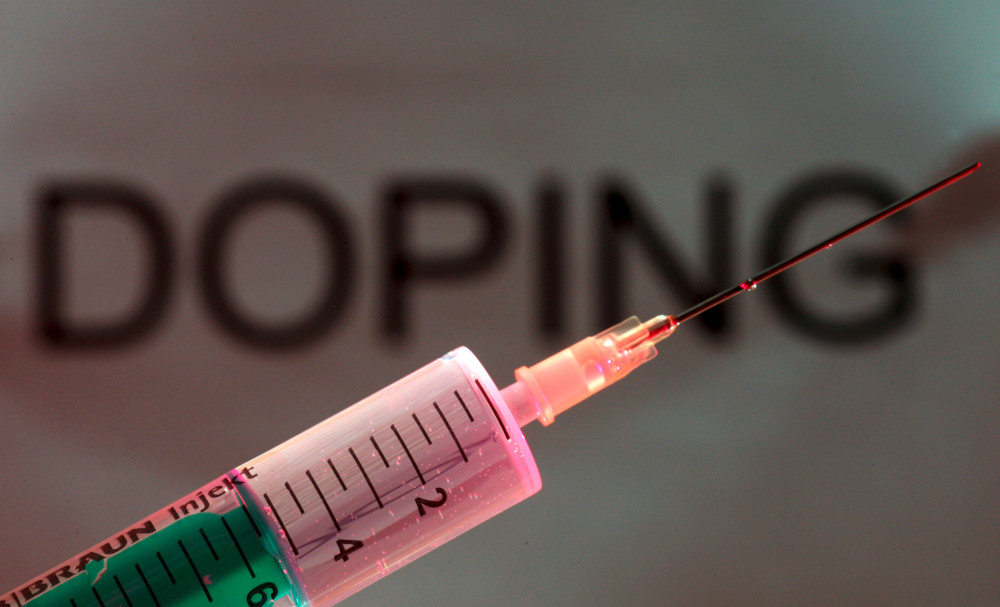



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können