Tageblatt: Herr Loschetter, Sie hatten gerade den Großherzog am Telefon. Am Samstag haben Sie mit Ihrem Team die Feierlichkeiten auf der „Rout Bréck“ und dem Glacis organisiert. Wie ist Ihr Fazit?
Laurent Loschetter: Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich habe ja gerade mit dem Großherzog gesprochen: Es ist am Samstag etwas entstanden, was wir uns erhofft hatten. Ein Zusammenkommen, aber ohne nationalen Überbau. Wie soll ich das sagen? Es war ein Zusammensein, ohne jemanden auszuschließen. Die Vielfalt der Sprachen und Kulturen in Luxemburg. Das war über den ganzen Tag zu spüren. Kein Nationalismus, kein Ausgrenzen, keine Pöbelei. Wir haben ja nur die Bühne und die Logistik gemacht. Der Spirit, das kommt schon von ihm. Und ich muss sagen, er ist super mutig gewesen, uns diesen Tag einfach so zu überlassen. Er hat mir vertraut, aber er hat auch meinem Team vertraut. Wir hatten totale Freiheit.
Monarchie und Atelier, das will auf den ersten Blick nicht zusammenpassen …
L.L.: Absolut richtig. Als ich Guillaume zum ersten Mal getroffen habe, Ende September 2024, da habe ich ihm genau das Gleiche gesagt. Und er hat mich sofort gestoppt: „Nein, nein, Monarchie, das ist einen Tag vorher, wenn ich Großherzog werde. Und Religion ist einen Tag später, wenn ich in die Kathedrale gehe. Das hier ist etwas anderes. Hier geht es um das Land.“ Damit hatte er mich, da habe ich verstanden.

Von der Konzerthalle in der ehemaligen Autowerkstatt zum Ausrichter des Thronwechsels – gibt es einen Moment in den letzten 30 Jahren, an dem Sie zum ersten Mal festgestellt haben: Wir haben hier echt was auf die Beine gestellt?
L.L.: Ich habe da witzigerweise eine saublöde Situation: Ich habe damals ein neues Auto bekommen mit GPS. Da habe ich einfach aus Jux unsere Adresse eingegeben und dann stand da „den Atelier“, auf dem Bildschirm in einem deutschen Auto. Da sagst du dir: Okay, das ist nicht mehr nur ein Platz an der rue de Hollerich. Da gibt es einen Spot, wo irgendeiner bei Audi gesagt hat: Das ist „den Atelier“ in Luxemburg. Ich war eine Woche happy: Meine Idee ist jetzt überall auf dem GPS.
Das Rock-A-Field hat uns fast das Genick gebrochen
„Den Atelier“ hat auch schwierige Zeiten erlebt, zum Beispiel mit seinem Festival.
L.L.: Die Firma war zweimal ganz nah am Ende. Weil wir am Anfang einfach drauf losgemacht haben. Das Rock-A-Field hat uns fast das Genick gebrochen. Irgendwann ist dann die gute Entscheidung gefallen, einen CEO, einen Direktor einzustellen. Einen, der das hauptberuflich macht. Wir haben ja alles versucht mit dem Rock-A-Field. Ganz große Line-ups, ganz viele Tage. Weniger Line-ups, weniger Tage. Ein einziges Jahr sind wir auf null gekommen. Alle anderen Jahre haben wir Geld verloren. Irgendwann haben wir die Reißleine gezogen. Wir lieben das Projekt, aber es ergibt keinen Sinn. Es ist verrückt. Innerhalb von zehn Jahren ist eine Band, für die wir 70.000 Euro bezahlen mussten, auf 500.000 gestiegen. Die gleiche Band mit der gleichen Anziehungskraft. Heute nutzen wir das Know-how, das wir mit dem Rock-A-Field gesammelt haben, um unsere Headline-Shows auf der Luxexpo zu machen.
Fabienne Dimmer: Mit der Luxexpo haben wir auch Infrastruktur. Rock-A-Field war ein Feld. Da musste alles hingebracht werden. Bei Regen. Bodenplatten mussten verlegt werden. Strom. Parkplätze. Busse. Ich weiß nicht, was wir an Bussen bezahlt haben, damit die Leute überhaupt dahin kommen.
L.L.: Übrigens: Die Leute, die an diesem Thronwechsel-Wochenende gearbeitet haben, waren genau die Leute, die für uns damals schon auf dem Rock-A-Field gearbeitet haben.
Wie erleben Sie den Wandel in der internationalen Konzertbranche?
L.L.: Es gibt diesen Titanenkampf zwischen Live Nation und AEG. Die schlucken alles, Venues, ganze Künstler. Live Nation macht zum Beispiel mit Madonna einen 360-Grad-Deal. Das geht dann bis zum T-Shirt-Verkauf. Als lokaler Veranstalter kann man sich entweder von Live Nation branden lassen und die Show machen – oder Live Nation macht es eben selbst. Wir sind ein bisschen zu klein, dass Live Nation bei uns anklopft und uns kaufen will. Kann aber noch kommen. Dann kann ich mein Haus abbezahlen (lacht). Aber im Ernst, für uns gibt es zwei Welten. Es gibt unser Zuhause hier im „Atelier“. Das ist unsere Safe Zone. Da machen wir verrückte Sachen. Hier spielen jetzt Portugal. The Man. Damit könnten wir auch die Rockhal füllen. Und dann sind eben die Sachen, die wir außerhalb von hier machen, wo wir uns dann austoben können mit größeren Sachen. Es ist auch „den Atelier“, das Lorde in der Rockhal macht.

Haben Sie eine Lieblingsshow aus 30 Jahren?
F.D.: Nur eine? Das ist die schlimmste Frage. Lass uns jahrzehnteweise vorgehen. In den Neunzigern nimmst du 100 Prozent Faith No More. Und Moby.
L.L.: Und Massive Attack. Und die erste Faithless-Show. Muse hat hier auch gespielt.
F.D.: Queens of the Stone Age. Mit Support-Act Eagles of Death Metal.
L.L.: Die letzte Show der Smashing Pumpkins, bevor sie sich aufgelöst haben. Die letzte Show von Bloc Party hatten wir übrigens auch. Die haben sich nach dem Konzert aufgelöst.
F.D.: X-mal auch Motörhead. Der Lemmy mit seinem Spielautomaten und seiner Jack-Daniels-Flasche. Aber dann eben auch die Ärzte 2019 hier im Atelier, was verrückt ist, weil die Ärzte 2019 riesig waren. Das war ihre Clubtour.
L.L.: Der Lemmy war ein echter Rockstar. Ich erinnere mich an die erste Show von Motörhead. Da hatten wir hier kein warmes Wasser. Es herrschte totale Panik und der Tourmanager kam zu Lemmy: „We have no shower“. Ihm war das scheißegal. Lemmy ist dann einfach auf die Toilette vom Publikum gegangen und hat sich dort die Haare gewaschen unter dem Wasserhahn.
Gab es auch Enttäuschungen?
L.L.: Ich persönlich habe zweimal eine Band rausgeschmissen. Die eine hat sich entschuldigt, die waren total auf Ketamin, oder was weiß ich. Und die andere Band, die hat jetzt definitives und endgültiges Hausverbot. Ohne Namen zu nennen: Dabei ging es um viel zu junge Mädchen im Backstage-Bereich. Es gibt rote Linien, die darfst du nicht überschreiten lassen.
Wir bekommen keinen Euro, aber wir bringen Künstler seit 30 Jahren nach Luxemburg
Wie weit geht in solch einem Fall die Verantwortung der Veranstalter? Wie hat sich die Branche in diesem Punkt verändert?
L.L.: Die Zeit von Sex, Drugs und Rock’n’Roll ist vorbei. Das geht nicht mehr. Es gab und gibt aber noch immer Personen, die gerne interagieren mit einer Band für eine Nacht. Wir sehen das fast bei jeder Show. Es ist unsere Aufgabe, zu schauen, ob das in der Legalität geschieht oder nicht. Zum einen gibt es klare Belege: Jemand ist minderjährig oder jemand ist volljährig. Der zweite Punkt, die Sache mit den „Partydrogen“, ist relativ neu. Das ist eine neue Verantwortung. Jetzt müssen wir aufpassen und einschätzen, ob eine erwachsene Person freiwillig und im Vollbesitz ihres Urteilsvermögens in einen Tourbus reingeht oder nicht.
Wir kommen, glaube ich, relativ gut damit klar, wir schulen unsere Leute. Wir wollen niemanden bevormunden, aber wir wollen auf unsere Kunden aufpassen, wenn sie es nicht selbst tun. Wir haben einen strikten Kodex für Leute, die Hilfe brauchen in irgendeiner Form, klassischerweise Leute, die hörgeschädigt sind, oder Leute, die zu einer besonders vulnerablen Community gehören. Uns geht es darum, dass unsere Kunden wieder gesund nach Hause gehen.
Welche Erfahrungen haben Sie in den vergangenen Jahren mit der luxemburgischen Kulturpolitik gemacht?
L.L.: Wir haben keinen Kontakt. Gar nicht. Wir sind nicht einmal mehr böse, das waren wir vielleicht vor zehn Jahren noch. In den Augen des Kulturministeriums sind wir Geschäftsleute. Punkt. In der Covid-Pandemie wurden wir als einer der Ersten zugemacht. Aber Hilfe gab es keine. Irgendwann kam Lex Delles und wir haben ihm gesagt: „Wir machen zu. Wir machen bankrott. Wir haben jetzt sechs Monate die Miete, die Leute bezahlt“. Da bekamen wir über das Wirtschaftsministerium genau die Hilfe, die wir gebraucht haben, um zu überleben. Aber die Kultur hat uns erst mal acht Monate schön bei Laune gehalten, um dann Nein zu sagen.
Welche Rolle spielt „den Atelier“ in der luxemburgischen Kulturszene?
L.L.: Die Kulturszene in Luxemburg besteht zu 95 Prozent aus Häusern, die öffentlich finanziert sind. Die machen einen mega Job, wie die Rotondes oder die Philharmonie. Aber wir sind da die kleine schwarze Ente.
F.D.: Es gibt außer uns nur De Gudde Wëllen und noch den kleinen Jazzclub im Grund, sonst ist keiner privat.
L.L.: Wir haben Freunde bei diesen staatlichen Institutionen, wir arbeiten sehr gut individuell mit denen zusammen. Aber wenn wir jetzt so etwas machen wie an diesem Wochenende, dann sind die irgendwie nicht sehr froh darüber. Die sagen sich: Im Grunde hätten wir gefragt werden sollen. Aber jetzt wurde eben das winzige achtköpfige Team vom Atelier gefragt, und die haben geliefert. Wir sind eine kleine Firma, die Kulturszene schaut uns komisch an. Manchmal habe ich das Gefühl, es wären ihnen lieber, wir wären nicht da, oder nicht?
F.D.: Ja, wir stören. Oder besser, wir stören nicht, aber wir liefern immer wieder, ohne dass wir Millionen bekommen. Wir bekommen keinen Euro, aber wir bringen Künstler seit 30 Jahren nach Luxemburg. Von kleinen bis zu großen Namen. Künstler, von denen man nie gedacht hätte, dass sie jemals hierher kommen.
L.L.: Die Stadt Luxemburg ist ein treuer Supporter, seit es uns gibt. Von denen bekommen wir 80.000 Euro pro Jahr. Damit ermöglichen sie uns, beim Kulturpass mitzumachen. Noch so ein Punkt, wo man von staatlicher Seite nicht an uns gedacht hat.

Gibt es noch unerfüllte Wünsche für die nächsten 30 Jahre?
L.L.: Es gibt ein paar Bands, die ich unbedingt machen würde, an denen wir schon nah dran waren. Das ist für mich ganz klar The Cure, die sind in meiner Top Ten der besten Live-Konzerte zweimal drauf.
F.D.: Pearl Jam. Noch immer.
L.L.: Und dann noch diese Idee von größeren Konzerten mit 50.000 Leuten. Green Day spielt mit der gleichen Bühne, die wir auf der Luxexpo hatten, vor 50.000, 60.000 Menschen. Aber wir haben hier keine Venue. Wenn wir ein Stadion hätten, wo man Konzerte machen könnte, dann könnte …
… auch Bruce Springsteen in Luxemburg auftreten?
L.L.: Natürlich! Das ist die gleiche Bühne. Das ist der gleiche Agent. Die gleiche Mail, nur die Zahlen sind anders.
F.D.: Die Arbeit im Backstage ist auch genau die gleiche. Ob wir jetzt 15.000 Leute haben oder 50.000.
L.L.: Ich brenne. Wir können auch 60.000.

 De Maart
De Maart







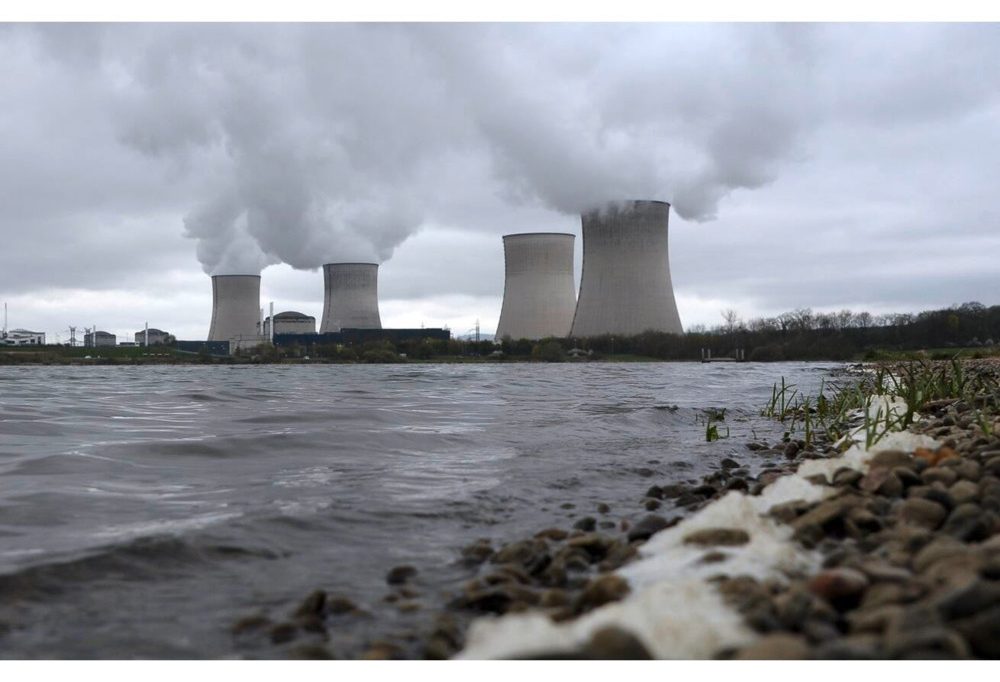

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können