13. November 2025 - 6.55 Uhr
Analyse von außenAfrikas Entwaldung stoppen: Der Lebensstandard des Kontinents muss verbessert werden

Man denke nur an den anhaltenden Fokus auf Afrikas massive Klimafinanzierungslücke, die zwischen 2020 und 2030 auf rund 2,8 Billionen Dollar geschätzt wird, und seine unhaltbare Schuldenlast, wobei Subsahara-Afrika (SSA) inzwischen mehr für den Schuldendienst ausgibt, als es an Klimafinanzierung erhält. Viel Aufmerksamkeit wurde auch den enttäuschenden Fortschritten der afrikanischen Länder bei der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen gewidmet. Der Kontinent ist auf dem besten Weg, nur 6% der 32 messbaren SDG-Ziele bis 2030 zu erreichen.
Diese Herausforderungen werden jedoch durch den Mangel an internationaler Entwicklungshilfe noch verschärft. Nirgendwo wird die Kluft zwischen Rhetorik und Handeln deutlicher als bei den Bemühungen zur Erreichung des SDG 15, das den Schutz, die Wiederherstellung und die Förderung der nachhaltigen Nutzung von Landökosystemen vorsieht, u.a. durch die Bekämpfung der Entwaldung. Von 2010 bis 2020 verzeichnete Afrika mit durchschnittlich 3,9 Millionen Hektar den weltweit größten jährlichen Netto-Waldverlust. Angesichts des Ausmaßes des Problems muss die UN-Klimakonferenz (COP30) in Belém eine proaktivere und umfassendere Strategie zur Verhinderung der Entwaldung und zur Eindämmung der damit verbundenen Umweltrisiken beschließen.
Erhaltung des Kongobeckens
Mit einer breiten Palette bewährter Maßnahmen – von denen viele außerhalb des Bereichs der Klimapolitik liegen – könnten jedes Jahr Millionen Hektar Wald in Afrika geschützt werden, insbesondere im Kongobecken, einem der wichtigsten globalen Gemeinschaftsgüter. Das Kongobecken, das den zweitgrößten tropischen Regenwald der Welt beherbergt, absorbiert jährlich fast 1,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid und ist ein Hotspot der biologischen Vielfalt mit rund 10.000 Arten tropischer Pflanzen, von denen 30% nur in dieser Region vorkommen.
Die Erhaltung des Kongobeckens ist besonders wichtig, weil die unersättliche weltweite Nachfrage nach den natürlichen Ressourcen Afrikas die Wälder des Kontinents dezimiert hat. Dieser Prozess begann im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als die europäischen Imperialmächte Holz exportierten und weite Teile des Urwalds für den Anbau von Kakao, Kaffee, Palmöl, Tee und Kautschuk abholzten. Dieser Prozess hat sich in den letzten Jahren fortgesetzt und sogar noch intensiviert, angetrieben durch den demografischen Druck und die steigende Nachfrage Asiens nach Rohstoffen. Infolgedessen hat das tropische Afrika seit 1900 etwa 22% seiner Waldfläche verloren – vergleichbar mit den bekannteren Verlusten im Amazonasgebiet.
Die Entwaldung im Kongobecken nähert sich rasch einem Wendepunkt. Zwischen 2002 und 2024 verlor die Demokratische Republik Kongo, die etwa 60% des Regenwaldes im Kongobecken beherbergt, 7,4 Millionen Hektar feuchten Primärwald, was 36% des gesamten Verlustes an Baumbestand ausmacht. Wenn die derzeitige Entwaldungsrate anhält, könnten große Teile des Kongobeckens bis 2050 verschwinden, was schwerwiegende Folgen für die globale Klimastabilität hätte.
Geringe landwirtschaftliche Produktivität
Der unersättliche Appetit der Welt auf die natürlichen Ressourcen Afrikas ist jedoch nicht die einzige Ursache für die Abholzung der Wälder. Auch die Subsistenzlandwirtschaft und die steigende Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere in den rasch wachsenden städtischen Gebieten, haben zu einer großflächigen Abholzung geführt, die vor allem auf die geringe landwirtschaftliche Produktivität und die schlechte Raumplanung zurückzuführen ist.
In vielen afrikanischen Ländern erreichen die Ernteerträge nur 20-30% ihres Potenzials, weil es keine Bewässerung gibt (derzeit werden weniger als 5% der Anbauflächen in SSA bewässert), kaum Düngemittel und hochwertiges Saatgut verwendet werden und der Zugang zu Technologien unzureichend ist. Um den Nahrungsmittelbedarf einer schnell wachsenden Bevölkerung zu decken, die bis 2050 voraussichtlich 2,5 Milliarden Menschen erreichen wird, kompensieren die Landwirte niedrige Ernteerträge häufig durch die Rodung weiterer Flächen und verkürzte Brachezeiten.
Eine ungeplante Verstädterung ist ebenso schädlich. Schlechte Wohnstandards und die Ausbreitung von Einfamilienhäusern minderer Qualität, denen es an grundlegenden Annehmlichkeiten fehlt, haben zu einer Zersiedelung der Landschaft geführt. Viele afrikanische Städte – von Lagos und Douala bis Kinshasa und Kibera – wachsen nicht in die Höhe, sondern in die Breite, und Millionen von Hektar Wald werden gerodet, um Platz für solche Wohnungen zu schaffen. Erschwerend kommt hinzu, dass mehr als 70% der Haushalte in SSA immer noch mit Holz kochen und heizen, was zu einer noch stärkeren Umweltzerstörung führt.
Auswirkungen schlechter Stadtplanung
Dies verstärkt die negativen langfristigen Auswirkungen, die eine schlechte Stadtplanung auf das Klima hat. Obwohl sich die Staats- und Regierungschefs auf früheren COPs dazu verpflichtet haben, den Waldverlust und die Bodendegradation zu stoppen und rückgängig zu machen, übersteigt die Entwaldung in Afrika weiterhin die Bemühungen zur Wiederaufforstung, einschließlich der „African Forest Landscape Restoration Initiative“ und der „Great Green Wall Initiative“.
Und die Verordnung der Europäischen Union über entwaldungsfreie Produkte ist zwar ein lobenswertes Unterfangen, wird das Ungleichgewicht aber wahrscheinlich nicht beheben. Das liegt daran, dass die alleinige Konzentration auf den Regenwald nicht ausreicht, um ihn zu retten. Investitionen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität, zur Anhebung des Wohnstandards und zur Verbesserung der Raumplanung – mit dem Schwerpunkt auf kompaktem, aufwärts gerichtetem Wachstum anstelle von Zersiedelung – sind unerlässlich, um den Regenwald im Kongobecken zu erhalten und den Zusammenbruch des Ökosystems zu verhindern. Die Steigerung der Ernteerträge und der Bau besserer Städte gehören nicht nur zu den kosteneffizientesten Strategien zur Anpassung an den Klimawandel, sondern bringen auch erhebliche wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich. Durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen unmittelbaren Bedürfnissen und langfristiger Nachhaltigkeit können Investitionen in diesen Bereichen Afrika helfen, den demografischen Druck zu bewältigen, ohne die Zukunft des Planeten zu gefährden.
Jahrzehntelang verließen sich die afrikanischen Regierungen auf Cash Crops und Holzexporte, um ihre Devisenreserven aufzubauen, und stellten Wachstum und makroökonomische Stabilität über eine nachhaltige Entwicklung. Afrikanische Haushalte verfolgen zunehmend einen ähnlichen Ansatz, indem sie den Grundbedürfnissen Vorrang vor Klima- und Umweltbelangen einräumen. Doch in einer Zeit, die von der globalen Klimakrise geprägt ist, sollten die Afrikaner nicht in ein solches Cornel’sches Dilemma gezwungen werden. Angesichts des rasanten Bevölkerungswachstums auf dem Kontinent wäre eine Fortsetzung dieses Weges zerstörerisch für den Planeten und alle seine Bewohner. Um das Risiko des Überschreitens der Klimakipppunkte zu verringern, muss die Welt den Lebensstandard in Afrika verbessern. Dies ist ein Preis, der gezahlt werden muss, um eine Klimakatastrophe abzuwenden.
Hippolyte Fofack, ehemaliger Chefökonom der African Export-Import Bank, ist Parker Fellow beim Sustainable Development Solutions Network an der Columbia University, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for African Studies der Harvard University, distinguished fellow bei der Global Federation of Competitiveness Councils und Fellow bei der African Academy of Sciences. Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org .

 De Maart
De Maart


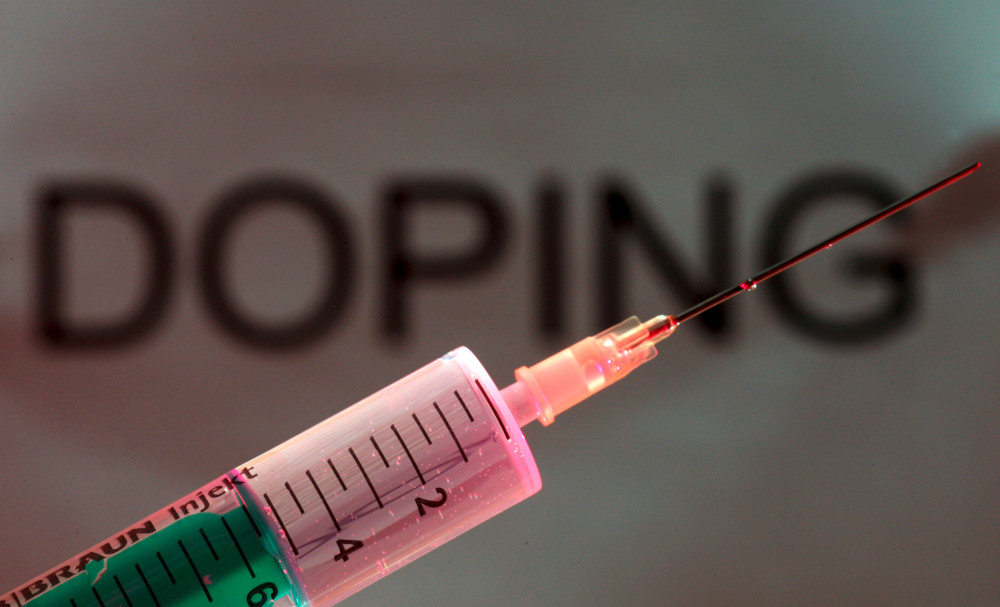



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können