Drei Präsidenten – ein Interessenkonflikt

Es gab Tage in den vergangenen Monaten, da sorgte die Spezialkommission für mehr Schlagzeilen mit ihrem eigenen Personalkarussell als mit tatsächlichen Inhalten zur Causa Caritas. In der ersten Sitzung am 23. Oktober wird Laurent Zeimet (CSV) zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. Noch vor der zweiten Sitzung, am 13. November, zieht sich Zeimet aus freien Stücken aus der Kommission zurück. Gegenüber dem Tageblatt erklärt Zeimet, dass ein möglicher Interessenkonflikt Grund für diese Entscheidung war. Der CSV-Politiker ist bei der Anwaltskanzlei Schiltz & Schiltz eingeschrieben. Er selbst habe zwar nie Akten der Kanzlei betreut, wolle aber jegliche Möglichkeit für einen Verdacht auf Interessenkonflikt vermeiden, so Zeimet. Sieben Tage später, am 20. November, wird seine Parteikollegin Stéphanie Weydert zur neuen Vorsitzenden der Kommission bestimmt. Doch auch sie hat dieses Amt nur bis Ende Januar inne. Dann tritt sie als Mitglied und Präsidentin zurück, nachdem sich die „Fondation Caritas“ und die „Caritas Accueil & solidarité“ (CAS) in einem Brief an die Chamber gewendet und Weydert einen möglichen Interessenkonflikt vorgeworfen hatten. Weydert ist als „député-maire“ in Vollzeit zwar nicht mehr als Anwältin tätig, jedoch bei der Kanzlei Arendt & Medernach eingetragen, die eine der vom Caritas-Skandal betroffenen Banken berät. Weydert selbst sieht diesen Interessenkonflikt nicht, zieht sich aber nach einem Gutachten des Ethikausschusses zurück, um das Vertrauen der Bürger in den Sonderausschuss nicht zu beeinträchtigen. Den Vorsitz dort übernimmt schließlich ihr Parteikollege Charel Weiler – und hält bislang durch. Denn der ist zwar auch gelernter Jurist, seit 2022 jedoch nicht mehr am „Barreau“ gemeldet und nicht mehr als Anwalt tätig. Glück für die CSV, deren erste Wochen in der Spezialkommission ein ganz schön holpriger Ritt waren.
Die Caritas

Wenn die Spezialkommission eine Erkenntnis zutage gefördert hat, dann ist es diese: Die eine Perspektive auf die Ereignisse des vergangenen Sommers gibt es nicht. Nicht einmal bei den Vertretern der Caritas selbst.
Im Januar bezeichnet Nathalie Frisch, Mitglied des Verwaltungsrats, die Abwicklung der Caritas mangels Alternativen als einzigen Lösungsweg. Man habe noch lange Zeit versucht, interne Lösungen zu finden, dies sei jedoch aus Mangel an Geldgebern gescheitert. „Die einzige Lösung war letztlich die Gründung einer neuen Entität außerhalb der Caritas“, sagt Frisch. Eine echte Entscheidung sei das jedoch nicht gewesen. „Da es aber nur eine Lösung gab, war es de facto auch keine Entscheidung.“ Zwei Monate später ist der ehemalige Caritas-Direktor Marc Crochet zu Gast bei der Spezialkommission, er war im Januar zurückgetreten, ein halbes Jahr nach Bekanntwerden des Skandals. Crochet lässt über seinen Anwalt nach der Sitzung mitteilen, dass auch andere Wege als die Gründung einer neuen Organisation möglich gewesen wären. Andere Caritas-Entitäten seien nicht vom Schuldenberg betroffen gewesen. Crochet, so zeigt sich, ist kein Anhänger der Theorie des „Eimers mit den vielen Löchern“ (s. „Der Staat“).
An anderer Stelle zeigt sich den Abgeordneten das Bild einer „Caritas ouni Kapp“, wie die DP-Abgeordnete Carole Hartmann zusammenfasst. Vor der Kommissionssitzung mit dem ehemaligen Operationsdirektor der Caritas, Tom Brassel, macht 100,7 öffentlich, dass dieser bereits im Juni den Verwaltungsrats-Vizepräsidenten Pit Bouché über die Kreditlinien aufgeklärt hatte. Bouché selbst wehrt sich eine Woche später in der Spezialkommission gegen den Vorwurf, er habe frühzeitig von den Kreditlinien gewusst – und bringt sogar WhatsApp-Nachrichten von Brassel als Beweis mit in die Sitzung. Direktion und Verwaltungsrat der Caritas schieben sich die Verantwortung hin und her.
Die Staatsanwaltschaft
Die Ehre, die ersten Gäste in der Spezialkommission „Caritas“ zu sein, fällt im Januar auf die Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft des Bezirksgerichts Luxemburg und der „Cellule de renseignement financier“ (CRF). Konkrete Informationen zu den laufenden Ermittlungen teilen die Staatsanwaltschaft an diesem Tag nicht. Stattdessen plädiert die damalige Generalstaatsanwältin Martine Solovieff bei den Parlamentariern eindringlich für mehr Personal. Staatsanwaltschaft und CRF benötigten mehr Mittel, auch im Hinblick auf internationale Zusammenarbeit. Dort würden die Ermittler regelmäßig an ihre Grenzen stoßen. Die von den Abgeordneten vorgebrachte Kritik an der spärlichen Kommunikation der Staatsanwaltschaft zum Stand der Ermittlungen tropft hingegen an den ersten Gästen der Spezialkommission ab.
Der Staat

Premierminister Luc Frieden macht in seinem Austausch mit der Spezialkommission Ende Mai noch einmal deutlich, welche Ziele die Regierung im vergangenen Sommer verfolgt hat: die Aktivitäten der Caritas zu retten und dafür zu sorgen, dass Staatsgelder „nicht in falsche Hände“ gerieten. Beide Ziele habe man erreicht, resümiert der Premier. Für einige Mitglieder der Spezialkommission bleiben aber auch nach sieben Monaten und mehreren Gesprächen mit Vertretern des Staates zwei zentrale Fragen offen, die beide miteinander zusammenhängen: Wurde wirklich ernsthaft nach Alternativen gesucht? Und warum hat der Staat die Caritas nicht weiter finanziert, sie stattdessen „ausbluten lassen“, wie Taina Bofferding es einmal martialisch formulierte.
Zumindest erstere Frage schien, so die Erkenntnis der Kommission, nicht in den Aufgabenbereich des „Comité de suivi“ gefallen zu sein, jenes Gremiums, das vergangenen Sommer von der Regierung eingesetzt wurde und aus hohen Staatsbeamten derjenigen Ministerien bestand, die vom Caritas-Skandal betroffen waren. Es wurde mit den bereits erwähnten Hauptaufgaben betraut: die Aktivitäten der Caritas zu sichern und damit möglichst viele Arbeitsplätze; Staatsgelder zu schützen und damit Steuergelder. Um die Zukunft der Caritas sollte sich das Krisenkomitee der Organisation selbst kümmern. In der Spezialkommission kritisieren die Vertreter der Opposition eben jenes Nebeneinander der beiden Komitees. Marc Baum nennt es einen „kleinen Einblick ins Krisenmanagement zu Zeiten des Neoliberalismus“. Zwischen den beiden Komitees habe es wohl wenig Austausch gegeben, so ein Fazit der Parlamentarier.
Ein Dauerbrenner in der Kommission bleibt über sieben Monate hinweg die Theorie vom „Eimer mit den vielen Löchern“. Der Staat hat der Caritas kein Geld mehr gegeben, weil man nicht wollte, dass das verloren geht. Bei einer Caritas-internen Lösung, so Premier Frieden, hätten die Schulden der Organisationen dazu führen können, dass Staatsgelder zu den Banken geflossen wären, statt zu den „Ärmsten der Gesellschaft“. Diese Theorie sei bis heute „unbestätigt“, wiederholt Berichterstatterin Bofferding immer wieder. Die Abgeordneten warten noch immer auf Einsicht in die juristischen Gutachten, die die Regierung damals zu ihrer Entscheidung bewogen haben.
Eine grundlegende Schlussfolgerung kann die damalige Kommissionspräsidentin Weydert bereits nach der Sitzung mit dem „Comité de suivi“ im Januar ziehen: Der Staat müsse viel besser auf die finanzielle Lage der Träger achten, die Aufgaben für den Staat übernehmen.
HUT – Hëllef um Terrain & PwC
Was für die Banken das Bankgeheimnis, ist für PricewaterhouseCoopers, besser bekannt als PwC, das Geschäftsgeheimnis. Im Austausch mit den Abgeordneten im Februar verweisen die Vertreter des Beratungsunternehmens hinsichtlich der Entscheidungen im Caritas-Skandal immer wieder auf die Caritas oder das Krisenkomitee. Was auch immer genau geschehen ist, es war zumindest nicht billig. Recherchen von 100,7 haben aufgedeckt, dass PwC der Caritas mindestens 1,2 Millionen Euro in Rechnung gestellt hat für ihre administrative Unterstützung in den Monaten nach dem Finanzbetrug.
Nur zwei Tage später ist Christian Billon zu Gast in der Kommission, Verantwortlicher der Übergangszeit, erst Teil des Krisenkomitees, dann Chef der neu gegründeten Caritas-Nachfolgeorganisation HUT – Hëllef um Terrain. Abgeordnete wie Marc Baum („déi Lénk“), die sich Antworten zur Übergangsphase zwischen den beiden Organisationen und zur Streitfrage des „transfert d’entreprise“ erhofft haben, werden enttäuscht. Billon gibt lediglich an, die ehemaligen Caritas-Mitarbeiter würden die gleiche Arbeit wie vorher machen, mit derselben Motivation.
Die Frage, ob es keine Alternative zur Gründung von HUT gegeben hätte, spaltet die Mitglieder der Spezialkommission. Während Vertreter der Opposition davon sprechen, es sei „kein Wille“ da gewesen, „um die Caritas zu retten“, sehen CSV und DP die Entscheidung bei der Caritas-Stiftung und CAS, die im Krisenkomitee keine andere Möglichkeit sahen, als eine neue Entität zu gründen. Auch in der Bewertung der neuen Organisation HUT gehen die Meinungen unter den Parlamentariern auseinander. Die Grünen-Politikerin Djuna Bernard nennt sie eine „neoliberale Organisation ohne großes Wertemodell“. Carole Hartmann (DP) spricht hingegen von einer „Struktur, die der Caritas sehr gleicht“.
Das Bistum
Die Rolle des Bistums in der Caritas-Affäre blieb lange Zeit unklar. Im September hatte Kardinal Hollerich in Interviews behauptet, niemand von der Caritas habe sich bei ihm gemeldet, was sich aber in der Folge als unwahr herausstellte. Marie-Christine Ries, Vertreterin des Erzbistums im Verwaltungsrat, habe den Kardinal schon Anfang Juli – noch an dem Abend, als der Betrug intern aufgeflogen ist – per SMS in Kenntnis gesetzt und ihn später regelmäßig per Mail auf dem Laufenden gehalten, deckte Radio 100,7 vor drei Monaten in seinem Podcast „Carambolage“ auf. Zudem habe Hollerich schon am 25. Juli den Caritas-Verwaltungsrat zum Rücktritt aufgefordert, seine Meinung anschließend aber wieder geändert.
Danach sei der Kardinal der Aufforderung des Verwaltungsrats nachgekommen, den früheren Caritas-Präsidenten Erny Gillen zu bitten, die Rolle des Krisenmanagers zu übernehmen. Dieser habe jedoch abgelehnt, weil zu dem Zeitpunkt schon klar gewesen sei, dass die Kirche die Caritas nicht finanziell unterstützen wolle, sagte Erny Gillen dem 100,7: „Also ech denken, de Kardinol Jean-Claude Hollerich, deen huet jo Perspektiven op deem Weltniveau, wann een dat esou ka soen, also innerhalb vun der Kierch, an hien huet dee Moment natierlech och mussen oppassen, wéi hie selwer sech duerstellt a wéi eng Roll datt hie selwer als Kierch wëllt elo hei iwwerhuelen op dem Lëtzebuerger Terrain.“
Im Sonderausschuss bestätigte Weihbischof Léo Wagener den Abgeordneten Mitte März, dass Anfang August eine Caritas-interne Lösung mit den Namen „Caritas Newco“ zwischen Krisenkomitee und Caritas-Gründer diskutiert worden sei. Weil das Bistum nur eine halbe Million Euro statt der benötigten fünf Millionen zur Verfügung stellen wollte oder konnte, sei diese Idee jedoch verworfen worden. Diese Woche wurde bekannt, dass Teile der humanitären Hilfe der Caritas von der katholischen „Fondation Partage“ (bis 2017„Bridderlech Deelen“) zeitlich befristet übernommen worden seien. Präsident von „Partage“ ist seit 2011 Jean-Claude Hollerich.
Die Fedas
Der Dachverband der sozialen Organisationen (Fedas) iwar vielleicht einer der produktivsten Gäste in sieben Monaten Spezialkommission. Beim Termin im März dieses Jahres brachte er den Abgeordneten ein fertiges Zehn-Punkte-Programm mit, um die Governance bei sozialen Organisationen zu verbessern. Berichterstatterin Bofferding hat jüngst bestätigt, dass dieses Thema ein wichtiger Schwerpunkt des Kommissionsberichts sein wird – und dass das Fedas-Programm in ihre Empfehlungen mit einfließen wird. Der Austausch mit dem Dachverband selbst bestätigt für einige Abgeordnete ihre These vom mangelnden Austausch zwischen den Akteuren in den relevanten Sommermonaten. Die Fedas hatte sich nach eigenen Angaben bereits im August, zu Beginn der Caritas-Krise, schriftlich an die Regierung gewandt und ihre Hilfe angeboten. Antwort gab es laut Fedas keine. Ein zweiter Brief wurde zumindest mit einer Empfangsbestätigung bedacht. Ein erstes Treffen zwischen Regierung und Fedas kam erst im Dezember zustande. Auch zum Krisenkomitee unter Billon scheint es wenig Kontakt gegeben zu haben.
Die Banken & die CSSF

Wenn man die Abgeordneten der Spezialkommission fragen würde, ob sie ihre Unterredungen mit den in den Caritas-Skandal verwickelten Banken in einem Wort zusammenfassen könnten, dann wäre dieses Wort ziemlich sicher: Bankgeheimnis. Mit diesem Wort schoben die Vertreter der Spuerkeess und der BGL BNP Paribas vielen Fragen einen Riegel vor – und blieben deshalb einige Antworten schuldig. Dafür gab es vonseiten der Parlamentarier teilweise Verständnis. Schließlich sehen sich die Banken zurzeit noch mit drei laufenden Ermittlungen konfrontiert: bei der Europäischen Zentralbank, bei der Luxemburger Bankenaufsicht CSSF und bei der Justiz.
„Die Banken sehen sich nicht wirklich verantwortlich“, resümiert Berichterstatterin Bofferding nach der jüngsten Kommissionssitzung. In der Tat: Auf ihrer Seite sei kein Fehler geschehen, sagte Françoise Thoma, Generaldirektorin der Spuerkeess, im Mai. Man habe sich an alle vorgeschriebenen Prozeduren gehalten. Eine Woche später zeigten sich die Vertreter der BGL BNP Paribas noch schweigsamer – und kalkulierter. „Sie haben das Wort Caritas kein einziges Mal benutzt“, sagte Bofferding nach der Sitzung. „Bei der Spuerkeess wurde der Verlust der Caritas wenigstens bedauert.“
Hätten den Banken die ungewöhnlichen Überweisungen auffallen müssen? Diese Frage bleibt bis heute ungeklärt. Klar ist für die Parlamentarier aber: Die Kommunikation zwischen Banken, Staat und Organisationen wie der Caritas muss vereinfacht werden, der Informationsaustausch gestärkt. Ob Schutzmechanismen bei den Banken gesetzlich nachgeschärft werden müssen, ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls unklar. Claude Marx, Generaldirektor der Bankenaufsicht CSSF, sagte bei seinem Besuch in der Spezialkommission im Januar, das Luxemburger Regelwerk sei nicht das Problem. Die Abgeordneten haben den Bericht mit den Ergebnissen ihrer Untersuchung bei der CSSF angefragt. Ob sie ihn bekommen werden, ist nicht klar. Er ist nicht öffentlich.
Die Gewerkschaft

Der OGBL, der bei der Caritas-Stiftung und bei „Caritas Accueil et solidarité“ die absolute Mehrheit in der Personaldelegation stellte, beharrt bis heute darauf, dass es sich bei der Übernahme der Hilfsorganisation durch „Hëllef um Terrain“ (HUT) arbeitsrechtlich um eine Unternehmensübertragung („transfert d’entreprise“) handelt. Um diese einzuklagen, haben mehrere Caritas-Beschäftigte und frühere Delegierte Einspruch vor dem Arbeitsgericht eingelegt. Bekämen sie recht, müsste HUT vielleicht die neuen Arbeitsverträge, die sie die rund 320 Beschäftigten im Dezember unterzeichnen ließ, auflösen und sie unter denselben Bedingungen einstellen wie vorher die Caritas. Offenbar hat HUT in den neuen Verträgen bestimmte von der Caritas garantierte Flexibilitätsklauseln im Zusammenhang mit der Arbeitszeit gestrichen.
Nach den Ausführungen von OGBL-Zentralsekretär Smail Suljic und Anwalt Marc Feyereisen in der Sitzung des parlamentarischen Sonderausschusses Ende Februar stellten mehrere Abgeordnete sich die Frage, ob die Beraterfirma PwC sie in einer vorherigen Sitzung angelogen habe. Die für die Abwicklung der Caritas zuständige PwC-Partnerin Tiphaine Gruny hatte dem Ausschuss erzählt, der Caritas lediglich einen „support opérationnel“ bei der Geschäftsführung und bei der Buchhaltung geleistet zu haben. Der OGBL habe jedoch bestätigt, dass Gruny auch Personalmanagement betrieben und konkrete Anweisungen an die Beschäftigten gegeben habe, hieß es nach der Sitzung.
Im März hatte der OGBL bei den Sozialwahlen bei HUT seine absolute Mehrheit an die Aleba verloren, die nun vier der insgesamt sieben Personalvertreter stellt.

 De Maart
De Maart


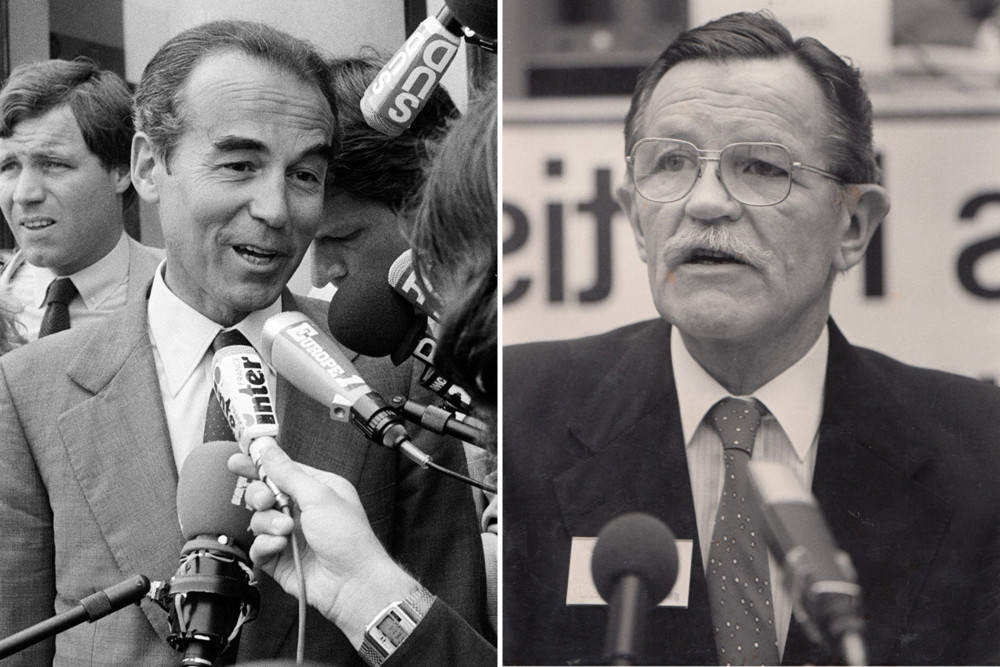




Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können