Tageblatt: Üben Sie schon fleißig die Sprache der Macht, die Europa laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lernen muss?
Alexander Schallenberg: Die brauchen wir nicht zu üben. Wir in Europa haben diese Sprache der Macht durchaus schon entwickelt, aber man kann immer noch besser werden.
Widerspricht das nicht dem österreichischen Zugang zur Außenpolitik, die das Gegenteil von Machtpolitik ist.
Nein. Wenn wir von Sprache der Macht reden, dann denke ich an Elemente der Soft Power und an Herstellung der vollen Kohärenz. Europa ist immer noch der größte Geber an Hilfe in dieser Welt, Europa ist einer der größten Handelsblöcke. Was uns manchmal nicht so gut gelingt, ist, diese Stärkepositionen in außenpolitische Stärke umzumünzen.
Können Sie einen Krisenherd dieser Welt nennen, wo die EU machtvoll oder zumindest einflussreich unterwegs ist?
Die Arbeit, die die EU in ihrer Nachbarschaft vollbringt – man braucht nur an Südosteuropa, Osteuropa und an den Südkaukasus zu denken -, weist durchaus Erfolgsmodelle auf, mit denen wir dazu beitragen, dass sich die Situationen vor Ort nicht verschärfen.
Aber die großen Herausforderungen sind Syrien, Ukraine, Afrika oder der Streit um den Atomdeal mit Iran.
Das sind Krisenherde, die die Kapazitäten aller Staaten dieser Welt übersteigen. Hier bedarf es der Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft. Europa wird die Herausforderungen im Iran nicht allein lösen können.
Gefährliche Entwicklung
Mehr außenpolitische Effizienz brächte die Abkehr von der Einstimmigkeit. Birgt das aber nicht gerade für kleinere Staaten die Gefahr von Einflussverlust?
Natürlich, es ist immer eine Abwägung. Das Grundproblem der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist nicht so sehr das Abstimmungserfordernis, als der Wille zum gemeinsamen Handeln.
Ein Beispiel für eine Mehrheitsentscheidung ist die Verteilung von Asylwerbern: Die osteuropäische Staaten, die 2015 dagegen waren, ignorieren den Mehrheitsbeschluss einfach.
Das ist ein Beispiel für eine gefährliche Entwicklung. Wir sind in dieser Frage immer dafür eingetreten, dass sie im Konsens getroffen werden muss.
Aber Österreich hat 2015 auch noch für die Verteilung gestimmt.
Wir brauchen für eine Reform des Dublin-Systems die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten. Genau diese Erfahrung von 2015 hat dazu geführt, dass wir umgedacht und gesagt haben, dass kann nur funktionieren, wenn alle mitziehen.
Ich habe keinen Zweifel, dass Bundeskanzlerin Merkel die deutsche Position sehr deutlich im Europäischen Rat vertreten kann.
Nach dem Brexit drängt Frankreich in den Vordergrund, während Deutschland mit sich selbst beschäftigt ist. Wie sehen Sie die neue Machtarchitektur Europas – auch vor dem Hintergrund der deutschen Turbulenzen?
Diese Architektur ist erst im Entstehen. Das Vereinigte Königreich wird uns auch als ausgleichendes Element fehlen. Wir brauchen ein starkes Deutschland, genauso wie ein starkes Frankreich. Aber es reicht nicht, wenn nur Paris und Berlin an einem Strang ziehen. Die Situation ist nicht mehr dieselbe wie 1995. Europa ist größer und vielfältiger geworden.
Ist Deutschland derzeit stark?
Es gibt einen Unterschied zwischen dem europäischen Auftreten Deutschlands und innenpolitischen Turbulenzen. Ich habe keinen Zweifel, dass Bundeskanzlerin Merkel die deutsche Position sehr deutlich im Europäischen Rat vertreten kann.
Von Erfolgsstory weit entfernt
Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments Guy Verhofstadt sagt, das Gute am Brexit sei, dass er als abschreckendes Beispiel gewirkt habe. Sehen Sie das auch so?
In gewisser Weise ja. Vor dreieinhalb Jahren hatten wir Angst, dass andere Staaten dem britischen Beispiel folgen könnten. Als man jedoch gesehen hat, was für eine Mammutaufgabe es selbst für einen großen Staat ist, sich selber aus dem europäischen Verbund herausschneiden zu müssen, hat diese Erfahrung eher abschreckend gewirkt. Zudem hatte der Brexit auch eine einigende Wirkung: Allen Unkenrufen zum Trotz sind die EU 27 voll einig gewesen.
Die EU steht jetzt aber auch vor einem Dilemma: Einerseits will man ein für beide Seiten gutes Abkommen, andererseits darf der Brexit keine Erfolgsstory werden, weil der Austritt dann doch noch zur verlockenden Perspektive für potenzielle Nachahmungstäter werden könnte.
Von einer Erfolgsstory sind wir meilenweit entfernt. Wir wären bereit, ein viel engeres Beziehungsgeflecht aufzubauen, als es London wünscht. Aber es darf und wird nicht so ein, dass wir die Chancen und Möglichkeiten einer EU-Mitgliedschaft durch ein Abkommen quasi duplizieren. Das wird nicht gehen.
Halten Sie den Abschluss eines umfassenden Abkommens mit den Briten bis Jahresende für machbar.
Die Zeit ist knapp. Die Briten verweisen auf das CETA-Abkommen mit Kanada als Vorbild. Da sehe ich die Möglichkeit, dass man relativ schnell zu einer Einigung kommt, weil man auf ein bestehendes Abkommen zurückgreifen kann. Aber es gibt eine Reihe von anderen Themen – wie etwa im Sicherheitsbereich, oder beim Datenaustausch im Schengen-System – wo es vielleicht mehr Zeit braucht.
Manche rechnen damit, dass die Briten in ein paar Jahren in die EU zurückwollen. Sehen Sie auch so eine Perspektive?
Sollte das Vereinigte Königreich je wieder überzeugend den Wunsch äußern, der EU beizutreten, würde das sicher nicht an einem österreichischen Veto scheitern. Ich rechne jedoch nicht in unmittelbarer Zukunft damit. Es werden noch viele Jahre ins Land ziehen, bis sich diese Frage stellen könnte.
Österreich tritt sehr stark dafür ein, dass sehr bald, noch im März, die Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien eröffnet werden.
Österreich macht sich stark für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit den Westbalkanstaaten, Macron steht auf der Bremse. Wie lange kann sich die EU noch leisten, diese Region dem wachsenden Einfluss Chinas und Russlands zu überlassen?
Überhaupt nicht. Es gibt in der Politik kein Vakuum. Sollte sich die EU zurückziehen, würde das natürlich von Drittstaaten gefüllt werden – Stichwort: China, Russland oder Türkei. Wir sind als Europäische Union hier im Wort. Österreich tritt sehr stark dafür ein, dass sehr bald, noch im März, die Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien eröffnet werden.
Haben Sie Signale, dass es wirklich dazu kommt?
Die Diskussionen dazu finden gerade statt. Die Kommission hat soeben ihren Vorschlag zur Gestaltung des Erweiterungsprozesses vorgelegt. Ich glaube, dass die Kommission gute Arbeit geleistet hat, um einen Kompromiss zu erzielen, der sowohl für Frankreich als auch die anderen Staaten akzeptabel sein sollte.
Marinemission wäre Themenverfehlung
Die EU soll das Waffenembargo gegen Libyen kontrollieren. Laut EU-Außenbeauftragtem Josep Borrell „kontrolliert da niemand irgendetwas“. Ist das nicht ein Armutszeugnis für Europa?
Wir unterstützen den Berliner Prozess, der die Chance für einen Waffenstillstand eröffnet hat. Dazu gehört auch die Einhaltung und Kontrolle des UNO-Waffenembargos. Tatsache ist, dass diese Kontrollen nicht stattfinden, weil die Waffentransporte über Luft und Land erfolgen. Daher tritt Österreich für Kontrollen in der Luft und Land ein. Eine maritime Mission wäre eine Themenverfehlung.
Es bleibt also beim Nein Österreichs zu einer Wiederbelebung der EU-Mission „Sophia“?
Ziel muss sein, die Kontrolle via Luft und Land sicherzustellen. Denn wenn es wirklich ums Waffenembargo geht, ist das der richtige Ansatzpunkt.
Ist das in der Bundesregierung ausdiskutiert – der Grüne Sozialminister Rudolf Anschober wäre ja für eine Wiederbelebung von „Sophia“ und Seenotrettung?
Die Linie ist klar: Wir unterstützen den Waffenstillstand. Die Frage einer Seenotrettungsmission stellt sich aus unserer Sicht in diesem Zusammenhang nicht.
Nahost-Frieden nur durch Verhandlungen
Österreich hat sich im Gegensatz zur EU bisher einer inhaltlichen Bewertung des Nahost-Friedensplans von Donald Trump enthalten. Warum eigentlich?
Wir begrüßen es, dass die US-Administration den Mut hat, wieder etwas auf den Tisch zu legen. Klar ist: Eine Zwei-Staaten-Lösung kann es nur geben, wenn sie durch Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern zustande kommt. Dass dieser Plan per Akklamation angenommen wird, war ja nicht zu erwarten. Es ist gut, dass überhaupt etwas auf dem Tisch liegt. Wir müssen etwas in Bewegung bringen, dass den Namen Friedensprozess verdient.
Wir begrüßen es, dass die US-Administration den Mut hat, wieder etwas auf den Tisch zu legen.
Schaut aber nicht so aus, als hätte Trump das erreicht.
Es haben sich auch schon frühere US-Administrationen versucht. Es wird in Nahost keinen Frieden ohne Mitwirkung der USA geben.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Europäern einen „strategischen Dialog“ über die atomare Abschreckung angeboten. Wird sich das für eine atomwaffenfreie Welt kämpfende Österreich an diesem Dialog beteiligen?
Wir treten dafür ein, dass Europa stärker für seine eigene Sicherheit sorgen kann. Dass wir dessen ungeachtet eine klare Haltung gegen Atomwaffen haben, steht nicht zur Debatte. Macron hat ja auch nicht angeboten, dass es eine europäische Atombombe geben soll.
Konvention gegen Killerroboter, Cyberangriffe auf Ministerium
Sie streben eine Konvention gegen autonomen Waffensysteme, sogenannte Killerroboter an. Wie wollen Sie die Länder ins Boot holen, die längst an solchen Systemen arbeiten?
Es geht hier um eine internationale Gewissensbildung. Das haben wir schon bei den Landminen und bei der Streumunition geschafft. Bevor es die Ottawa-Konvention gab, haben viele gesagt, das wird nicht gelingen. Letztlich hat diese Konvention doch dazu geführt, dass diese Waffen geächtet wurden. Ähnliches sehe ich hier. Wir haben die Chance, nicht reaktiv, sondern proaktiv zu arbeiten, bevor autonome Waffensystem die Schlachtfelder erreichen.
Das österreichische Außenministerium ist seit 5. Januar Ziel eines permanenten Cyberangriffes. Ist er inzwischen beendet?
Wir stehen sehr knapp davor, dass der Angriff beendet ist.
Wenn es einem Angreifer möglich ist, mehr als einen Monat lang eine Cyberattacke auf ein zentrales Ministerium aufrechtzuerhalten, was sagt das über das Cybersicherheitsniveau in Österreich?
Es ist fast ein Modellfall: Wir haben den Angriff sehr früh erkannt. In anderen Staaten, in denen es solche Angriffe gab, hat man teilweise monatelang nicht bemerkt, dass die Angreifer im System waren. Zu keinem Zeitpunkt ist oder war die Aufrechterhaltung der konsularischen Betreuung unserer Staatsbürger weltweit gefährdet. Auch die Zusammenarbeit zwischen Bundeskanzleramt, Außen-, Innen- und Verteidigungsministerium funktioniert hervorragend.
Weiß man schon, wer dahintersteckte?
Es gibt gewisse Indizien, aber keine handfesten Beweise, um zu sagen: Das ist der Schuldige
Es wird gemutmaßt, dass es sich um einen staatlichen Akteur handelt.
Das gilt aufgrund der Art des Angriffes und der Professionalität weiterhin. Mir wurde aber von Experten gesagt, dass auch private Gruppen in der Lage sind, sich die Etiketten von staatlichen Akteuren umzuhängen oder auch staatliche Akteure sich manchmal so gebärden, als kämen sie aus anderen Staaten. Deshalb bin ich vorsichtig, mich öffentlich zu äußern, denn dies wäre eine schwerwiegende Anschuldigung. Mir geht es jetzt in erster Linie darum, den Brand zu löschen. Die Identifizierung des Brandstifters ist die zweite Priorität.

 De Maart
De Maart

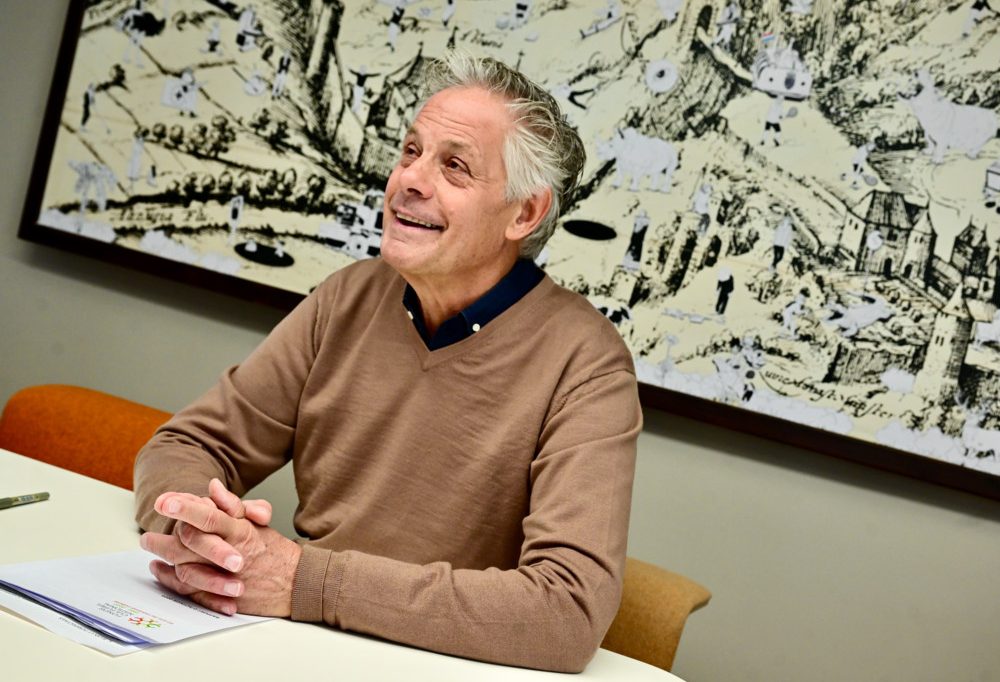





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können