Von unserem Korrespondenten Tom Haas
Jonathan Entwistle inszeniert mit „The End of the F***ing World“ eine Tragödie, die auf den ersten Blick dem schwarzen, britischen Humor huldigt. Bei näherem Hinsehen ist es jedoch die Ironie des Alltäglichen, die uns zum Lachen zwingt, um das Leid zu überspielen. Zwei Jugendliche brechen aus ihrem biederen, sozialen Gefüge aus, auf der Suche nach einem Leben, das ihren Wünschen entspricht. Alyssa und James, beide mit ihren eigenen Traumata belastet, suchen eine Nähe, zu der sie selbst kaum fähig sind. Nach der Auseinandersetzung mit Eltern, schmierigen Sexualstraftätern und der Justiz finden sie sie letztlich bei sich selbst – und bringen die ganze Welt gegen sich auf.
Die Tugend des Kritikers ist die Anmaßung. Jedes Kunstwerk, das eine öffentliche, kritische Rezeption erfährt, wird von Kulturjournalisten in den Medien ausgedeutet, interpretiert und paraphrasiert, was nicht unwesentlich dazu beiträgt, wie das Werk von anderen Menschen betrachtet wird. Je nach Meinungsmacht des Kritikers sind der Verriss oder das Lob sogar maßgeblich für Erfolg oder Misserfolg. Mit dieser Anmaßung geht jedoch die Verantwortung einher, sich dem Objekt der Kritik mit dem gebotenen Respekt und einem handfesten Instrumentarium zu nähern:
Was dem Chirurgen sein Skalpell und sein anatomisches Lexikon sind, sind dem Kritiker seine Offenheit und sein Kanon – zwei Werkzeuge, die sich nur scheinbar widersprechen. Denn natürlich braucht es ein kulturgeschichtliches Wissen, um ein Werk kontextualisieren zu können; genauso braucht es jedoch einen offenen Geist, um die Neuartigkeit eines Werkes erkennen zu können. Fehlt eine der Komponenten, wird die Kritik belanglos und flach.
Genau das ist „The End of the F***ing World“ von Jonathan Entwistle passiert. Da Netflix den Vertrieb in Kontinentaleuropa übernimmt, war das leider abzusehen – die Serie wurde im Kontext der breit gefächerten Netflix-Veröffentlichungen rezipiert, die zu einem erheblichen Teil schlicht Müll sind. Zwischen rührseligem Blödsinn wie „Love“ und mittelmäßiger Inklusionscomedy wie „Atypical“ wird die Serie natürlich als „Kleinod“ bezeichnet, ferner fallen die üblichen Worthülsen wie „Dramedy“, „Coming of Age“, „Roadmovie“ und, um dem die Krone aufzusetzen, „als träfe ‚Juno‘ auf David Lynch“.
Für sich genommen ist keine Betrachtung unbedingt falsch – trotzdem werden sie der Serie nicht gerecht. Statt einer holistischen Interpretation werden bekannte Elemente herausgepickt und mit etwas Fantasie zu einer Lobeshymne verklausuliert.
Postmoderner Shakespeare
Dabei laden die acht kurzen und unheimlich dichten Episoden zu einer ganzheitlichen Interpretation förmlich ein. Es gibt kein Füllmaterial, keine Debatte, die aus falsch verstandenem Aktualisierungsbedürfnis mal eben in einer Episode abgehandelt wird. Jedes Element der Serie ordnet sich dem Plot unter, von den Dialogen über den Soundtrack bis zur glasklaren Bildsprache. Dabei durchzieht ein fein gesponnenes Garn der Ironie die gesamte Textur.
Die Instagram-Ästhetik wird durch die profane Brutalität des Realen persifliert, das teils schockierende Geschehen wiederum erfährt ein gewisses Comic Relief durch die Gedanken der beiden Protagonisten, die sich als Erzählerstimmen an die vierte Wand anlehnen und die tatsächlichen Dialoge mit der absurden Gedanken- und Gefühlswelt der Teenager in Einklang bringen.
James und Alyssa sind zwei 17-Jährige aus einer ländlichen Gegend in England, beide unangepasst, beide in ihren Familienkonstellationen unglücklich. Während Alyssa sich nach der erneuten Heirat ihrer Mutter mit einem Arschloch möglichst kratzbürstig gibt, um niemanden an sich ranzulassen, hat James nach dem Suizid seiner Mutter sämtliche Gefühle ausgeschlossen und glaubt, er sei ein Psychopath.
Nachdem er einige Kleintiere und die Nachbarskatze getötet hat, will er sich nun einem größeren Ziel widmen – Alyssa erscheint ihm als ideales Opfer und so gibt er vor, sich in sie zu verlieben. Konsequenterweise begleitet er sie, als sie von zu Hause abhaut und stiehlt zur Flucht das Auto seines Vaters, in der Hoffnung, dass sich auf der Reise die Gelegenheit ergibt, sie umzubringen.
Natürlich erinnert die Ausgangssituation an ein Roadmovie, allerdings entlarvt die folgende Reise genau dieses Konzept als unrealistischen Traum zweier Heranwachsender. Die Reise eskaliert schnell, die eingangs erwähnte brutale Realität ist der unsichtbare Dritte, der sie auf ihrer Flucht begleitet. Entwistle komponiert ein Drama nach geradezu aristotelischem Muster, nach dem mörderischen Höhepunkt treibt der Strudel an Ereignissen das unerwartete Liebespaar unausweichlich in die Katastrophe.
Die Tragik ergibt sich allerdings nicht aus einem göttlichen Ränkespiel oder pathetischer Schicksalsergebenheit, sondern aus dem Scheitern an einer hässlichen, prosaischen Realität. Darüber täuschen kein Instagram-Filter und keine nostalgische Popmusik hinweg – sie sind nur der höhnische Kommentar, die ästhetische Seinsverachtung, die das Drama der Existenz erträglich machen sollen.
Der Serie liegt die gleichnamige Graphic Novel von Charles Forsman zugrunde. Comic und Graphic Novel haben sich spätestens seit „Watchmen“ zum subversiven, künstlerischen Experimentierfeld entwickelt, aus dem ein nicht unerheblicher Anteil der heutigen Popkultur seine Inspiration bezieht. Der Comic ist einerseits von Anfang an als massenkompatibles Medium ausgelegt gewesen, der Zugang ist für Künstler und Rezipienten zunächst niedrigschwellig.
Andererseits ist die notwendige Formel zum Bestseller immer noch ein Rätsel, weswegen die Hefte sich trotz hoher Auflagen im Schatten von Film, Roman und Serie bewegen und dabei eine künstlerische Eigenständigkeit bewahren, die zwar mit der Verwertungslogik des Unterhaltungsmarktes kokettiert, sich ihr letztlich aber entzieht. Entwistle fand Forsmans Comic nach eigenen Angaben in einem Mülleimer.
Es ist unseren heutigen Konsumgewohnheiten und der schieren Menge an verfügbarem Material geschuldet, dass wir Labels wie „Dramedy“ brauchen – ein völlig unsinniges Kofferwort – um ein Werk klassifizieren zu können, das eigentlich nur die traditionellen Elemente der Tragödie zu einer zeitgenössischen Geschichte flicht und mit einer Prise postmodernem Nihilismus garniert.
Und das ist „The End of the F***ing World“: eine waschechte Tragödie.

 De Maart
De Maart




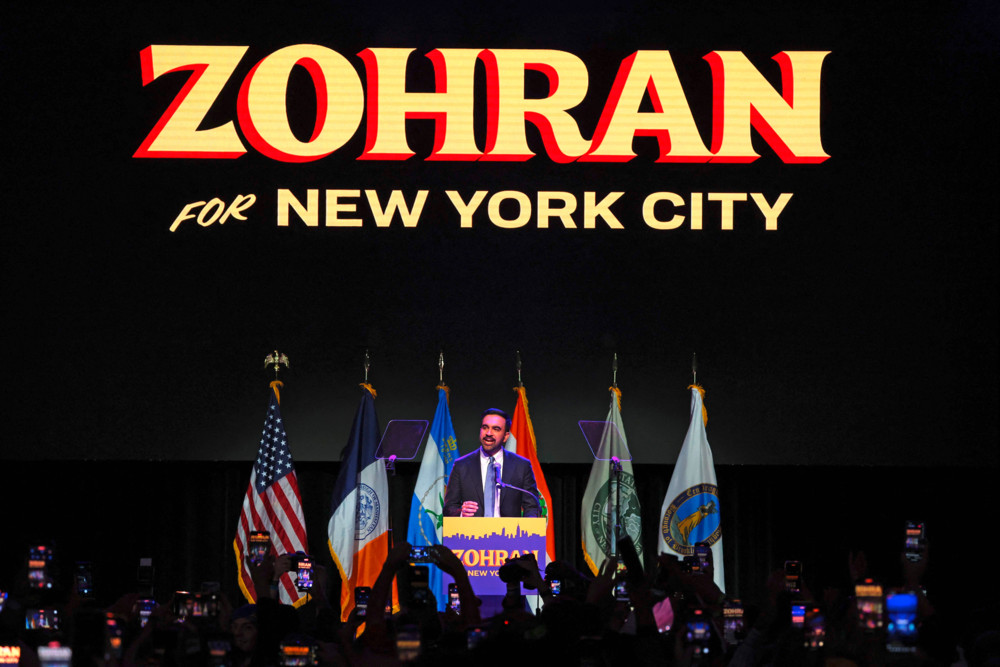


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können