Im Gegensatz zu den meisten anderen der insgesamt 33 akkreditierten Dopinglabore konnten die Kölner dank besserer Messapparate die Clenbuterol-Spuren im Blut des spanischen Tour-de-France-Gewinners nachweisen.
Die Diskrepanz zwischen der Leistungsfähigkeit der Dopinglabore bezeichnet Prof. Dr. Mario Thevis als „absurd“. Er muss es wissen, ist er doch der Sprecher des Zentrums für Präventive Dopingforschung an der Sporthochschule Köln und somit einer der renommiertesten Dopingexperten in Deutschland.
Am Freitag gab Thevis auf Einladung der „Société des sciences médicales“ in der Banque de Luxembourg in einer Konferenz Einblicke in die Welt des Dopings und der Dopingbekämpfung.
Präventiv
Die präventive Dopingforschung beschäftigt sich in erster Linie mit der Entwicklung neuer Nachweisverfahren, weshalb Thevis’ kurzweiliger Vortrag über das Hase-und-Igel-Spiel zwischen Kontrolleur und Dopingsünder auch im Zeichen neuartiger Präparate zur illegalen Leistungssteigerung stand. So haben momentan bei den Anabolika-Präparaten die sogenannten SARMs Hochkonjunktur. Die haben die gleichen Eigenschaften wie herkömmliche Steroide (in erster Linie Muskelaufbau), jedoch nicht deren Nebenwirkungen.
Für die Dopingjäger bedeuten neue Produkte wie SARMs, dass sie neue Nachweisverfahren entwickeln müssen. Was einen erheblichen Aufwand bedeuten kann, denn oftmals sind die Substanzen noch in der klinischen Testphase und somit nicht erhältlich. Was freilich nicht für den Schwarzmarkt gilt. Denn im Internet gibt es die Produkte oft noch bevor die Substanzen in pharmazeutischen Produkten auftauchen. Und genau hier wird es gefährlich: „Bei 30 bis 40 Prozent der im Internet erhältlichen Dopingpräparate ist nicht das drin, was drauf steht“, sagt Thevis, „das ist extrem gefährlich und der eigentliche Grund, weshalb wir das hier (die Dopingbekämpfung, d.Red.) machen“. Wobei es eher die Hobbysportler sind, die auf im Internet angebotene Produkte zurückgreifen. Profis vertrauen eher auf zertifizierte Arzneimittel, weil bei denen die Zusammensetzung bekannt ist, was natürlich auch eine Rolle für die (Nicht-)Nachweisbarkeit spielt.
800 Euro für eine Dopingprobe
Wobei es allerdings auch genügend Labore gibt, die eine Dopingsubstanz minimal verändern, um sie bei der Kontrolle „unsichtbar“ zu machen. So können die rund 800 Euro Gesamtkosten für eine Dopingprobe (die Laboranalyse allein kostet rund 180 Euro) schnell für die Katz sein, weshalb es durchaus Überlegungen gibt, Dopingproben mit unkonventionellen Methoden wie der Analyse von Einstichstellen oder gar dem Einsatz kleiner Bodyscanner zu bereichern. Dass Tätowierungen bei Sportlern nicht ausschließlich der Ästhetik dienen, sondern auch die Einstichwunden verstecken können, ist kein Geheimnis.
Im Grunde genommen gab und gibt es nur drei Möglichkeiten, nicht positiv getestet zu werden, wie Prof. Dr. Mario Thevis unterstreicht: „Erstens: Nichts nehmen. Zweitens: Etwas nehmen und früh genug absetzen, wobei das bei den immer häufigeren Trainingskontrollen heutzutage riskant ist. Und drittens: Nicht das eigene Urin abgeben.“
Wobei dem Einfallsreichtum bei den Ausreden überführter Sportler keine Grenzen gesetzt sind. Immerhin wurde das Kalbfleisch, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Dienstag süffisant anmerkte, ganz im Gegensatz zu Alberto Contador freigesprochen.

 De Maart
De Maart



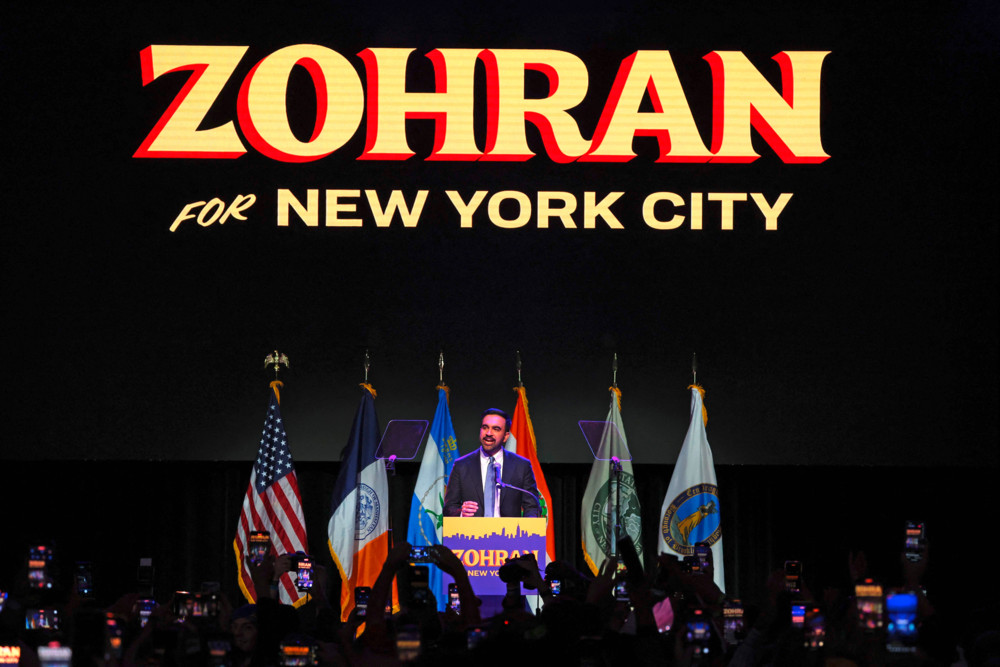



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können